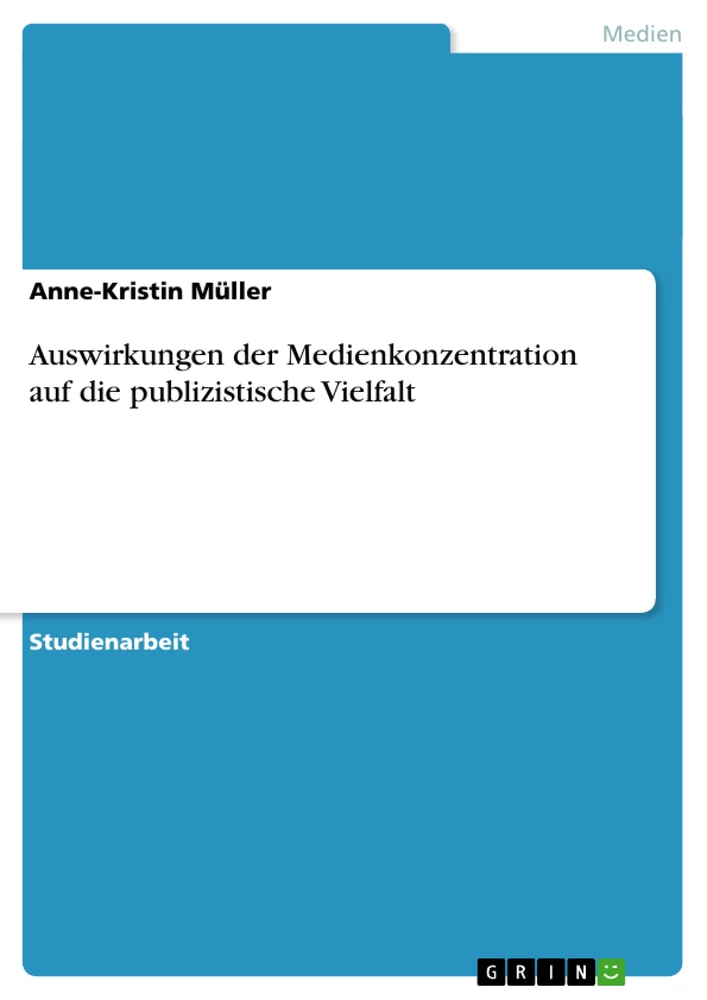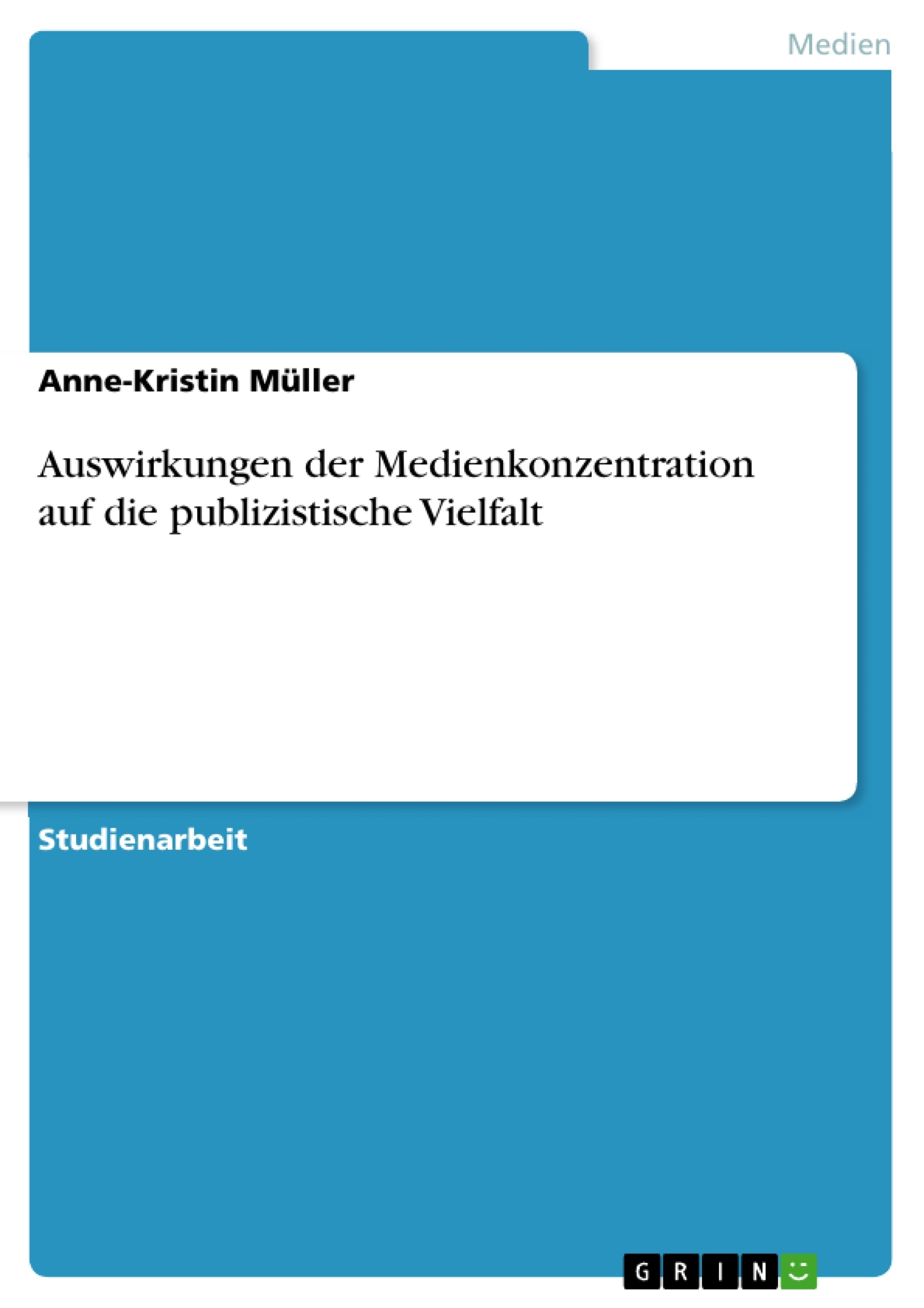Das Thema „Auswirkungen von Medienkonzentration auf die publizistische Vielfalt“, ist ein vieldiskutiertes und meinungsspaltendes zugleich. Neben Bereichen wie Ökonomie und Kommunikationswissenschaft, findet die Frage nach optimaler Vielfalt auch regelmäßig Einzug in medienpolitische Auseinandersetzungen. Im Mittelpunkt dieser Diskussionen steht häufig die Frage nach einem angemessenem Schutz der Meinungsvielfalt – doch wie sich im Laufe dieser Arbeit zeigen wird, besteht bereits bei der Definition des Begriffes „Vielfalt“ Uneinigkeit in den einzelnen Lagern. Im Rahmen des Seminars „Werbung und Massenmedien in Deutschland“, ist es ein wichtiger Aspekt zu untersuchen, wie sich insbesondere bei den privaten Rundfunkanstalten die Abhängigkeit von Werbung und der daraus resultierende Wettbewerb um Marktanteile auf das Angebot und dessen Vielfältigkeit auswirken. Weitergehend stellt sich die Frage, ob eine zunehmende Medienkonzentration tatsächlich eine Gefahr für die Vielfalt des Medienangebots darstellt, oder ob es eventuell andere Einflüsse sind die einen Schutz der Meinungsvielfalt nötig machen. Außerdem gilt es herauszuarbeiten, ob ein so wichtiger und bedeutender Bestandteil eines demokratischen Staates, wie die Meinungsfreiheit aller Bürger, dem ökonomischen Wettbewerb ungeschützt ausgesetzt werden kann, beziehungsweise welche Regelungen unabdingbar sind um Meinungspluralität zu gewährleisten. Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit liegt also hauptsächlich in der Frage, inwiefern der Konzentrationsgrad von Medienunternehmen einen Rückgang, beziehungsweise eine Veränderung der publizistischen Vielfalt bedingt und welche Rolle der Wettbewerb und dessen Gesetze in diesem Zusammenhang spielen. Da der Begriff publizistischer Vielfalt kein klar definierter, sondern ein häufig mit verschiedenen Bedeutungen bedachter Ausdruck ist, wird ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit darin liegen, die verschiedenen Ansichten und Fakten einander gegenüber zustellen, beziehungsweise die verschiedenen Standpunkte zu erläutern. Eine Ergebnisformel oder eine Antwort auf die aufkommenden Fragen bezüglich des Themas kann und wird es nicht eindeutig geben, denn letztendlich ist es auch von subjektiven Einschätzungen abhängig, was als nötig erachtet wird um von einer vielfältigen Medienlandschaft zu sprechen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen der Publizistischen Vielfalt
- Nähere Bestimmung des Begriffs
- Konsumtive Vielfalt
- Meritorische Vielfalt
- Horizontale und vertikale Vielfalt
- Möglichkeiten der Messbarkeit publizistischer Vielfalt
- Häufigste Konzentrationsformen im Rundfunk
- Horizontale Konzentration
- Vertikale Konzentration
- Diagonale Konzentration
- Auswirkungen von Medienkonzentration auf die Vielfalt des Angebots im Rundfunk
- Auswirkungen von Unternehmenskooperationen
- Auswirkungen horizontaler Konzentration
- Auswirkungen horizontaler Konzentration auf Basis von Verträgen
- Auswirkungen vertikaler Konzentration
- Maßnahmen zum Schutz von Vielfalt
- Der Rundfunkstaatsvertrag und die KEK
- Möglichkeiten der Politik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen von Medienkonzentration auf die publizistische Vielfalt im deutschen Rundfunk. Sie beleuchtet verschiedene Definitionen von „Vielfalt“, analysiert Messmethoden und betrachtet verschiedene Konzentrationsformen (horizontal, vertikal, diagonal). Der Fokus liegt auf den Folgen dieser Konzentration für das Medienangebot und die Möglichkeiten der Politik, die Meinungsvielfalt zu schützen.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Publizistische Vielfalt“
- Analyse verschiedener Konzentrationsformen im Rundfunk
- Untersuchung der Auswirkungen von Medienkonzentration auf das Medienangebot
- Bewertung der Messbarkeit publizistischer Vielfalt
- Maßnahmen zum Schutz der Meinungsvielfalt
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit behandelt das viel diskutierte Thema der Auswirkungen von Medienkonzentration auf die publizistische Vielfalt, insbesondere im deutschen Privatrundfunk. Sie stellt die Problematik der unterschiedlichen Definitionen von „Vielfalt“ heraus und benennt das Erkenntnisinteresse: Inwieweit bedingt der Konzentrationsgrad von Medienunternehmen einen Rückgang oder eine Veränderung der publizistischen Vielfalt, und welche Rolle spielt der Wettbewerb dabei? Der Fokus liegt auf dem Rundfunkbereich aufgrund spezifischer Aspekte der Lizenzvergabe und Markteintrittschancen.
2. Grundlagen der Publizistischen Vielfalt: Dieses Kapitel untersucht den vielschichtigen Begriff der publizistischen Vielfalt. Ausgehend von der im Grundgesetz verankerten Meinungsfreiheit wird die Notwendigkeit verschiedener Informationsquellen für die Meinungsbildung betont. Es werden unterschiedliche Auffassungen von Vielfalt vorgestellt, insbesondere die Unterscheidung zwischen konsumtiver (Konsumentenpräferenzen) und meritorischer (gesellschaftlicher Nutzen) Vielfalt sowie horizontale und vertikale Vielfalt (zeitliche Dimension). Die Schwierigkeiten, den Begriff eindeutig zu definieren und zu messen, werden hervorgehoben.
3. Möglichkeiten der Messbarkeit publizistischer Vielfalt: Das Kapitel befasst sich mit den Herausforderungen der Messung von publizistischer Vielfalt aufgrund fehlender einheitlicher Definitionen. Es werden verschiedene Methoden diskutiert, darunter quantitative Inhaltsanalyse und Expertenurteile, wobei die Grenzen und Probleme dieser Ansätze betont werden. Die Unterscheidung zwischen der Messung des „Inputs“ (Anzahl der Anbieter, Reichweite) und des „Outputs“ (Pluralität der Meinungen) an Vielfalt wird erläutert, die unterschiedlichen Auffassungen verdeutlichend.
4. Häufigste Konzentrationsformen im Rundfunk: Hier werden die wichtigsten Konzentrationsformen im Rundfunk (horizontal, vertikal, diagonal) beschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf dem externen Wachstum durch Beteiligungen oder Ankäufe. Horizontale Konzentration, der Zusammenschluss von Unternehmen derselben Branche, wird als besonders relevant für die Medienpolitik und die Vielfalt angesehen. Vertikale und diagonale Konzentrationen werden im Hinblick auf ihre Komplexität und die Schwierigkeiten ihrer Erfassung im Kontext der Vielfalt erläutert.
5. Auswirkungen von Medienkonzentration auf die Vielfalt des Angebots im Rundfunk: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen verschiedener Konzentrationsformen auf die Angebotsvielfalt. Es werden die unterschiedlichen Perspektiven von Ökonomen und Medienpolitikern beleuchtet. Die Auswirkungen von Unternehmenskooperationen, horizontaler und vertikaler Konzentration, sowie von vertraglichen Abmachungen werden detailliert analysiert. Der „Hotelling’s effect“ als mögliche Folge der Konzentration wird diskutiert. Die Unklarheiten und die fehlende empirische Evidenz bezüglich der Auswirkungen auf die publizistische Vielfalt werden hervorgehoben.
6. Maßnahmen zum Schutz von Vielfalt: Das Kapitel befasst sich mit Maßnahmen zum Schutz der Meinungsvielfalt, insbesondere dem Rundfunkstaatsvertrag und der KEK (Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich). Die Grenzen dieser Maßnahmen werden angesprochen, unter anderem die unzureichende Berücksichtigung mehrdimensionaler Vielfaltskonzepte und die Schwierigkeit, vertragliche Verbindungen zwischen Unternehmen zu kontrollieren. Die Rolle der Politik bei der Lizensierung und der Zuteilung von Distributionskanälen wird diskutiert.
Schlüsselwörter
Medienkonzentration, publizistische Vielfalt, Meinungsvielfalt, Rundfunk, Wettbewerb, horizontale Konzentration, vertikale Konzentration, KEK, Rundfunkstaatsvertrag, Medienökonomie, Inhaltsanalyse, Meinungsfreiheit, Marktanteile, Programmvielfalt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Auswirkungen von Medienkonzentration auf die publizistische Vielfalt im deutschen Rundfunk
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen von Medienkonzentration auf die publizistische Vielfalt im deutschen Rundfunk. Sie analysiert verschiedene Definitionen von „Vielfalt“, Konzentrationsformen (horizontal, vertikal, diagonal) und deren Folgen für das Medienangebot. Ein Schwerpunkt liegt auf den Möglichkeiten der Politik, die Meinungsvielfalt zu schützen.
Welche Definitionen von „publizistischer Vielfalt“ werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet unterschiedliche Auffassungen von publizistischer Vielfalt, insbesondere die Unterscheidung zwischen konsumtiver (Konsumentenpräferenzen) und meritorischer (gesellschaftlicher Nutzen) Vielfalt sowie horizontale und vertikale Vielfalt (zeitliche Dimension). Die Schwierigkeiten, den Begriff eindeutig zu definieren und zu messen, werden hervorgehoben.
Welche Konzentrationsformen im Rundfunk werden untersucht?
Die Arbeit beschreibt die wichtigsten Konzentrationsformen im Rundfunk: horizontale (Zusammenschluss von Unternehmen derselben Branche), vertikale (Zusammenschluss von Unternehmen verschiedener Stufen der Wertschöpfungskette) und diagonale Konzentration. Der Schwerpunkt liegt auf der horizontalen Konzentration und deren Auswirkungen auf die Medienpolitik und die Vielfalt.
Wie wird die publizistische Vielfalt gemessen?
Das Kapitel zur Messbarkeit der publizistischen Vielfalt diskutiert verschiedene Methoden, darunter quantitative Inhaltsanalyse und Expertenurteile. Es werden die Grenzen und Probleme dieser Ansätze betont und die Unterscheidung zwischen der Messung des „Inputs“ (Anzahl der Anbieter, Reichweite) und des „Outputs“ (Pluralität der Meinungen) erläutert.
Welche Auswirkungen hat Medienkonzentration auf die Angebotsvielfalt?
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen verschiedener Konzentrationsformen auf die Angebotsvielfalt. Es werden die unterschiedlichen Perspektiven von Ökonomen und Medienpolitikern beleuchtet und die Auswirkungen von Unternehmenskooperationen, horizontaler und vertikaler Konzentration sowie vertraglichen Abmachungen detailliert untersucht. Der „Hotelling’s effect“ als mögliche Folge der Konzentration wird diskutiert. Die Unklarheiten und fehlende empirische Evidenz bezüglich der Auswirkungen auf die publizistische Vielfalt werden hervorgehoben.
Welche Maßnahmen zum Schutz der Meinungsvielfalt gibt es?
Die Arbeit befasst sich mit Maßnahmen zum Schutz der Meinungsvielfalt, insbesondere dem Rundfunkstaatsvertrag und der KEK (Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich). Die Grenzen dieser Maßnahmen, wie die unzureichende Berücksichtigung mehrdimensionaler Vielfaltskonzepte und die Schwierigkeit, vertragliche Verbindungen zwischen Unternehmen zu kontrollieren, werden angesprochen. Die Rolle der Politik bei der Lizensierung und der Zuteilung von Distributionskanälen wird diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Medienkonzentration, publizistische Vielfalt, Meinungsvielfalt, Rundfunk, Wettbewerb, horizontale Konzentration, vertikale Konzentration, KEK, Rundfunkstaatsvertrag, Medienökonomie, Inhaltsanalyse, Meinungsfreiheit, Marktanteile, Programmvielfalt.
- Citation du texte
- Anne-Kristin Müller (Auteur), 2008, Auswirkungen der Medienkonzentration auf die publizistische Vielfalt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137126