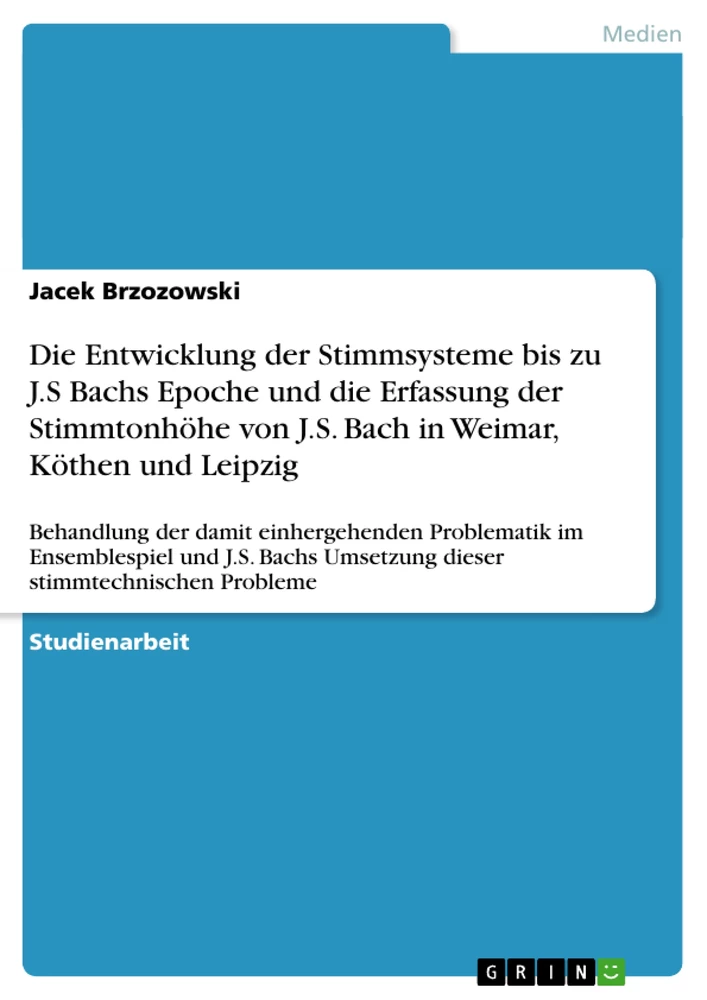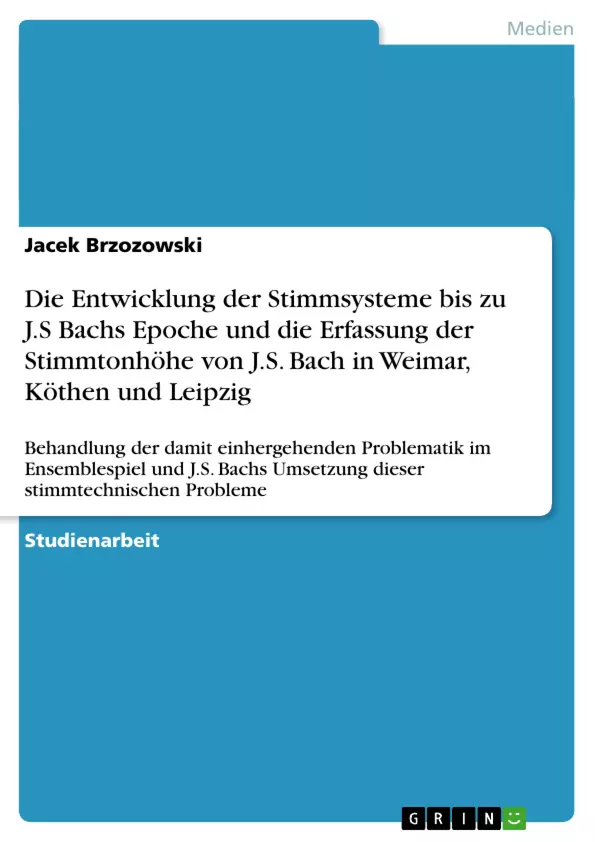In der vorliegenden Hausarbeit beschäftige ich mich mit den Stimmsystemen und den Stimmtonhöhen von Johann Sebastian Bach. Zunächst beginne ich im zweiten Kapitel mit einem allgemeinen Überblick, der Entwicklung der Stimmsysteme und explizit den spezifischen Unterschieden der verschiedenen am meisten gebrauchten Temperaturen, nämlich der pythagoreischen, der mitteltönigen Stimmung und den wohltemperierten Stimmungen. Dabei unterscheide ich zwischen der wohltemperierten gleichschwebenden und ungleichschwebenden Temperatur wegen der oft missverständlichen Handhabung dieser Begrifflichkeiten.
Abschließend führe ich die Entwicklung der Stimmsysteme bis zu den Lebzeiten von J. S. Bach fort, um mich im dritten Kapitel mit den Stimmtonhöhen und Stimmungsprinzipien, die zu dieser Zeit benutzt wurden zu befassen. Dabei werde ich die Problematik des Zusammenspielens bei unterschiedlicher Stimmtonhöhe der Instrumente näher beschreiben, um aufzuzeigen, wie Bach an den verschiedenen Stationen seiner Laufbahn diese Herausforderungen bewältigt hat.
Weiterhin werde ich im vierten Kapitel die verschiedenen Temperaturen aufzählen, die Johann Sebastian Bach benutzt haben könnte - denn ein exakter wissenschaftlicher Beweis liegt bis heute nicht vor - und versuchen die Spekulation etwas einzugrenzen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Entwicklung der Stimmsysteme
2. 1. Die Pythagoreische Stimmung
2.2. Die Mitteltönige Stimmung
2.3. Die „wohltemperierte“ gleichschwebende und ungleichschwebende Stimmung
3.1. Stimmtonhöhe in Weimar
3.2. Stimmtonhöhe in Köthen
3.3. Stimmtonhöhe in Leipzig
4. Die Temperatur von Johann Sebastian Bach
Resümee
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
In der vorliegenden Hausarbeit beschäftige ich mich mit den Stimmsystemen und den Stimmtonhöhen von Johann Sebastian Bach. Zunächst beginne ich im zweiten Kapitel mit einem allgemeinen Überblick, der Entwicklung der Stimmsysteme und explizit den spezifischen Unterschieden der verschiedenen am meisten gebrauchten Temperaturen, nämlich der pythagoreischen, der mitteltönigen Stimmung und den wohltemperierten Stimmungen. Dabei unterscheide ich zwischen der wohltemperierten gleichschwebenden und ungleichschwebenden Temperatur wegen der oft missverständlichen Handhabung dieser Begrifflichkeiten. Abschließend führe ich die Entwicklung der Stimmsysteme bis zu den Lebzeiten von J. S. Bach fort, um mich im dritten Kapitel mit den Stimmtonhöhen und Stimmungsprinzipien, die zu dieser Zeit benutzt wurden zu befassen. Dabei werde ich die Problematik des Zusammenspielens bei unterschiedlicher Stimmtonhöhe der Instrumente näher beschreiben, um aufzuzeigen, wie Bach an den verschiedenen Stationen seiner Laufbahn diese Herausforderungen bewältigt hat.
Weiterhin werde ich im vierten Kapitel die verschiedenen Temperaturen aufzählen, die Johann Sebastian Bach benutzt haben könnte - denn ein exakter wissenschaftlicher Beweis liegt bis heute nicht vor - und versuchen die Spekulation etwas einzugrenzen.
2. Die Entwicklung der Stimmsysteme
Seit der Antike stammt der Gedanke die Oktave in einem günstigen Verhältnis in 12 Abschnitte zu teilen. Ein Stimmsystem legt das proportionale Verhältnis dieser 12 Stufen einer Tonleiter zueinander fest. Dabei kommt es darauf an, dass man in der Spielpraxis möglichst alle aus der Tonleiter resultierenden Tonarten benutzen kann. Im Weiteren behandle ich diese Entwicklung der Stimmsysteme.
2. 1. Die Pythagoreische Stimmung
Die älteste Temperatur der europäischen Musikgeschichte ist nach dem griechischen Ma-thematiker und Philosophen Pythagoras (ca. 6. Jahrhundert v. Chr.) benannt. Dieser hat die „Pythagoreische“ Stimmung jedoch nicht selbst erfunden, sondern er stützt sich auf das über Studienreisen durch Ägypten und Kleinasien gesammelte Wissen. Denn gerade die Griechen haben auf dem Gebiet der Musik viel aus Ägypten und Kleinasien übernommen.
Pythagoras' Verdienst ist die Systematisierung und Aufzeichnung dieses Wissens, wodurch man diese Stimmung nach ihm benannt hat.[1] Er war der Auffassung, dass der gesamte Kosmos (insbesondere die Konstellation der Himmelskörper) einfachen Zahlenverhältnissen gehorche und die Musik Abbild des Kosmos sei. Pythagoras erkannte zudem als erster den Zusammenhang zwischen den reinen Intervallen und ihren einfachen Zahlenverhältnissen und brachte diese physikalischen Erkenntnisse zur praktischen Anwendung.
Der erklingende Ton selbst ist ein Naturereignis und lässt sich genauso, wie das Licht in Spektralfarben dementsprechend physikalisch in Teiltöne zerlegen. Der Mensch hört nur den Grundton, während die darüber liegenden Obertöne (Oktav, Quinte, 2. Oktav und Terz) derart mit dem Grundton verschmelzen, dass wir diese im Einzelnen nicht heraushören, sondern nur als Klangfarbe empfinden. Die Obertöne bilden mit dem Grundton und auch untereinander reine Intervalle. Das heißt, ihre Schwingungszahlen ergeben bestimmte, sehr einfache Zahlenverhältnisse und ihr Klang ist durch einen hohen Verschmelzungsgrad ausgezeichnet. Ein reines Intervall ist demnach eine naturgegebene Ordnung. Zuallererst ist es notwendig das Instrumentarium Pythagoras' zu beschreiben, denn damit konkretisierte er - wie auch viele weitere Theoretiker - seine Lehre, nämlich mit dem Monochord.
Das Monochord ist ein länglicher Resonanzkasten mit einer darüber gespannten Saite, deren Länge man durch zwei Stege bestimmte. Ein dritter verschiebbarer Steg konnte die aufgespannte Saite nun in verschiedenen Verhältnissen teilen, sei es z.B. in einem Verhältnis von 1/2, welches durch Anreißen der Saite die Oktave, oder bei einem Verhältnis von 2/3 die Quinte erklingen lässt. Das übrig bleibende 1/3 bei einer Quint-orientierten Dreiteilung bringt die Oktave der Quinte hervor. Aus einem solchen Teilungsverfahren der Saite kann bei verschiedenen Längenverhältnissen demnach eine ganze Tonskala mit allen darin enthaltenen Halbtönen resultieren.
Das erste Intervall in der Teiltonreihe, nämlich der Grundton mit seinem ersten Oberton ist die Oktave. Sie ist für die Berechnung unergiebig, denn dieses Intervall führt nur immer wieder zu gleichnamigen Tönen. Der zweite Oberton aber, die Quinte ist nicht nur der erste, sich vom erklingenden Grundton differenzierende und naturgegebene Oberton, welcher sich durch seinen großen Verschmelzungsgrad charakterisiert, sondern liefert im so genannten Quintenzirkel über das Instrument geführt alle vorkommenden Töne. So hat Pythagoras seine "Pythagoreische" Stimmung über das Intervall der reinen Quinte am Monochord gefunden, indem er die Quinte zwölf Mal übereinander legte und somit eine zwölftönige chromatische Skala auf Grundlage dieser reinen Quinte erhielt.[2]
Um ein brauchbares Tonsystem zu erhalten, müsste der Quintenzirkel sich schließen, d.h. die zwölfte Quinte sollte sieben Oktaven höher zum gleichnamigen Ausgangston zurückkehren.[3] Das war aber nicht exakt, denn der Pythagoreische Quintenzirkel ließ sich nicht ganz schließen, da die zwölfte Quinte His etwas höher als der Ursprungston C war, und zwar genau um 23 ½ Cent, was in etwa einem ¼ Halbton entspricht. Diese Differenz nannte man das "pythagoreische Komma", welches immer wieder im pythagoreischen System auftaucht .[4]
Die Pythagoreische Stimmung genügte zwar den Ansprüchen ihrer Zeit durchaus, doch hatte sie schwerwiegende Mängel aufzuweisen, nämlich beim zuvor erwähnten nicht geschlossenen Quintenzirkel, sowie bei den dissonanten Terzen und Sexten, die durch die reinen Quinten zu erklären sind.
Diese Unzulänglichkeiten der Pythagoreischen Stimmung waren aber nicht besonders ausschlaggebend, denn die Theoretiker dieser Zeit beschäftigten sich mehr mit mathematischen Berechnungen als mit der klanglichen Empfindung. Außerdem ließ die Einstimmigkeit, die im Altertum und in der Gregorianische Epoche vorherrschte, die Unreinheiten dieser Stimmung nicht so deutlich hervortreten, denn das Nacheinander der Intervalle ist für das Ohr als Missklang nicht so störend, wie das miteinander der gleichen Töne.[5]
Etwa zweitausend Jahre genügte die Pythagoreische Stimmung der Musikausübung. Nicht zuletzt wegen der damals gebräuchlichen Instrumente. Es wurden fast ausschließlich, neben der menschlichen Stimme Blas-, Zupf- und Streichinstrumente benutzt, die alle in ihrer Intonation nicht festgelegt, sondern anpassungsfähig und innerhalb einer Tonfolge in gewissen Grenzen variabel waren. Erst die wachsende Bedeutung der Tasteninstrumente im Mittelalter, die aufblühende Mehrstimmigkeit als auch die Lust an Klangfarben und Harmonien führten zu der notwendigen Neuordnung in der Stimmung.
In der Renaissance gab es vor allem zwei für das Tonsystem wichtige Entwicklungen: Die zunehmende Chromatik in der Vokalpolyphonieerweiterte den Tonvorrat endgültig auf zwölf Töne.[6] Außerdem veränderte sich das Dissonanzempfinden. Die Terz, im Mittelalter noch als dissonant eingestuft, wurde zusammen mit der Sexte (im Verhältnis 8:5) zunächst noch als imperfekte Konsonanz aufgefasst, bis sie zunehmend als harmonietragender Bestandteil des Dreiklanges im entstehenden Dur-Moll-System an musikalischer Bedeutung gewann.[7] Die neue Orientierung an der Terz und der Bedarf einer chromatischen Tonleiter führten zu Problemen mit der quintbasierten pythagoreischen Stimmung.[8]
2.2. Die Mitteltönige Stimmung
Ab der ars nova, also ab dem 14. Jahrhundert wurden weitere Bestrebungen verfolgt, die vorhandenen Temperaturprobleme zu lösen. So beschäftigten sich Musiker, Theoretiker und Instrumentenbauer mit dem Problem der richtigen Temperatur und es gab Versuche und Meinungsverschiedenheiten vielfältigster Art. „Die Theorie der mitteltönigen Stimmung erforderte die mathematische Berechnung quan-titativer Nuancen, die jenseits dessen lagen, was die Theoretiker des 15. Jahrhunderts gewohnt waren, und so hinkte sie um etwa hundert Jahre hinter der Praxis her.“[9]
Nur sehr allmählich erkannten Theoretiker mit einer gewissen humanistischen Bildung, dass die kritischen Größen beim temperierten Stimmen Bruchteile eines Kommas waren. Die ersten mathematischen Leitermodelle, waren aber durch die mathematischen Intervallverhältnisse praktisch nicht umsetzbar - wie die von Fogliano oder Bermudo - oder aber fehlerhaft. So war sich der Theoretiker Zarlino im Jahr 1558 sicher, dass die großen Terzen auf Tasteninstrumenten eher kleiner als rein gestimmt würden, während sie in Wirklichkeit aber ein wenig größer als rein waren wie bei Arnold Schlick oder Lanfranco.[10]
Das brauchbarste und von nun an etwa 200 Jahre lang geltende System führte Arnold Schlick um etwa 1500 ein. Es war die mitteltönige Stimmung, die bereits eine temperierte, ausgleichende war. Seine besondere Sorgfalt wandte Schlick auf die Terz, die bisher verständlicherweise als dissonant gegolten hatte.
Mit vier reinen Quinten erreicht man die übergroße pythagoreische Terz, die etwa um 1/5 Halbton größer ist als die reine naturgegebene Terz.[11] Diese Differenz nennt man das "syntonische Komma" (etwa 21 ½ Cents). Schlick verteilte diesen Fehler auf vier entsprechend reduzierte Quinten (um 5 ½ Cents kleiner als reine Quinten). Er ließ sie, wie er selbst schrieb „[…] etwas in die niedere schweben, so vil das gehör leyden mag.“[12] Entsprechend der um ein Viertel syntonisches Komma zu kleinen Quinte ist umgekehrt die Quarte um ein solches zu groß. Mit seinen vier um einige Schwebungen zu eng gestimmten Quinten erreichte Schlick die reine naturgegebene große Terz, die er als Tonartbildende und ästhetisch wohltuende Konsonanz erkannte.[13] Die Bezeichnung „mitteltönig“ entstammte den Umständen, dass der zwischen einer reinen Terz und Prim liegende Ton optisch und mathematisch die Mitte bildet, was bei anderen Stimmungen nicht der Fall ist.
Durch die reine Großterz war natürlich auch die reine kleine Sexte bestimmt. Die reine Großterz lässt sich auch aus der Obertonreihe ableiten (s. S. 3) und bildet somit eine wichtige naturgegebene Harmoniebildende Instanz.[14] Die kleine Terz hingegen ist wegen der reduzierten Quinten ebenfalls um ein Viertel Komma zu klein, während die große Sexte um jenes zu groß ist. Durch die Folge von elf mitteltönigen Quinten erhält man die zwölf Töne unseres abendländischen Tonsystems.
Arnold Schlicks Anweisung zur unregelmäßigen Temperierung war leider kaum einem Leser verständlich, der nicht seine Stimm-Erfahrung hatte. Schlick verzichtete nämlich in seiner Stimmanweisung für Tasteninstrumente vollkommen auf mathematische Berechnungen, so war es vor allem den italienischen und spanischen Theoretikern und Musikern nicht möglich, sich mit diesem Stimmverfahren auseinanderzusetzen. Das war auch der Grund, weshalb die mitteltönige Stimmung erst langsam in der Musikpraktik anerkannt und benutzt wurde.
Auch die mitteltönige Stimmung hatte genau wie die pythagoreische ihre Unzulänglichkeiten. So ließ sich das mitteltönige System auch nicht ganz schließen, denn zwei reine Terzen von C aus aufwärts führen zum Gis (772,6 Cents), eine reine Terz von C aus abwärts führt zum As (813,6 Cents). Zwischen Gis und As bleibt eine Differenz von einer kleinen Diesis (etwa 41,06 Cents oder ca. 2/5 Halbton), deswegen musste man sich beim Stimmen für einen von den beiden Tönen entscheiden. Aber nicht nur Gis und As, sondern fast alle Tasten sind doppelwertig und so war es nicht möglich ein Tasteninstrument für alle Tonarten gleichmäßig sauber zu stimmen.[15]
Diesen Unterschied auf sämtliche zwölf Quinten zu verteilen, hätte für die Praxis völlig unbrauchbare Werte ergeben. So hat sich Schlick entschieden, in den kritischen Regionen des Quintenzirkels die Mitte zwischen Gis und As zu bestimmen, nämlich 793,15 Cents. Dies führte dazu, dass die Quinten Cis-Gis und As-Es um 15 Cents zu groß sind und die dadurch verursachten starken Schwebungen die Quinten sehr rauh und dissonant klingen.
[...]
[1] Dupont, W.: Geschichte der musikalischen Temperatur, Nördlingen 1935, S. 2.
[2] Wobei nur die siebentönige diatonische Skala im nach hinein genutzt wurde.
[3] Bei 1200 Cent ist die reine Oktave erreicht.
[4] Vgl. Abb. I, S. 25.
[5] Dupont, W.: Geschichte der musikalischen Temperatur, S. 19.
[6] Fauxbourdon, Madrigale etc.
[7] Dupont, W.: Geschichte der musikalischen Temperatur, S. 19.
[8] Oder auch der reinen natürlich-harmonischen Stimmung.
[9] Lindley, M.: Stimmung und Temperatur, In: Dahlhaus, C.: Hören, Messen und Rechnen in der frühen Neuzeit, In: Zaminer, F. (Hrsg.): Geschichte der Musiktheorie, Band 6, Darmstadt 1987, S. 130.
[10] Lindley, M.: Stimmung und Temperatur, S. 157.
[11] Hörbeispiel: Nr. 1 Terzen: pythagoreisch – mitteltönig.
[12] Dupont, W.: Geschichte der musikalischen Temperatur, S. 26.
[13] Dupont, W.: Geschichte der musikalischen Temperatur, S. 26, vgl. Anm. 2: Reine Quinte = 701,955 Cent - ein Viertel syntonisches Komma = 5.377 Cent ergibt die temperierte Quinte nach Schlick = 696,578 Cent.
[14] Hörbeispiel: Nr. 2 Dreiklänge: pythagoreisch – mitteltönig.
[15] Zwar gab es Versuche von Tasteninstrumenten mit doppelwertigen Tasten, aber die Kompliziertheit der Konstruktion und die Schwerfälligkeit des praktischen Musizierens ließen die Entwicklung scheitern (vgl. Abb. Nr. II, S. 25).
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen pythagoreischer und mitteltöniger Stimmung?
Die pythagoreische Stimmung basiert auf reinen Quinten, was zu unsauberen Terzen führt. Die mitteltönige Stimmung korrigiert dies durch Verkleinerung der Quinten, um reinere Terzen zu ermöglichen.
Was bedeutet "wohltemperierte Stimmung"?
Es ist ein Sammelbegriff für Stimmsysteme, die es ermöglichen, in allen Tonarten zu spielen, ohne dass einige Intervalle unerträglich dissonant klingen.
Welche Stimmtonhöhen nutzte Johann Sebastian Bach?
Bach war mit unterschiedlichen Stimmtonhöhen konfrontiert, etwa dem Chorton (höher) und dem Kammerton (tiefer). Je nach Wirkungsstätte (Weimar, Köthen, Leipzig) musste er seine Werke an diese Gegebenheiten anpassen.
Was ist das "pythagoreische Komma"?
Es ist die mathematische Differenz, die entsteht, wenn man zwölf reine Quinten schichtet. Das Ergebnis ist etwas höher als sieben Oktaven, was die Schließung des Quintenzirkels erschwert.
Welche Temperatur nutzte Bach für sein "Wohltemperiertes Klavier"?
Es gibt keinen exakten wissenschaftlichen Beweis für eine spezifische Stimmung. Forscher spekulieren über verschiedene ungleichschwebende Temperaturen, die Bach bevorzugt haben könnte.
- Quote paper
- Jacek Brzozowski (Author), 2008, Die Entwicklung der Stimmsysteme bis zu J.S Bachs Epoche und die Erfassung der Stimmtonhöhe von J.S. Bach in Weimar, Köthen und Leipzig, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137186