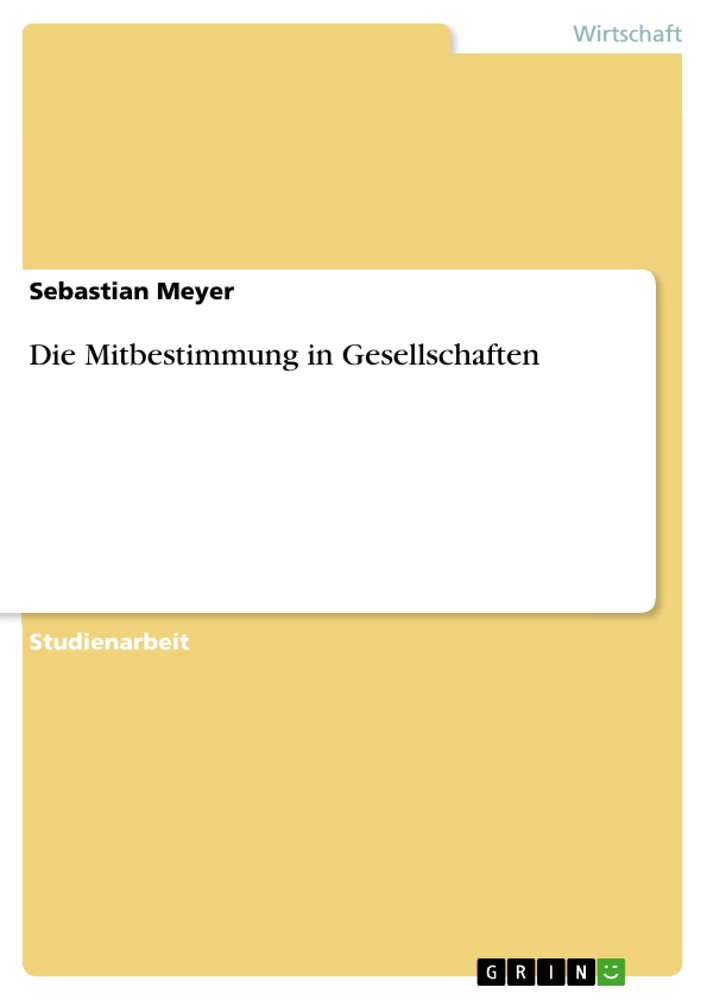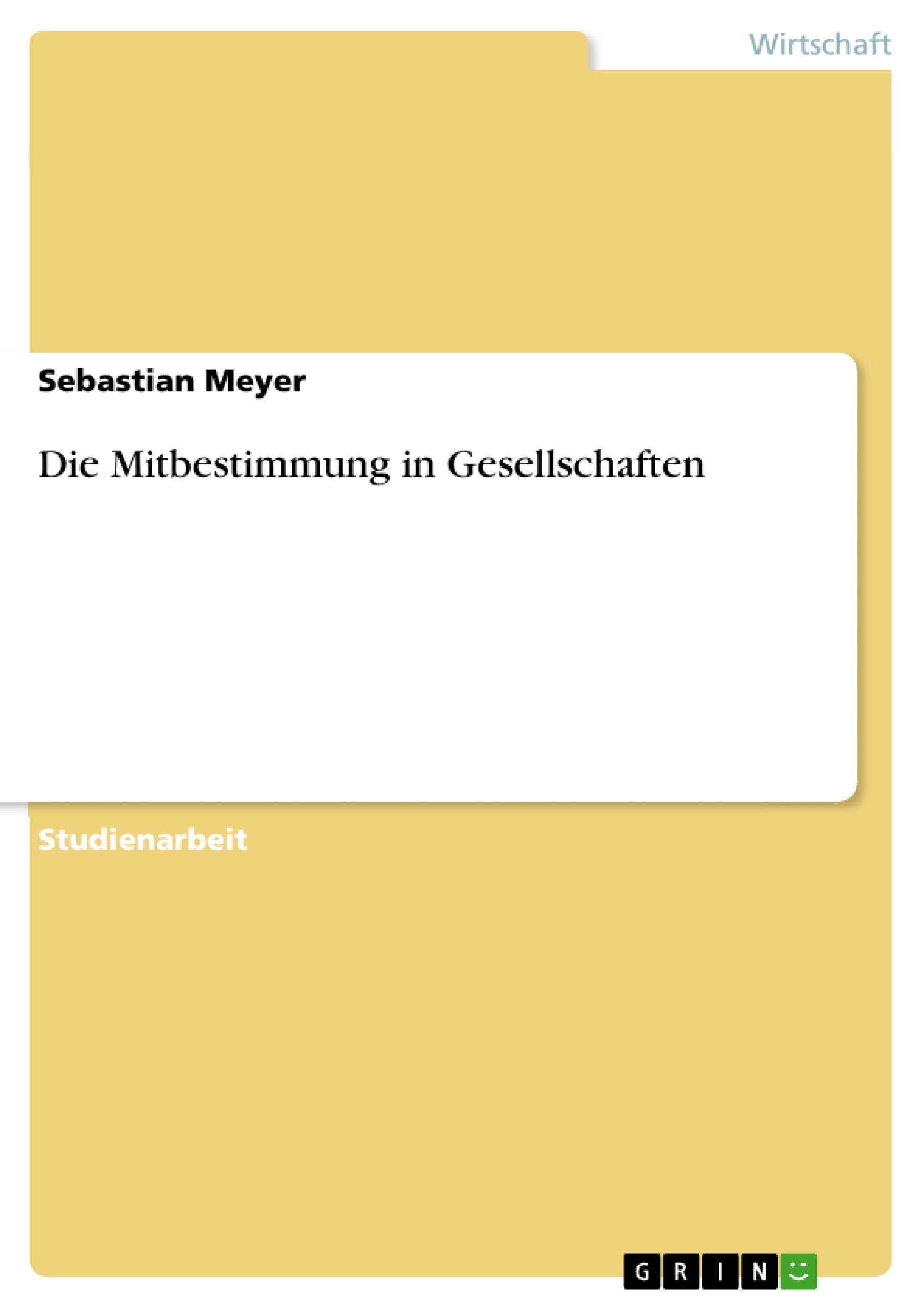Vom unmündigen Proletarier zum modernen Beschäftigten – die Mitbestimmung in Deutschland blickt auf eine lange Entwicklungsgeschichte zurück. 1945 setzten sich die Gewerkschaften für den Aufbau und die Festigung einer demokratischen und freiheitlichen Staats- und Gesellschaftsordnung ein. Bereits im Jahre 1951 wurde das Montan-MitbestG ins Leben gerufen. Einige Jahre später wurden weitere Gesetze wie das BetrVG, das MitbestG und das DrittelbG erlassen. Die betriebliche Mitbestimmung garantiert, dass die Arbeitnehmer an den personellen, sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen für die unternehmerische Tätigkeit aktiv mitwirken können, und dadurch auch für die Folgen mitverantwortlich sind. Die Interessen der gesamten Belegschaft werden über den Betriebsrat vertreten. Auf der Unternehmensebene kann die Belegschaft an der Leitung des Unternehmens in der Form teilnehmen, dass Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat entsendet werden. Aus gewerkschaftlicher und somit aus Arbeitnehmersicht stellt die Mitbestimmung eine Verbesserung des Betriebsklimas dar, die auch die Motivation der Arbeitnehmer fördert. Die Mitbestimmung erleichtert die Unternehmensführung und trägt dafür Sorge, dass die vom Management getroffenen Entscheidungen eine höhere Akzeptanz in der Belegschaft finden. Sie unterstützt und schafft die Voraussetzungen für eine demokratische Kontrolle wirtschaftlicher Macht und schränkt den Missbrauch und die Ausbeutung der Arbeitnehmer durch die Arbeitgeber ein. Die Mitbestimmung stellt somit die grundlegenden Faktoren für den Erfolg des deutschen Wirtschafts und Sozialsystems dar. Sie trägt weiterhin dazu bei, die Transaktionskosten in einem Unternehmen zu vermindern, da zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer keine individuellen Verhandlungen geführt werden müssen, sondern diese durch die Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten und durch den Betriebsrat getroffen werden.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Symbolverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Mitbestimmung in Deutschland
1.1 Grundstruktur der Mitbestimmung
1.2 Betriebliche Mitbestimmung
1.2.1 Betriebsverfassungsgesetz
1.2.2 Allgemeine Vorschriften
1.2.3 Der Betriebsrat
1.2.4 Die Rechte des Betriebsrates
1.2.4.1 Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer – Soziale Angelegenheiten
1.2.4.2 Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer – Gestaltung von Arbeitsplatz, Arbeitsablauf und Arbeitsumgebung
1.2.4.3 Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer – Personelle Angelegenheiten
1.2.4.4 Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer – Wirtschaftliche Angelegenheiten
1.3 Unternehmerische Mitbestimmung
1.3.1 Montan-Mitbestimmungsgesetz
1.3.1.1 Anwendungsbereich
1.3.1.2 Der Aufsichtsrat – Zusammensetzung und Wahl
1.3.1.3 Aufgaben und Rechtsstellung des Aufsichtsrates
1.3.1.4 Der Arbeitsdirektor
1.3.2 Mitbestimmungsgesetz
1.3.2.1 Anwendungsbereich
1.3.2.2 Der Aufsichtsrat – Zusammensetzung und Wahl
1.3.2.3 Aufgaben und Rechtsstellung des Aufsichtsrates
1.3.2.4 Der Arbeitsdirektor
1.3.3 Drittelbeteiligungsgesetz
1.3.3.1 Anwendungsbereich
1.3.3.2 Der Aufsichtsrat – Zusammensetzung und Wahl
2 Mitbestimmung am Beispiel einer Aktiengesellschaft
2.1 Die Unternehmensorgane einer Aktiengesellschaft
2.2 Die Hauptversammlung als beschlussfassendes Organ
2.3 Der Aufsichtsrat als überwachendes und mitbestimmendes Organ
2.4 Der Vorstand als leitendes und ausführendes Organ
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Symbolverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Gesetzliche Grundlagen der betrieblichen und unternehmerischen Mitbestimmung
Abbildung 2: Das Mitbestimmungssystem in Deutschland
Abbildung 3: Zeitliche Entwicklung der Mitbestimmung in der Bundesrepublik Deutschland
Abbildung 4: Mitbestimmung nach dem Montan-Mitbestimmungsgesetz bei einem 11-köpfigen Aufsichtsrat
Abbildung 5: Mitbestimmung nach dem Mitbestimmungsgesetz bei einem Unternehmen mit mehr als 20.000 Arbeitnehmern
Abbildung 6: Mitbestimmung nach dem Drittelbeteiligungsgesetz
Abbildung 7: Verhältnis der Organe einer Aktiengesellschaft
1 Mitbestimmung in Deutschland
1.1 Grundstruktur der Mitbestimmung
Unter dem Begriff der Mitbestimmung sind alle gesetzlichen Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu verstehen, um die Arbeitswelt mitzugestalten und somit am Willensbildungsprozess im Unternehmen teilzunehmen.[1] Das umfasst sowohl gesetzlich verankerte Mitbestimmungsrechte als auch in Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen ausgehandelte Regelungen sowie in der Mitbestimmungspraxis gewachsene informelle Gestaltungsmöglichkeiten. Dabei wird zwischen der betrieblichen und der unternehmerischen Mitbestimmung unterschieden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Gesetzliche Grundlagen der betrieblichen und unternehmerischen Mitbestimmung
Quelle: Eigene Darstellung
Mitbestimmung auf Unternehmensebene ist die Teilhabe der Belegschaft an der Leitung des Unternehmens durch Wahl von Arbeitnehmervertretern in die Aufsichtsgremien. Die unternehmerische Mitbestimmung wird gekennzeichnet durch eine unmittelbare Einflussnahme auf die unternehmerischen Planungs-, Leitungs- und Organisationsentscheidungen.[2] Hierdurch sollen die Interessen der Arbeitnehmer stärker berücksichtigt und zusammen mit den Vertretern der Anteilseigner die Unternehmenspolitik unter anderem durch den Einbezug von sozialen Belangen innerhalb der wirtschaftlichen Entscheidungen des Managements stärker ausgerichtet werden.
Die betriebliche Mitbestimmung bezweckt die Mitwirkung der „Arbeitnehmer bzw. des Betriebsrates lediglich an den personellen, sozialen und wirtschaftlichen Folgeproblemen, die sich aus unternehmerischen Planungs-, Leitungs- und Organisationsentscheidungen ergeben.“[3]
Anhand der nachfolgenden Abbildung wird die Grundstruktur der Mitbestimmung verdeutlicht:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Das Mitbestimmungssystem in Deutschland
Quelle: In Anlehnung an die Gesetze zur Mitbestimmung
Entsprechend der Arbeitnehmerzahl, der Gesellschaftsform und dem Unternehmenszweck greifen unterschiedliche Mitbestimmungsgesetze. Die Bundesrepublik Deutschland ist im internationalen Vergleich ein Land, das die meisten Mitbestimmungsgesetze und -regeln aufweist.[4] Die Regelungen zur Mitbestimmung finden sich in den folgenden Gesetzen: dem Montan-Mitbestimmungsgesetz, dem Montan-Mitbestimmungsergänzungsgesetz, dem Mitbestimmungsgesetz, dem Betriebsverfassungsgesetz und dem Drittelbeteiligungsgesetz.[5] Die historische Entwicklung der Mitbestimmung in der Bundesrepublik Deutschland wird durch die nachfolgende Abbildung graphisch dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Zeitliche Entwicklung der Mitbestimmung in der Bundesrepublik Deutschland
Quelle: Eigene Darstellung anhand der genannten Gesetze
1.2 Betriebliche Mitbestimmung
1.2.1 Betriebsverfassungsgesetz
Die Rechte des Betriebsrates werden im BetrVG[6] geregelt. Die Einzelheiten der Betriebsratswahlen bestimmen zudem eine Wahlordnung. Aus dem Kündigungsschutzgesetz oder dem Arbeitsgerichtsgesetz ergeben sich weitere Rechte für den Betriebsrat. Ganz vom Geltungsbereich des BetrVG ausgeschlossen sind die Verwaltungen des Bundes, der Länder, der Gemeinden und sonstige Institutionen des öffentlichen Rechts. Hier finden das Personalvertretungsgesetz des Bundes[7] beziehungsweise die einzelnen Landespersonalvertretungsgesetze[8] Anwendung.
1.2.2 Allgemeine Vorschriften
Das Organ zur Vertretung der Arbeitnehmerinteressen in den Unternehmen ist der Betriebsrat. Dieser kann gebildet werden, wenn in einem Betrieb mindestens fünf ständig wahlberechtigte Arbeitnehmer, von denen drei wählbar sein müssen, tätig sind. Dies trifft auch für gemeinsame Betriebe mehrerer Unternehmen zu (§ 1 BetrVG). Die Vertreter des Betriebsrates und der Arbeitgeber sollen auf Grundlage der geltenden Tarifverträge vertrauensvoll zusammenarbeiten (§ 2 (1) BetrVG).
Arbeiter und Angestellte einschließlich der zur Berufsausbildung Beschäftigten stellen Arbeitnehmer im Sinne des BetrVG dar. Hierbei ist es bedeutungslos, ob sie im Außendienst, im Betrieb oder per Telearbeit ihre dienstliche Tätigkeit betreiben
(§ 5 (1) BetrVG). Das BetrVG findet gemäß § 5 (3) BetrVG keine Anwendung auf leitende Angestellte, falls nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Ebenso findet das Gesetz keine Anwendung auf die in § 5 (2) BetrVG genannten Arbeitnehmer.
1.2.3 Der Betriebsrat
Eine der wichtigsten Aufgaben des Betriebsrats ist es, darüber zu wachen, dass die zugunsten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erlassenen Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen eingehalten werden. Außerdem hat er die Interessen der Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber zu vertreten sowie Anregungen aus der Belegschaft zu prüfen und an den Arbeitgeber weiterzuleiten.
Die regelmäßigen Betriebsratswahlen finden alle vier Jahre in der Zeit vom 01.03. bis 31.05. des jeweiligen Jahres statt (§ 13 (1) S. 1 BetrVG). Wahlberechtigt sind alle Arbeitnehmer des Betriebs, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Dabei ist es ohne Bedeutung, wo die dienstliche Tätigkeit verrichtet wird. Ebenso sind durch Dritte überlassene Arbeitnehmer wahlberechtigt, wenn sie länger als drei Monate im Betrieb eingesetzt werden (§ 7 BetrVG). Die Wahlberechtigten, die länger als 6 Monate dem Betrieb angehören oder als in Heimarbeit Beschäftigte sind wählbar (§ 8 BetrVG). Die Zahl der Betriebsratsmitglieder wird gemäß § 9 BetrVG entsprechend der Zahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer bestimmt.
1.2.4 Die Rechte des Betriebsrates
Der Betriebsrat besitzt eine Reihe von Rechten. Dabei ist zwischen Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechten zu unterscheiden. Als Mitwirkungsrechte im Sinne des BetrVG sind das Informations-, Vorschlags-, Anhörungs- und Beratungsrecht zu verstehen. Initiativ- und Zustimmungsverweigerungsrechte werden durch das Mitbestimmungsrecht charakterisiert.[9]
Unter den Mitwirkungsrechten besitzt das Informationsrecht[10] die schwächste Form der Mitwirkung. Der Arbeitgeber hat z. B. den Betriebsrat über beabsichtigte Pläne zu informieren, auf deren Grundlage der Betriebsrat dann weitere Rechte anmelden kann. Vorschläge des Betriebsrates, die im Rahmen des Vorschlagsrechts[11] wahrgenommen werden, muss der Arbeitgeber lediglich zur Kenntnis nehmen. Zudem kann der Betriebsrat dieses Vorschlagsrecht nur in begrenzten Fällen nutzen.
Um Entscheidungen des Arbeitgebers zu blockieren, kann der Betriebsrat sein Anhörungsrecht[12] geltend machen, wenn der Arbeitgeber zuvor die Meinung des Betriebsrates nicht eingeholt hat. Beratungsrechte sehen vor, dass der Arbeitgeber eine Meinung des Betriebsrates einzuholen hat, und somit zwischen dem Arbeitgeber und dem Betriebsrat ein Meinungsaustausch zustande kommt.
Als gleichberechtigtes Mitglied ist der Betriebsrat gegenüber dem Arbeitgeber nur bei den Mitbestimmungsrechten zu sehen. Im Rahmen einer vollen Mitbestimmung muss den vom Arbeitgeber getroffenen Entscheidungen durch den Betriebsrat zugestimmt werden. Entscheidungen, die vom Betriebsrat herbeigeführt und auch durchgesetzt werden können, werden als Initiativrechte bezeichnet (z. B. in sozialen Angelegenheiten). Mittels des Zustimmungsverweigerungsrechts können die vom Arbeitgeber getroffenen Entscheidungen blockiert werden. Dies kann insbesondere der Fall bei personellen Maßnahmen sein (z. B. Einstellung, Umgruppierung). Sollte der Arbeitgeber seine getroffene Entscheidung nicht durchsetzen können, so kann diese personelle Maßnahme nur vom Arbeitsgericht durchgesetzt werden.[13]
1.2.4.1 Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer – Soziale Angelegenheiten
Entsprechend der Mitwirkung und Mitbestimmung von Arbeitnehmern umfasst das BetrVG eine Reihe von Mitbestimmungsregeln betreffend die sozialen Angelegenheiten eines Unternehmens, welche in § 87 BetrVG geregelt werden (soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht). Ausschnittsweise sind folgende Mitbestimmungsrechte zu nennen:
[...]
[1] Vgl. Niedenhoff, S. 11.
[2] Vgl. Klinkhammer / Welslau, Rdn. 37-40.
[3] Klinkhammer / Welslau, Rdn. 170.
[4] Vgl. Niedenhoff, S. 9.
[5] In der Praxis greifen weitere Gesetze, z. B. das Ergänzungsgesetz zum Montan-MitbestG, auf die nicht näher eingegangen wird, da zunächst ein umfassender Überblick über die wichtigsten Gesetze der Mitbestimmung erfolgen soll.
[6] Betriebsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.09.2001, zuletzt geändert durch Artikel 221 Neunte ZuständigkeitsanpassungsVO vom 31.10.2006.
[7] Vgl. Altvater / Hamer / Ohnesorg.
[8] Vgl. Welkoborsky.
[9] Vgl. Niedenhoff, S. 13.
[10] Vgl. von Hoyningen-Huene, S. 228.
[11] Vgl. von Hoyningen-Huene, S. 193.
[12] Vgl. von Hoyningen-Huene, S. 191.
[13] Vgl. von Hoyningen-Huene, S. 192-194.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen betrieblicher und unternehmerischer Mitbestimmung?
Betriebliche Mitbestimmung erfolgt über den Betriebsrat und betrifft soziale, personelle und wirtschaftliche Angelegenheiten im Betrieb. Unternehmerische Mitbestimmung bedeutet die Teilhabe der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat des Unternehmens.
Was regelt das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)?
Das BetrVG regelt die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat sowie dessen Rechte auf Information, Anhörung, Beratung und echte Mitbestimmung in sozialen Belangen.
Was ist das Montan-Mitbestimmungsgesetz?
Es ist das weitreichendste Mitbestimmungsgesetz in Deutschland und gilt für Unternehmen des Bergbaus sowie der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie. Es sieht eine paritätische Besetzung des Aufsichtsrats vor.
Wann findet das Drittelbeteiligungsgesetz Anwendung?
Es gilt für Unternehmen mit in der Regel mehr als 500, aber weniger als 2.000 Arbeitnehmern. Hier muss der Aufsichtsrat zu einem Drittel aus Arbeitnehmervertretern bestehen.
Welche Vorteile bietet die Mitbestimmung für ein Unternehmen?
Sie fördert die Akzeptanz von Entscheidungen, verbessert das Betriebsklima, reduziert Transaktionskosten durch kollektive Verhandlungen und stärkt die Motivation der Mitarbeiter.
- Citar trabajo
- Dipl.-Kfm. (FH) Sebastian Meyer (Autor), 2007, Die Mitbestimmung in Gesellschaften, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137447