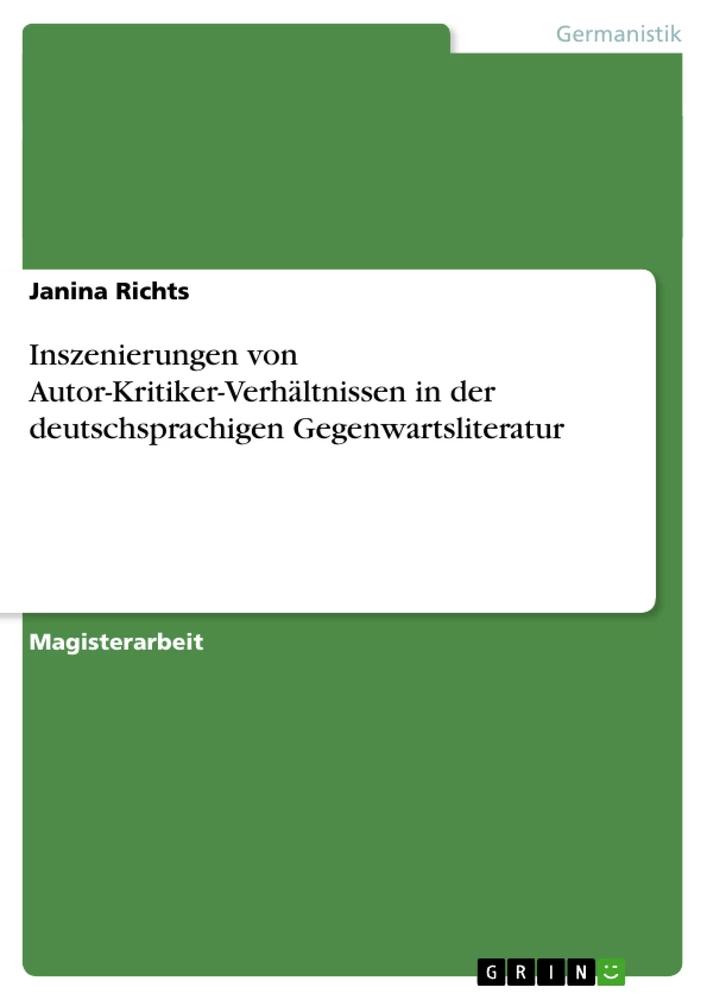Schon zu Goethes Zeiten waren die Beurteilungen von Rezensenten etwas, das die Autorengemüter zum Brodeln brachte und sie dazu trieb, immer wieder abschätzige Bemerkungen über den Berufsstand des Kritikers in ihre literarischen Werke einfließen zu lassen. Doch in letzter Zeit scheinen sich Werke zu häufen, in denen Schriftsteller die Wut gegenüber ihren Rezensenten zum Ausdruck bringen. Es stellt sich die Frage nach dem Grund für die insbesondere seit der Jahrtausendwende in großer Vielzahl erschienenen Satiren, die die Beziehung von Schriftstellern und Literaturkritikern zum Thema machen.
Ziel dieser Arbeit ist es, die unterschiedlichen Formen herauszustellen und zu analysieren, in denen sich das angespannte Autor-Kritiker-Verhältnis in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur darstellt. Gerade Satiren erweisen sich als beliebtes Ausdrucksmittel dieses Verhältnisses. Unweigerlich fragt man sich, warum gerade Ironie eine so bedeutende Rolle in diesen Werken spielt und welche Funktion sie jeweils einnimmt. Daher werden einleitend Begriffsbestimmungen und Ausprägungen der Ironie vorgestellt, um mit dieser theoretischen Grundlage eine fundierte Analyse zu ermöglichen.
Zu Werken, die in ihrer Gesamterscheinung als Satire oder Parodie auf Literaturkritiker oder auf das Verhältnis der Schriftsteller zu ihnen gelten können, gehören Martin Walsers "Tod eines Kritikers", Norbert Gstreins "Selbstportrait mit einer Toten" und der Dialogroman "Das Wetter vor 15 Jahren" von Wolf Haas; außerdem "Belles Lettres" von Charles Simmons, der zwar nicht deutschsprachig ist, sich aber als Bereicherung für diese Untersuchung erweist, weil ausschließlich er dem Leser einen Blick aus der Perspektive der Literaturkritiker ermöglicht. Eine untergeordnetere Rolle spielt die Beziehung von Autoren und Kritikern in folgenden Werken: "Der Kommunist vom Montmartre" von Michael Kleeberg, "Ensel und Krete" von Walter Moers, dem Kinderbuch "Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch" von Michael Ende, "Bestseller" von Klaus Modick sowie "Das bin doch ich" von Thomas Glavinic.
Da die unterschiedlichen Blickwinkel der Erzähler auf das Geschehen andere Wahrnehmungen des Autor-Kritiker-Verhältnisses implizieren, bedarf es einer differenzierten Betrachtung der jeweiligen Erzählerperspektive. Erzähltheoretische Untersuchungen fließen immer wieder in die Untersuchung der Romane ein, sofern sie der Analyse der spezifischen Erzählsituationen zuträglich sind.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Historischer und gesellschaftlicher Kontext
- 2. Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- II. Formen literarischer Ironie
- 1. Das indirekte Wesen der Ironie
- 1.1 Beschreibungsversuche
- 1.2 Ironie und Realität - Die problematische Identität des Ironikers
- 2. Ironie als Mittel der Satire
- 3. Die Parodie
- 4. Zusammenfassung
- III. Inszenierungen von Autor-Kritiker-Beziehungen
- 1. Der autodiegetische Ich-Erzähler: Voreingenommenheit und eingeschränkte Perspektive
- 1.1 Klaus Modick - Bestseller
- 1.2 Thomas Glavinic - Das bin doch ich
- 1.3 Fazit
- 2. Der Erzähler als Nebenfigur: Distanz und Nähe
- 2.1 Charles Simmons - Belles Lettres
- 2.2 Fazit
- 3. Der Erzähler als Beobachter: die kommentierende Außensicht
- 3.1 Martin Walser - Tod eines Kritikers
- 3.2 Norbert Gstrein - Selbstportrait mit einer Toten
- 3.4 Fazit
- 4. Der heterodiegetische Erzähler: die Möglichkeit der ironischen Distanz
- 4.1 Michael Kleeberg - Literatur
- 4.2 Michael Ende - Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch
- 4.3 Walter Moers - Ensel und Krete
- 4.4 Fazit
- 5. Der erzählerlose Roman: der dramatische Modus
- 5.1 Wolf Haas - Das Wetter vor 15 Jahren
- 5.2 Fazit
- IV. Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Darstellung von Autor-Kritiker-Beziehungen in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Ziel ist es, verschiedene Inszenierungsformen dieser Beziehungen zu analysieren und die zugrundeliegenden Konflikte und Strategien der Autoren aufzuzeigen.
- Die historische Entwicklung des Verhältnisses zwischen Autoren und Kritikern
- Die Rolle der Ironie in der Darstellung der Autor-Kritiker-Dynamik
- Die verschiedenen Erzählperspektiven und ihre Auswirkungen auf die Darstellung des Konflikts
- Die Verwendung von Satire und Parodie zur Kritik am Literaturbetrieb
- Die Auswirkungen der medialen Entwicklungen auf das Autor-Kritiker-Verhältnis
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Dieses einleitende Kapitel beschreibt den historischen und gesellschaftlichen Kontext der Arbeit, indem es den Wandel des Literaturbetriebs und die zunehmende Bedeutung der Literaturkritik, insbesondere durch die Verbreitung in Massenmedien, beleuchtet. Es wird die verstärkte Auseinandersetzung von Autoren mit Kritikern in der Gegenwartsliteratur als Reaktion auf diese Entwicklungen hervorgehoben, die in zahlreichen Satiren ihren Ausdruck findet. Die Arbeit fokussiert sich auf die Analyse verschiedener Inszenierungsformen dieser Beziehungen in ausgewählten Werken der Gegenwartsliteratur.
II. Formen literarischer Ironie: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Formen literarischer Ironie, die in der Darstellung von Autor-Kritiker-Beziehungen eine zentrale Rolle spielen. Es werden theoretische Ansätze zur Beschreibung von Ironie erörtert, die Funktion von Ironie als Mittel der Satire untersucht und die spezifischen Merkmale der Parodie im Kontext der Autor-Kritiker-Beziehung herausgearbeitet. Das Kapitel legt die Grundlage für die Analyse der literarischen Texte im Hauptteil der Arbeit.
III. Inszenierungen von Autor-Kritiker-Beziehungen: Der Hauptteil der Arbeit analysiert verschiedene literarische Texte, indem er die jeweilige Erzählperspektive und deren Einfluss auf die Darstellung des Autor-Kritiker-Verhältnisses untersucht. Es werden die Strategien der Autoren beleuchtet, wie sie die Konflikte, Spannungen und Machtverhältnisse zwischen Autor und Kritiker literarisch inszenieren. Die Analyse umfasst unterschiedliche Erzählertypen und deren jeweilige Möglichkeiten der ironischen Distanzierung, sowie die Verwendung von Satire und Parodie als Mittel der Kritik.
Schlüsselwörter
Autor-Kritiker-Verhältnis, deutschsprachige Gegenwartsliteratur, literarische Ironie, Satire, Parodie, Erzählperspektive, Literaturbetrieb, Medien, Identität, Selbstinszenierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Darstellung von Autor-Kritiker-Beziehungen in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Darstellung von Autor-Kritiker-Beziehungen in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Sie analysiert verschiedene Inszenierungsformen dieser Beziehungen und die zugrundeliegenden Konflikte und Strategien der Autoren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der historischen Entwicklung des Verhältnisses zwischen Autoren und Kritikern, der Rolle der Ironie, verschiedenen Erzählperspektiven und ihren Auswirkungen auf die Darstellung des Konflikts, der Verwendung von Satire und Parodie zur Kritik am Literaturbetrieb sowie den Auswirkungen der medialen Entwicklungen auf das Autor-Kritiker-Verhältnis.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit analysiert ausgewählte literarische Texte der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Die Analyse konzentriert sich auf die jeweilige Erzählperspektive und deren Einfluss auf die Darstellung des Autor-Kritiker-Verhältnisses. Dabei werden die Strategien der Autoren beleuchtet, wie sie Konflikte, Spannungen und Machtverhältnisse zwischen Autor und Kritiker literarisch inszenieren.
Welche Autoren und Werke werden untersucht?
Die Arbeit analysiert Werke von Klaus Modick (Bestseller), Thomas Glavinic (Das bin doch ich), Charles Simmons (Belles Lettres), Martin Walser (Tod eines Kritikers), Norbert Gstrein (Selbstportrait mit einer Toten), Michael Kleeberg (Literatur), Michael Ende (Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch), Walter Moers (Ensel und Krete), und Wolf Haas (Das Wetter vor 15 Jahren). Die Auswahl der Texte dient der Illustration verschiedener Erzählperspektiven und Inszenierungsformen der Autor-Kritiker-Beziehung.
Welche Rolle spielt die Ironie?
Die Arbeit untersucht die verschiedenen Formen literarischer Ironie (indirekte Ironie, Satire, Parodie), die in der Darstellung von Autor-Kritiker-Beziehungen eine zentrale Rolle spielen. Sie analysiert die Funktion von Ironie als Mittel der Satire und die spezifischen Merkmale der Parodie im Kontext der Autor-Kritiker-Beziehung.
Welche Erzählperspektiven werden betrachtet?
Die Analyse umfasst unterschiedliche Erzählertypen: den autodiegetischen Ich-Erzähler, den Erzähler als Nebenfigur, den Erzähler als Beobachter und den heterodiegetischen Erzähler. Die Arbeit untersucht, wie die jeweilige Erzählperspektive die Darstellung des Autor-Kritiker-Verhältnisses beeinflusst und welche Möglichkeiten der ironischen Distanzierung sich daraus ergeben.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Formen literarischer Ironie, ein Hauptteil zur Analyse der Inszenierungen von Autor-Kritiker-Beziehungen in ausgewählten literarischen Texten und einen abschließenden Ergebnisteil. Die Einleitung beschreibt den historischen und gesellschaftlichen Kontext und die Zielsetzung der Arbeit.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
(Der konkrete Inhalt des Ergebnisteils ist in der gegebenen Zusammenfassung nicht detailliert ausgeführt. Die Arbeit kommt zu Schlussfolgerungen über die verschiedenen Inszenierungsformen von Autor-Kritiker-Beziehungen in der Gegenwartsliteratur und ihre Bedeutung im Kontext des sich wandelnden Literaturbetriebs.)
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Autor-Kritiker-Verhältnis, deutschsprachige Gegenwartsliteratur, literarische Ironie, Satire, Parodie, Erzählperspektive, Literaturbetrieb, Medien, Identität, Selbstinszenierung.
- Citation du texte
- Janina Richts (Auteur), 2009, Inszenierungen von Autor-Kritiker-Verhältnissen in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137557