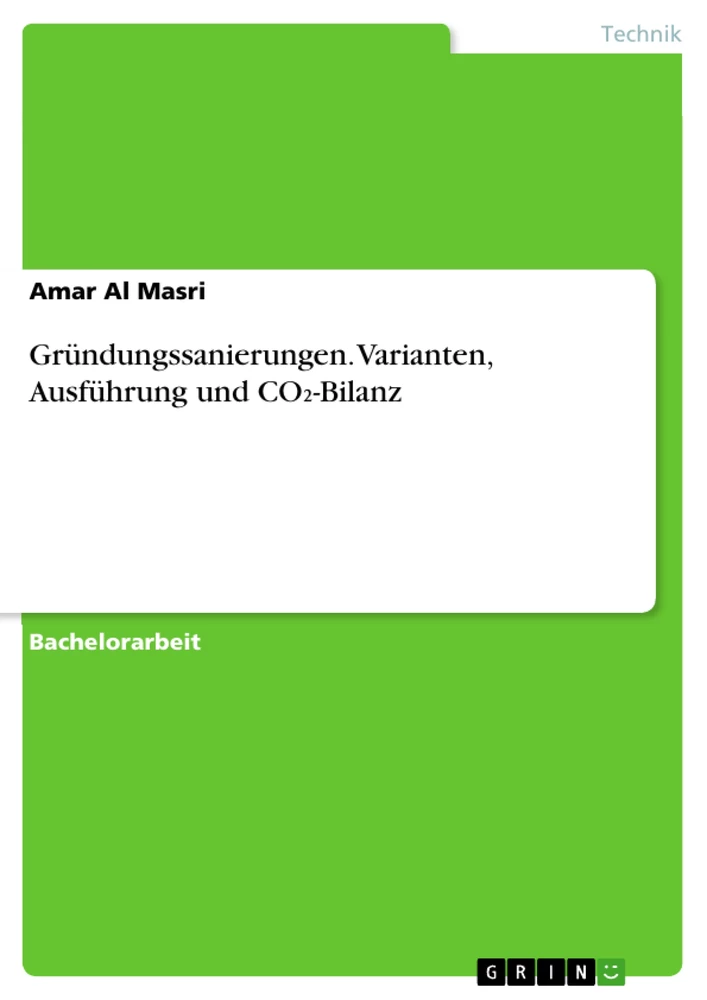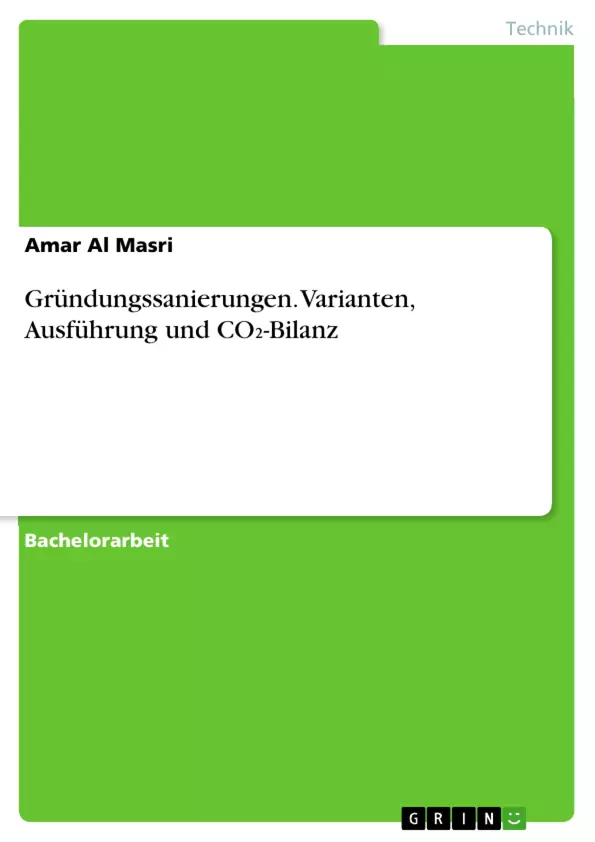Ziel dieser Arbeit ist es, die verschiedenen Arten von Gründungssanierung zu vergleichen, die allgemeinen Vor- und Nachteile darzustellen, einen kalkulatorischen Vergleich für das Beispiel durchzuführen sowie den CO²- Ausstoß für jedes Verfahren zu bemessen.
Wenn Gründungen ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen, sind Setzungen unvermeidlich und Schäden an der aufgehenden Konstruktion die Folge. Diese äußern sich durch Rissbildungen an Wänden und Schiefstellungen von Gebäuden, die zum Verlust der Nutzbarkeit (Gebrauchstauglichkeit) und im schlimmsten Fall zum Verlust der Tragfähigkeit führen können. Um derartige Schäden zu verhindern, ist es zwingend erforderlich, eine Sanierung der potentiell versagenden Fundamente mit geeigneten Verfahren durchzuführen.
Im Rahmen dieser Arbeit wird zunächst ein Blick auf die Gründungsarten geworfen. Anschließend werden die Gründungsschäden und Schadensursachen zusammengefasst und abschließend für ein selbst gewähltes Anwendungsbeispiel ein methodischer Vergleich einiger Sanierungsverfahren durchgeführt. Zudem sind noch ein kalkulatorischer und ökologischer Verfahrensvergleich für dieses Beispiel durchzuführen.
Bei jedem Bauwerk muss stets die Lastabtragung zwischen Gründungsstruktur und Baugrund erfolgen. Durch eine Schädigung der Gründungsstruktur, eine Verschlechterung der Baugrundeigenschaften oder eine Erhöhung der Lasten aus dem Bauwerk entsteht eine Veränderung in der Bauwerk-Baugrund-Interaktion. Demnach ist eine Sanierung der Gründungsstruktur notwendig. Statt das Bauwerk abzureißen, ist es möglich, die nicht mehr tragenden Fundamente mit dem heutigen Stand der Technik zu sanieren. Neben der Baugrundverbesserung ist die Gründungsverstärkung eine gängige Maßnahme, um die Tragfähigkeit zu erhöhen. Neben einer detaillierten Analyse und Klassifizierung der Ursache besteht die Herausforderung auch darin, ein wirtschaftliches und nachhaltiges Verfahren zu finden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Überblick verschiedener Gründungsverfahren
- Allgemein
- Flachgründungen
- Tiefgründungen
- Pfahl-Platten-Gründung
- Gründungsschäden
- Setzungsschäden
- Setzrisse
- Grundbruchschäden
- Schadensursachen
- Setzungsschäden
- Sanierungsverfahren
- Allgemein
- Nachgründung durch Fundamentverbreiterung
- Tieferlegung der Gründungssohle nach DIN 4123
- Unterfangung durch Mikropfähle
- Injektionsverfahren
- Poreninjektion
- Hohlraumverfüllung
- Verdichtungsinjektion
- Hebungsinjektion
- Düsenstrahlverfahren
- Verstärkungsmaßnahmen bei historischen Gebäuden
- Nachhaltiges Bauen
- Nachhaltigkeitsaspekte in Bezug auf Gründungssanierungen
- Ausgewähltes Anwendungsbeispiel
- Vorbemerkungen
- Baugrund und Gründung
- Nachweis der Grundbruchsicherheit
- Mögliche Sanierungsverfahren
- Fundament-Verbreiterung
- Vorgehensweise
- Nachweis für den Grenzzustand der Tragfähigkeit-Grundbruch
- Setzungsberechnung mit geschlossenen Formeln (GZG)
- Fundament-Unterfangung
- Vorgehensweise
- Nachweis für den Grenzzustand der Tragfähigkeit-Grundbruch
- Setzungsberechnung mit geschlossenen Formeln (GZG)
- Baugrundverfestigung durch Injektion (Expansionsharz)
- Vorgehensweise
- Co2-Bilanz
- Beschreibung der Co2-Anteile
- Fundament-Verbreiterung
- Auswertung und Diskussion der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit dem Thema Gründungssanierung. Ziel ist es, verschiedene Arten von Gründungssanierung zu vergleichen, die allgemeinen Vor- und Nachteile darzustellen, einen kalkulatorischen Vergleich für ein selbst gewähltes Anwendungsbeispiel durchzuführen und den CO²-Ausstoß für jedes Verfahren zu bemessen.
- Motivation und Zielstellung
- Theoretische Grundlagen Gründungssanierung
- Nachhaltiges Bauen, ökologische Anforderungen, Carbon Footprint
- Entwurf, Erläuterung und Darstellung des Anwendungsbeispiels
- Methodischer Verfahrensvergleich der für das Anwendungsbeispiel möglichen Sanierungsverfahren
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 - Einleitung: Einführung in das Thema Gründungsschäden und die Notwendigkeit von Sanierungsmaßnahmen.
- Kapitel 2 - Überblick verschiedener Gründungsverfahren: Beschreibung der verschiedenen Arten von Gründungen, wie Flachgründungen, Tiefgründungen und Pfahl-Platten-Gründungen.
- Kapitel 3 - Gründungsschäden: Detaillierte Erläuterung der verschiedenen Gründungsschäden, wie Setzungsschäden und Grundbruchschäden, sowie deren Ursachen.
- Kapitel 4 - Sanierungsverfahren: Vorstellung der gängigsten Sanierungsverfahren für Gründungsschäden, wie Nachgründung durch Fundamentverbreiterung, Tieferlegung der Gründungssohle nach DIN 4123, Unterfangung durch Mikropfähle und verschiedene Injektionsverfahren.
- Kapitel 5 - Nachhaltiges Bauen: Diskussion der Nachhaltigkeit im Bauwesen und der Bedeutung von nachhaltigen Verfahren für die Gründungssanierung.
- Kapitel 6 - Ausgewähltes Anwendungsbeispiel: Detaillierte Beschreibung des Anwendungsbeispiels, des Baugrunds und der vorhandenen Gründung.
- Kapitel 7 - Mögliche Sanierungsverfahren: Vergleich verschiedener Sanierungsverfahren für das Anwendungsbeispiel, inklusive Nachweise der Tragfähigkeit und Setzungsberechnungen.
Schlüsselwörter
Die Bachelorarbeit fokussiert auf die folgenden Schlüsselbegriffe und Schwerpunkte: Gründungssanierung, Gründungsschäden, Sanierungsverfahren, Verfahrensvergleich, Nachhaltiges Bauen, Carbon Footprint, CO2-Bilanz, Baugrundverbesserung, Fundamentverbreiterung, Unterfangung, Injektionsverfahren, Expansionsharz, Anwendungsbeispiel, Tragfähigkeit, Setzungsberechnung.
Häufig gestellte Fragen
Wann ist eine Gründungssanierung zwingend erforderlich?
Eine Sanierung ist nötig, wenn Risse an Wänden oder Schiefstellungen auftreten, die die Gebrauchstauglichkeit oder Tragfähigkeit des Gebäudes gefährden.
Welche Sanierungsverfahren gibt es für Fundamente?
Zu den gängigen Verfahren gehören Fundamentverbreiterung, Tieferlegung nach DIN 4123, Unterfangung mit Mikropfählen und verschiedene Injektionsverfahren (z.B. Expansionsharz).
Was ist der "Carbon Footprint" bei der Gründungssanierung?
Der Carbon Footprint bemisst den CO2-Ausstoß der verschiedenen Sanierungsverfahren, um deren ökologische Nachhaltigkeit zu bewerten.
Was unterscheidet Injektionsverfahren von klassischen Unterfangungen?
Injektionsverfahren verfestigen den Baugrund direkt (z.B. durch Poreninjektion oder Düsenstrahlverfahren), während Unterfangungen die Lastabtragung mechanisch verändern.
Wie werden historische Gebäude bei Gründungsschäden saniert?
Bei historischen Gebäuden kommen oft spezielle Verstärkungsmaßnahmen zum Einsatz, die die Originalsubstanz schonen und gleichzeitig die Tragfähigkeit erhöhen.
- Citar trabajo
- Amar Al Masri (Autor), 2022, Gründungssanierungen. Varianten, Ausführung und CO₂-Bilanz, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1376407