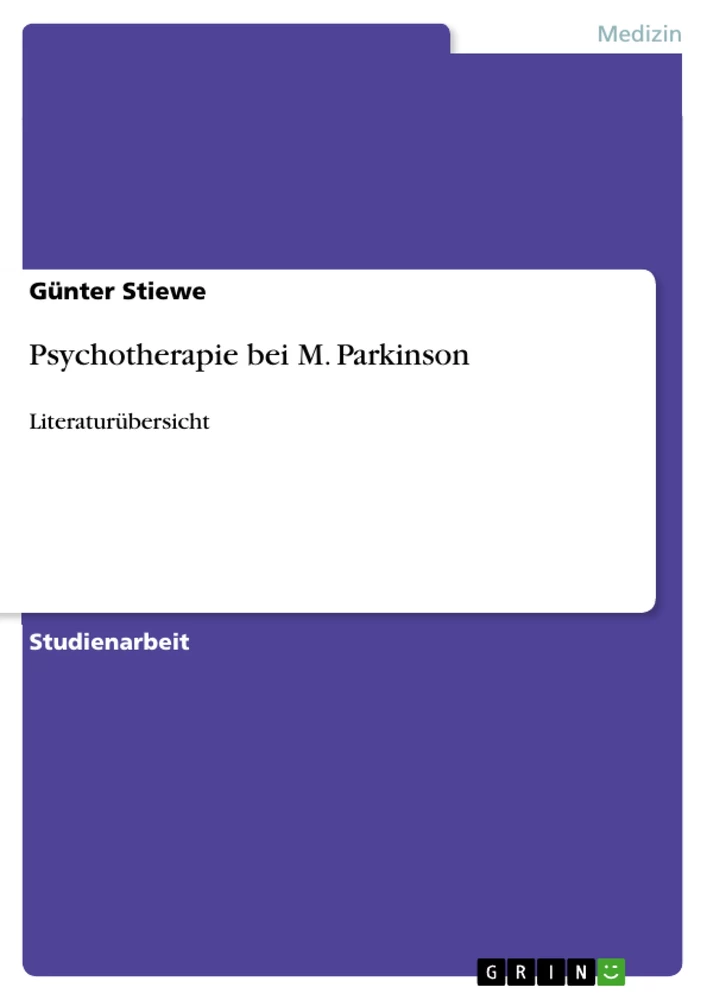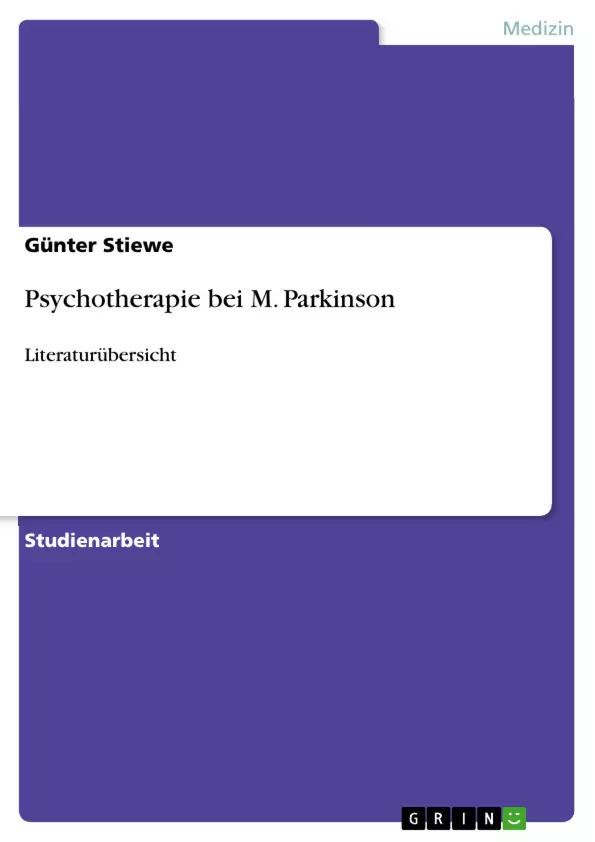In einem Überblick wird die Literatur zum Thema "Psychotherapie bei M. Parkinson" kritisch dargestellt und ein Ausblick auf mögliche Entwicklungen gewagt.
Psychotherapie bei M. Parkinson
„Ein Zugang zur Innenwelt des Patienten erschließt sich häufig aber nur dann, wenn die Bereitschaft besteht, den Betroffenen zu Wort kommen zu lassen.“
(Strenge;Schultz-Venrath 1995, S.234)
Die Psychotherapie insbesondere der Depression bei M. Parkinson wird vernachlässigt, sowohl von der klinischen Praxis als auch von der Forschung. Der Artikel möchte eine kleine Übersicht leisten über bisherige Ansätze.
Das Thema lautet nicht „Psychotherapie des M. Parkinson“, obwohl auch dazu es einiges zu sagen gäbe.
Die Idee zu diesem Artikel reifte während meiner jetzt mittlerweile mehr als siebenjährigen Tätigkeit in der Paracelsus Nordseeklinik aus einem Eindruck heraus, den man gewinnen kann, wenn man über die Entwicklung der Parkinsontherapie nachdenkt, wenn der erste Eindruck des neuen verfliegt und man glaubt, zu überblicken, wohin die Entwicklung gehen könnte.
Dies ist die eine Seite der Medaille Auf der anderen sozusagen ist der Patient abgebildet –auch hier gewinnt man einen besseren Eindruck von der Erkrankung erst wenn man manche Patienten mehrmals in mehrjährigen Abständen gesehen hat.
Wie ist gerade bei diesem Patienten das so genannte „Coping“ gelungen? Wie gelingt es möglicherweise immer wieder, bis zuletzt die Möglichkeiten erschöpft sind ?
Merkwürdigerweise scheint dies unabhängig von der Art der Behandlung zu sein. Höchstens die Art der unerwünschten Wirkungen, die Art der zusätzlich durch die Behandlung entstandene Behinderung wechselt.
Vielleicht ist diese Sicht auch nur pessimistisch und konservativ, Eigenschaften, die man sich sonst weniger gerne nachsagen lässt.
Auffällig schien mir jedenfalls die Vernachlässigung einer Behandlungsform, die sonst durchaus traditionell zum Repertoire der Nervenärzte gehörte – nämlich die Psychotherapie welcher Couleur auch immer.
In der Depressionsbehandlung anerkannt und allein oder in Kombination mit einer medikamentösen Therapie angewandt findet die Psychotherapie in der Behandlung depressiver Parkinsonpatienten erstaunlich wenig Anwendung. Welcher Nervenarzt überweist schon einen Parkinsonpatienten zum Psychotherapeuten oder führt selbst eine Therapie durch oder hat vielleicht auch nur einen Patienten darüber aufgeklärt, dass diese Möglichkeit bestünde, bei Depressionen, bei Anpassungsstörungen an das Trauma der Erkrankung?
(Nebenbei: Wie würde die „normale“, „ungestörte“ Anpassung an die Erkrankung aussehen?)
Zu den möglichen Zukunftsaussichten nebenbei folgende Bemerkung: Unlängst stellte die Firma Medtronic eine Neuentwicklung ihres Hirnschrittmachers vor, der zusätzliche Anschluss- und Schaltungsmöglichkeiten vorsieht, von denen überhaupt noch nicht erforscht ist, wozu sie dienen könnten. Meine Horrorvision der Parkinsonbehandlung in einigen Jahren ist eine Tiefenhirnstimulation mit zusätzlichen Elektroden zur elektrischen Depressionsbehandlung, möglichst mit Fernsteuerung zur Behandlung manischer Phasen.
Es ist schon erstaunlich, was wir meinen, was gut für Patienten sei.
(Meines Erachtens gehört die Implantation von Drähten ins Gehirn zu Zwecken der psychischen Beeinflussung verboten, Forschungen sollten nur an Forschungszentren erlaubt sein, die von nicht an der Forschung Beteiligten kontrolliert werden sollten. Es handelt sich hiermit m. E. um einen größer angelegten Versuch ohne Kenntnisse der physiologischen Vorgänge.)
Nach diesen quasi kulturkritischen Anmerkungen möchte ich zunächst einen kurzen Überblick über psychische Störungen beim M. Parkinson geben und dann auf die Wertung der Psychotherapie in der Literatur der Parkinsonbehandlung am Beispiel der Depression darstellen.
Nachdem traditionell der M. Parkinson als eine Bewegungsstörung konzipiert wurde, sind wir doch heute eher geneigt, ihn als eine neuropsychiatrische Systemerkrankung zu betrachten.
Bis zu 40% der Patienten leiden unter Ängsten verschiedener Art; Panikattacken, einer generalisierten Angststörung oder sozialen Phobien. Diese Ängste und ihre körperlichen Begleiterscheinungen können ein erhebliches Ausmaß erreichen. Insbesondere auch der Beginn einer Off-Phase kann mit schweren Ängsten verbunden sein.
Die Apathie kann, auch wenn sie häufig mit Depressionen, Delirien usw. einhergeht, auch isoliert auftreten und wird beschrieben als ein Mangel an zielgerichtetem Verhalten, auch im Denken und in der Stimmung.
Impulskontrollstörungen wie Spielsucht oder Hypersexualität können ganz erhebliche Probleme in der Behandlung machen.
Psychotische Phänomene sind häufig und können die Lebensqualität der Patienten und ihrer Angehörigen beeinträchtigen. Hierzu gehören Illusionen, Halluzinationen, Anwesenheitsphänomene und Wahnbildungen.
Vergesellschaftet ist diese Psychose häufig mit einer dementiellen Entwicklung. Wenden wir uns nun der Depression beim M. Parkinson zu, die in ihrer Symptomatik leicht von der bei Patienten ohne M. Parkinson abweicht.
Es gibt eine höhere Rate von Angstanteilen, Niedergeschlagenheit, Suizidideen ohne Suizidversuche und weniger Schuld und weniger Selbstvorwürfe. Immer wieder wird auf die Schwierigkeit der Depressionsdiagnose beim M. Parkinson hingewiesen, da ja einige zentrale Symptome bei beiden Erkrankungen überlappen. Hierzu gehören z.B. Schlaflosigkeit, psychomotorische Verlangsamung, Konzentrationsschwierigkeiten und Müdigkeit. In der amerikanischen Literatur werden die sog. „minor depressive disorders“ oder die subsyndromalen Depressionen als eher repräsentativ für die Depression bei M. Parkinson angesehen.
Eine Koppelung der depressiven Verstimmung an motorische Off-Phasen ist ebenfalls häufig. (Weintraub 2009)
Dass die Psychotherapie in der Depressionsbehandlung ähnlich wirksam ist, wie die Behandlung mit Antidepressiva ist mehrfach durch Studien belegt, allerdings wohl noch keineswegs allgemein anerkannt, wie jüngst die Diskussion im Ärzteblatt zeigte. Im Übersichtsartikel unter dem Titel „Therapie der Depression“ von Bschor kam die Psychotherapie doch nur sehr kurz und knapp weg. (Bschor 2008) wie in verschiedenen Leserbriefen im Anschluss diskutiert wurde.
Auch in die Standardwerke der Parkinsonbehandlung hat die Erkenntnis von der Wirksamkeit psychotherapeutischer Verfahren kaum Eingang gefunden.
Wenn man einfach nur die gängigen Monographien durchsieht auf diesen speziellen Aspekt hin ist man überrascht über das fast komplette Fehlen der Psychotherapie bzw. deren einseitiger Darstellung.
In Lemkes Monographie „Depression und Morbus Parkinson – Klinik, Diagnose, Therapie, zuerst 2002 erschienen, finden sich zwei Seiten zum Thema Psychotherapie. Allerdings besteht der größte Teil in der Darstellung der ärztlichen Beratung, auch bei depressiven Patienten, z.B. zu den Themen Tagesstrukturierung, Aktivitäten, keine wichtigen Entscheidungen treffen usw. Dann referiert der Autor ältere Darstellungen von Ellgring und Mitarbeitern und schließt mit der Aussage, dass es keine Untersuchung zur Wirksamkeit der Psychoedukation oder Stressreduktion gibt, die Wirkung jedoch wahrscheinlich sei und behauptet zum Schluss:„Entspannungsverfahren, kognitive Therapie und das Training sozialer Fertigkeiten beeinflussen Lebensqualität und Verlauf der Parkinson-Erkrankung positiv.“(Lemke 2002) Das bliebe natürlich zu wünschen, untersucht ist dies nicht.
W. Jost widmet der Psychotherapie der Depression immerhin 11 Zeilen, in denen er klar die Anwendung so genannter „basic psychotherapeutic interventions“ fordert. Im Übrigen stellt er klar, dass die anerkannten Psychotherapieverfahren zur Depressionsbehandlung, er nennt „behavior therapy“, „cognitive therapy“ und „interpersonal therapy“, für die Anwendung bei Patienten mit M. Parkinson nicht untersucht seien (Jost 2008).
Einen Überblick über nichtmedikamentöse Behandlungsverfahren haben kürzlich Ceballos-Bauman und Ebersbach vorgelegt. Sie stellen die Bedeutung der progressiven Muskelentspannung heraus in Rückgriff auf Strehl und Leplow. Auch imaginative oder autosuggestive Verfahren könnten ihrer Meinung nach Anwendung finden. Es wird auf Fliegels verhaltenstherapeutische Standardmethoden verwiesen. Weiter erfolgt ein Hinweis auf psychoedukative Maßnahmen, Stressbewältigungstraining, Training der krankheitsbezogenen Kommunikation und Management spezieller Symptome. Hier wieder der Verweis auf Macht und Ellgring (2003) und Leplow (2007), auf dessen Monographie ich später noch etwas ausführlicher eingehe (Ceballos-Baumann 2008).
Was findet sich in der älteren deutschsprachigen Literatur zum Thema? Die Psychotherapie im Titel führt das Werk von Strehl und Birbauer „Verhaltenstherapeutische Interventionen bei Morbus Parkinson“. Es wird ein Trainingsprogramm vorgestellt, dass aus Entspannungstraining nach Jacobson, aus einem motorischen Training zur Verbesserung von Mimik, Sprechen, Gang und Haltung, der Feinmotorik und den automatisierten Bewegungsabläufen sowie im dritten Teil einem Training zur Stressbewältigung besteht. Depressive Patienten, Demenzpatienten und schwer betroffenen Patienten sind ausgeschlossen (Hoehn und Yahr im Mittelwert 2, keine psychiatrischen Erkrankungen, keine somatischen Begleiterkrankungen). Die Patienten zeigen in der Therapiegruppe – im Vergleich zu einer Gruppe mit einer nicht näher definierten unspezifischen psychologischen Betreuung eine Verbesserung der Feinmotorik, der allgemeinen Beweglichkeit, der Ganginitiierung und der Bewältigung kritischer Situationen. Sowohl in der Therapiegruppe als auch in der Vergleichsgruppe stieg die subjektive Lebenszufriedenheit (Strehl, Birbauer 1996).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Psychotherapie bei Morbus Parkinson wichtig?
Parkinson wird zunehmend als neuropsychiatrische Systemerkrankung verstanden. Psychotherapie hilft bei der Bewältigung von Ängsten, Depressionen und der Anpassung an das Trauma der chronischen Erkrankung.
Welche psychischen Störungen treten bei Parkinson häufig auf?
Bis zu 40 % der Patienten leiden unter Ängsten, Panikattacken, Depressionen, Apathie oder Impulskontrollstörungen wie Spielsucht. Auch psychotische Phänomene können auftreten.
Wird die Psychotherapie in der Parkinson-Behandlung vernachlässigt?
Ja, die Literatur und klinische Praxis konzentrieren sich stark auf medikamentöse und chirurgische Therapien (wie Tiefenhirnstimulation), während psychotherapeutische Ansätze oft nur am Rand erwähnt werden.
Was unterscheidet eine Parkinson-Depression von einer "normalen" Depression?
Bei Parkinson-Patienten gibt es oft mehr Angstanteile und Suizidideen ohne Versuche, aber weniger Schuldgefühle und Selbstvorwürfe. Die Diagnose ist schwierig, da sich Symptome wie Müdigkeit und Verlangsamung überschneiden.
Welche psychotherapeutischen Verfahren werden empfohlen?
Genannt werden Verhaltenstherapie, kognitive Therapie, Entspannungstraining nach Jacobson sowie Psychoedukation und Stressbewältigungstraining.
Was bedeutet "Coping" im Zusammenhang mit Parkinson?
Coping bezeichnet die Strategien des Patienten, mit den Einschränkungen der Krankheit umzugehen. Ein gelungenes Coping ist entscheidend für die Lebensqualität über den Krankheitsverlauf hinweg.
- Citar trabajo
- Günter Stiewe (Autor), 2009, Psychotherapie bei M. Parkinson, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137661