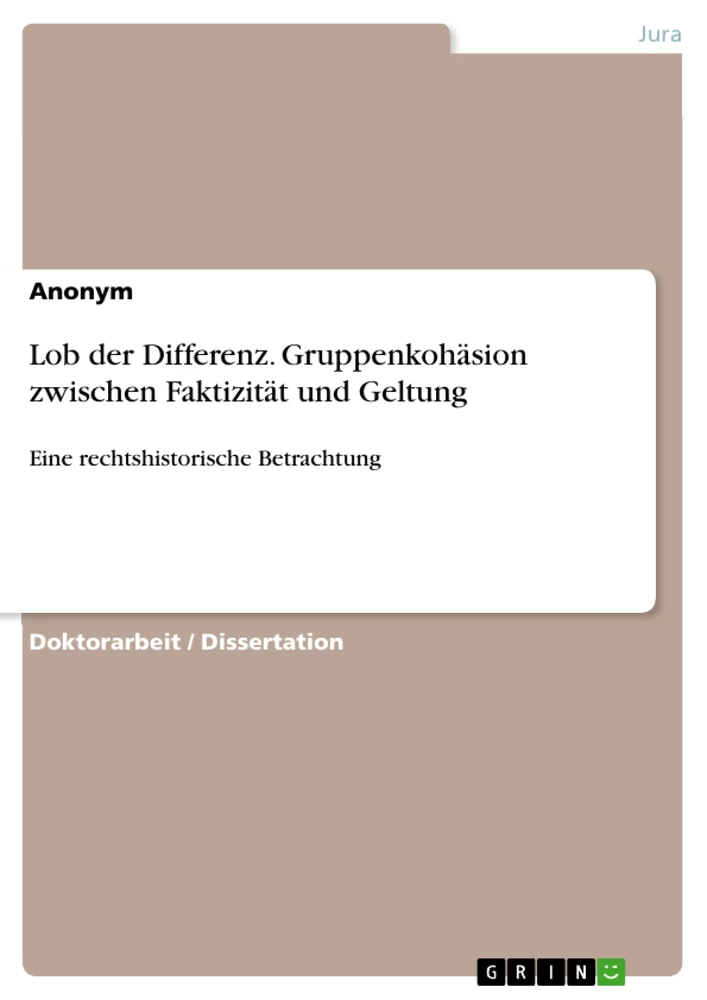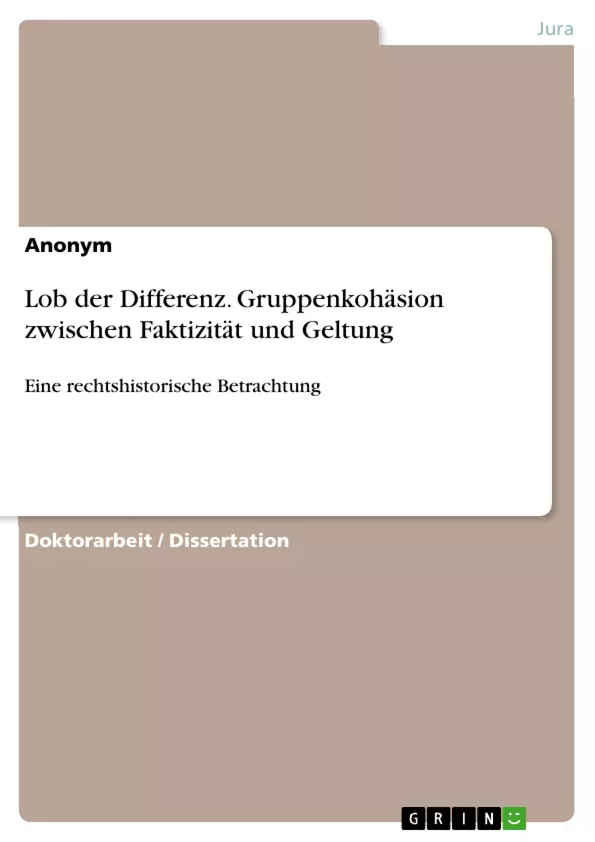Diese Arbeit setzt sich, angesichts der zunehmend mehr werdenden Flüchtlings- und Migrationsbewegungen in Richtung Europa, unter anderem mit dem wichtigen wie aktuellen Themenkomplex Integration / Migration auseinander. Denn aus diesem strahlen drängende Fragen unserer Zeit aus: wie zum Beispiel die Frage, ob und, wenn ja, wie eine bedeutende Anzahl an Menschen, seien es nun Schutzsuchende, Asylwerber, Flüchtlinge oder Zuwanderer, in ein bestehendes, komplexes Gruppengefüge dauerhaft integriert werden können. Darüber hinaus scheint es auch die Stabilität der europäischen Staaten sowie die Zukunft der europäischen Gemeinschaft überhaupt zu beeinflussen, ob auf Fragen dieser Art befriedigende Antworten gefunden werden können.
Bei genauerer Betrachtung gibt es Anhaltspunkte dafür, dass die beiden komplexen Sachgebiete, „Integration“ einerseits und „Gruppenkohäsion“ andererseits, zusammenhängen und gewisse Gemeinsamkeiten bestehen. Denn wer die Frage im Auge hat, wie Menschen mit - vereinfacht gesagt - eigenem kulturellen Zugang in eine bestehende Gruppe mit anderem kulturellen Zugang integriert werden können, kann womöglich auf Erkenntnisse zurückgreifen, die die Frage betreffen, auf welche Weise die Gruppenbildung überhaupt funktioniert und wodurch Gruppen auf Dauer zusammengehalten werden.
Des Weiteren bietet die Auseinandersetzung mit den Theoremen und Ansätzen von Eugen Ehrlich, Emil Durkheim, Max Weber und anderen die Gelegenheit, die Wiener Tradition, vor allem unter Bezugnahme auf Eugen Ehrlich, in diesem Zusammenhang aufzuarbeiten und einer rechtshistorischen Betrachtung zu unterziehen. Darüber hinaus werden auch die rechtsphilosophischen Erkenntnisse genannter Autoren zur Sprache gebracht und mittels reflexiser, hermeneutischer Methode einer Interpretation unterzogen. Die Verknüpfung von rechtshistorischer mit rechtsphilosophischer Deutung ist das, soweit überblickbar, spezifisch Neue, welches in dieser Arbeit aufgezeigt wird. Dies unter der Maßgabe die Eigentümlichkeiten des Phänomens „Gruppenkohäsion“ im Spannungsfeld zwischen Faktizität und Geltung hervorzustreichen.
Inhaltsverzeichnis
- Teil A: Problemstellung
- I. Vorwort und Problemaufriß
- II. Grundstruktur der Arbeit
- Teil B: Argumentum
- I. Eugen Ehrlichs „Grundlegung der Rechtssoziologie“
- a. Einleitung
- b. „Sein Hauptwerk „Grundlegung der Soziologie des Rechts“
- İ. Erheben von Schwerpunkten
- II. Würdigung und Stellungnahme
- c. „Recht und Leben“, Gesammelte Schriften zur Rechtstatsachenforschung und zur Freirechtslehre
- iii. Erheben von Schwerpunkten
- iv. Würdigung und Stellungnahme
- d. Inaugurationsrede vom 02. Dezember 1906 in Czernowitz: „Die Tatsachen des Gewohnheitsrechts“
- İ. Erheben von Schwerpunkten
- ii. Würdigung und Stellungnahme
- e. Kritik an Ehrlichs Thesen und Werk
- II. Émil Durkheim und „die Physik der Sitten und des Rechts“
- a. Einleitung
- b. „Soziologie und Philosophie“
- i. Erheben von Schwerpunkten
- ii. Würdigung und Stellungnahme
- c. „Erziehung, Moral und Gesellschaft“
- i. Erheben von Schwerpunkten
- ii. Würdigung und Stellungnahme
- d. „Physik der Sitten und des Rechts“
- i. Erheben von Schwerpunkten
- ii. Würdigung und Stellungnahme
- e. Kritik an Durkheims Konzepten und Theoremen
- f. Durkheim und Weber: Zwei Soziologen wie Tag und Nacht?
- III. Max Webers „Wirtschaft und Gesellschaft“
- a. Einleitung
- b. „Erster Teil, Kapitel I. Soziologische Grundbegriffe“
- i. Erheben von Schwerpunkten
- ii. Würdigung und Stellungnahme
- c. „Zweiter Teil, Kapitel I. Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen“
- i. Erheben von Schwerpunkten
- ii. Würdigung und Stellungnahme
- d. „Zweiter Teil, Kapitel IV. Ethnische Gemeinschaften“
- İ. Erheben von Schwerpunkten
- ii. Würdigung und Stellungnahme
- e. „Zweiter Teil, Kapitel VII. Rechtssoziologie“
- İ. Erheben von Schwerpunkten
- ii. Würdigung und Stellungnahme
- f. „Zweiter Teil, Kapitel VIII. Politische Gemeinschaften“
- i. Erheben von Schwerpunkten
- ii. Würdigung und Stellungnahme
- g. Kritik an Webers Konzepten und Theoremen
- h. Schlußwort zur methodologischen Konzeption
- IV. Pitirim Sorokin
- a. Einleitung
- b. „Die Krise unserer Zeit“
- c. „Kulturkrise und Gesellschaftsphilosophie“
- d. Kritik an Sorokin Konzepten und Theoremen
- V. Robert K. Merton
- a. Einleitung
- b. Wichtige soziologische Analysen
- c. Wichtige soziologische Konzepte
- d. Kritik an Mertons Konzepten und Theoremen
- VI. Weitere ausgewählte Stellungnahmen und Beiträge zum Thema
- a. Manfred Rehbinder zum „Rechtsgefühl“ und Ernst Hirsch „zur Steuerung von menschlichem Verhalten“
- İ. Erheben von Schwerpunkten
- ii. Würdigung und Stellungnahme
- b. Talcott Parsons „Das System moderner Gesellschaften“
- c. Das Verhältnis zwischen Talcott Parsons und Robert K. Merton
- İ. Erheben von Schwerpunkten
- ii. Würdigung und Stellungnahme
- d. Gerhard Struck „Rechtssoziologie“
- i. Erheben von Schwerpunkten
- ii. Würdigung und Stellungnahme
- e. Franz Bydlinskis „Fundamentale Rechtsgrundsätze“
- İ. Die wesentlichen Theoreme
- ii. Reflexion
- Die Rolle der Rechtsgeschichte in der Analyse von Gruppenkohäsion
- Das Verhältnis von Faktizität und Geltung in der Rechtsordnung
- Die Bedeutung unterschiedlicher soziologischer Perspektiven für das Verständnis von Gruppenkohäsion
- Die Analyse wichtiger soziologischer Denker wie Eugen Ehrlich, Émil Durkheim, Max Weber und Robert K. Merton
- Die Herausforderungen und Chancen der modernen Gesellschaft im Hinblick auf Gruppenkohäsion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Dissertation befasst sich mit der Frage der Gruppenkohäsion im Kontext der Differenz. Sie untersucht, wie die Kohäsion von Gruppen inmitten unterschiedlicher Perspektiven, Meinungen und Interessen aufrechterhalten werden kann.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, in der die Problemstellung und die Grundstruktur der Dissertation vorgestellt werden. Anschließend werden in Kapitel I bis IV die Werke von Eugen Ehrlich, Émil Durkheim, Max Weber und Pitirim Sorokin untersucht, die wichtige Beiträge zur Rechtssoziologie geleistet haben. Jedes Kapitel befasst sich mit den wichtigsten Thesen und Argumenten der jeweiligen Autoren, hebt Schwerpunkte hervor und würdigt deren Leistungen. Darüber hinaus werden kritische Anmerkungen zu den jeweiligen Werken gegeben. In Kapitel V wird das Werk von Robert K. Merton beleuchtet, während Kapitel VI weitere ausgewählte Stellungnahmen und Beiträge zum Thema Gruppenkohäsion beleuchtet, die in der Dissertation analysiert werden.
Schlüsselwörter
Die Dissertation behandelt die Themen Gruppenkohäsion, Differenz, Rechtssoziologie, Rechtsgeschichte, Faktizität, Geltung, Soziologische Theorie, Eugen Ehrlich, Émil Durkheim, Max Weber, Robert K. Merton, Moderne Gesellschaft.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Lob der Differenz. Gruppenkohäsion zwischen Faktizität und Geltung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1376785