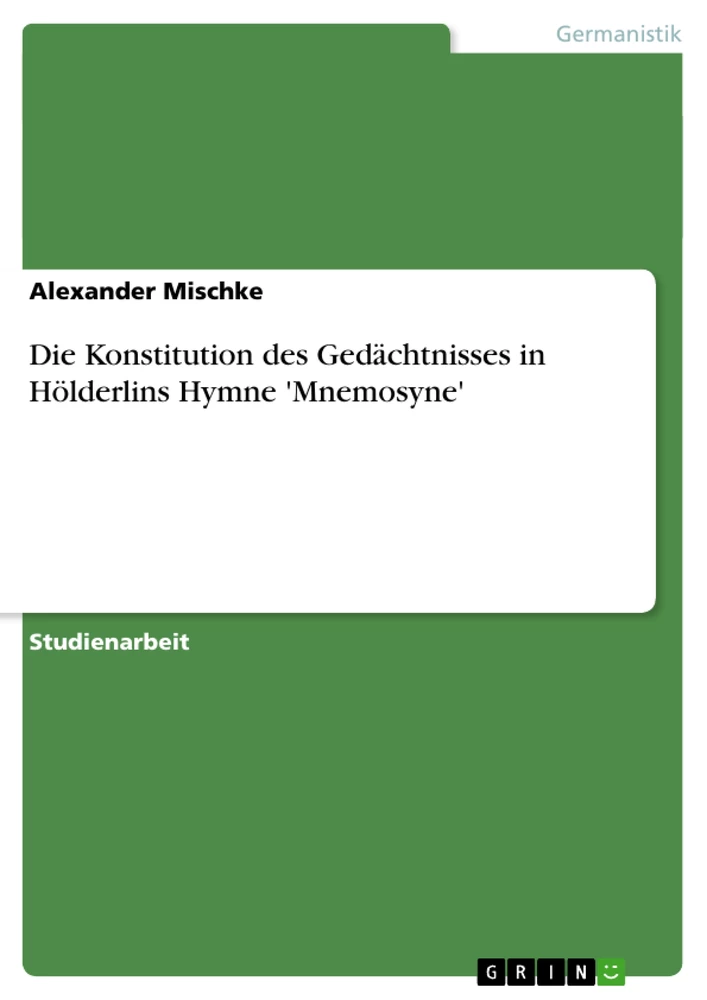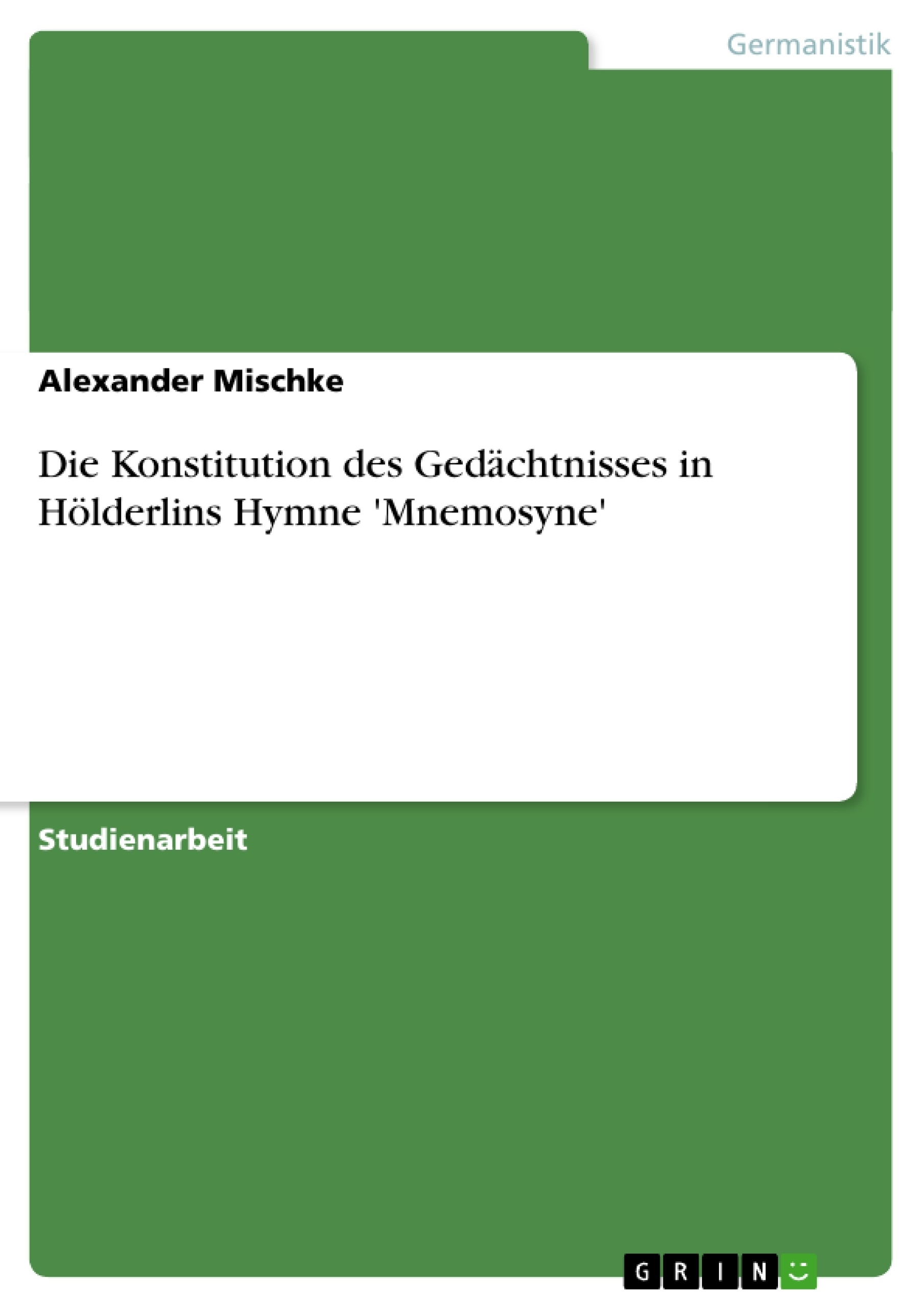Friedrich Hölderlins letzte Hymne „Mnemosyne“, welche vermutlich im Herbst 1803
entstand, weist sich schon durch ihren Titel als Trägerin eines für den Dichter bedeutsamen
Sinngehalts aus: Mnemosyne als die personifizierte und apotheosierte antik-griechische
Göttin des Gedächtnisses und der Erinnerung, als Titanide Mutter der Musen, repräsentiert ein
Konzept, das in den geschichtsphilosophischen Überlegungen Hölderlins eine tragende Rolle
spielt. Bereits in der Elegie „Brod und Wein“ und der Hymne „Andenken“ wird auf die
Möglichkeiten und den existentiellen Wert von Erinnerung und Rückbesinnung verwiesen.
Ziel der nachfolgenden Arbeit soll daher sein, den spezifischen Charakter des
Gedächtnisses in „Mnemosyne“ herauszuarbeiten und zudem das Tendenziöse von
Gedächtnis im Spannungsfeld von als positiv sich eröffnender Möglichkeit oder bedrohlichem
Faktor zu ermitteln. Nach einer kurzen formalen Analyse des Gedichtes soll zunächst die
geschichtsphilosophische Dimension von Gedächtnis bei Hölderlin Erwähnung finden, um
dann die Konstitution von Gedächtnis in der Hymne zu untersuchen. Der Fokus wird sich bei
der Analyse besonders auf die erste Strophe richten; wo sich thematisch bedeutsame
Überlegungen oder Parallelen (aber auch Abweichungen) zu der Erst- und Zweitfassung des
Gedichts ergeben, sollen diese auch Berücksichtigung finden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Formale Struktur
3. Die geschichtsphilosophische Dimension von Ged i chtnis
4. Die Konstitution des Ged i chtnisses
4.1 Das „Ungebundene" - Gefährdung durch das Unmittelbar-Absolute
4.2 Das Warnende - Rettung durch MaBhalten
4.3 Das Notwendige — Forderung nach einem Gedächtnis
5. Schluss
6. Literaturverzeichnis
1 . Einleitung
Friedrich Hölderlins letzte Hymne „Mnemosyne", welche vermutlich im Herbst 1803 entstand, weist sich schon durch ihren Titel als Trägerin eines fir den Dichter bedeutsamen Sinngehalts aus: Mnemosyne als die personifizierte und apotheosierte antik-griechische Göttin des Gedächtnisses und der Erinnerung, als Titanide Mutter der Musen, repräsentiert ein Konzept, das in den geschichtsphilosophischen Uberlegungen Hölderlins eine tragende Rolle spielt. Bereits in der Elegie „Brod und Wein" und der Hymne „Andenken" wird auf die Möglichkeiten und den existentiellen Wert von Erinnerung und Rückbesinnung verwiesen.
Ziel der nachfolgenden Arbeit soll daher sein, den spezifischen Charakter des Gedächtnisses in „Mnemosyne" herauszuarbeiten und zudem das Tendenziöse von Gedächtnis im Spannungsfeld von als positiv sich eröffnender Möglichkeit oder bedrohlichem Faktor zu ermitteln. Nach einer kurzen formalen Analyse des Gedichtes soll zunächst die geschichtsphilosophische Dimension von Gedächtnis bei Hölderlin Erwähnung finden, um dann die Konstitution von Gedächtnis in der Hymne zu untersuchen. Der Fokus wird sich bei der Analyse besonders auf die erste Strophe richten; wo sich thematisch bedeutsame Uberlegungen oder Parallelen (aber auch Abweichungen) zu der Erst- und Zweitfassung des Gedichts ergeben, sollen diese auch Beriicksichtigung finden.1
2 . Formale Struktur
Die äuBere Form der Hymne weist einen einheitlichen Bau auf. Sie besteht aus drei Strophen zu je 17 Versen. Das formale „Kriterium" fAr Lyrik, die Versifikation, ist somit erfAllt. Wie fAr die späten Hymnen Hölderlins typisch, wurde der metrisch ungebundene und reimlose freie Vers verwendet. Das prosaisch Anmutende des Textes wird durch dabei durch die FAlle an Enjambements und den syntaktischen Inversionen zunehmend ins Lyrische überfAhrt. Die Zergliederung der Syntagmen in Folge der Enjambements fAhrt zur Konstruktion neuer semantischer Sinn- und Rhythmuseinheiten.
Der vermeintlich entstehenden „[...] Frage nach der Interpretierbarkeit der Hymne [...]"2 aufgrund der Vorstellung „[...] dass der Zusammenhang der Teile unklar [sei] [...]"3 ist die inhaltliche Komplexitätssteigerung aufgrund der Form nur dienlich. Allein aber die Systematik der Gesamtstruktur, die Beissner als dialektischen Dreischritt mit These (Gefahr), Antithese (Trost) und Synthese (Gedächtnis)4 auffasst, mag das Intentionale in Hölderlins letzter Hymne offenbaren und die Möglichkeit einer sinngemäBen Deutung nicht ausschlieBen.
3 . Die geschichtsphilosophische Dimension von Ged i chtnis
Mit Gedächtnis und dem damit verbundenen Akt des Sich-Erinnerns verbinden sich zugleich auch immer Vorstellungen von Positionierung „in" der Zeit und Eigentlichkeit. Das Ertragen der Kontingenz von Geschichte und der Geworfenheit in eine der Unbeständigkeit unterworfenen Welt ist stets mit einem Rückgriff in schon Erlebtes und den daraus gewonnenen Erfahrungswirklichkeiten verbunden. Am deutlichsten tritt dies in der zweiten Fassung der Hymne vor (vgl. ZF, V. 1-2), wenn das lyrische Ich den Vergleich mit einem sinnleeren, nicht mehr der Ausdeutung fähigem Zeichen anstrebt und sogar den Verlust des Eigenen „in der Fremde" (V. 3) beklagt.Weiter gefasst bietet Gedächtnis Fixpunkte in der Zeit und damit Chancen auf die Bildung von Identität individueller oder kollektiver Art.
Für Hölderlins eigene geschichtsphilosophische Vorstellungen scheint die Konservierung von Gedächtnis gerade in Zeiten des Ubergangs bedeutend zu sein. So zum Beispiel in „Brod und Wein"5, wo in der als negativ empfundenen Gegenwart die Forderung nach einem „Heilig GedächtniB auch, wachend zu bleiben bei Nacht" (V. 36) zum Ausdruck kommt. Auch die Notwendigkeit der (Rück-)bindung („einiges Haltbare[s]", V. 32) findet Erwähnung, wobei aber zugleich auf die Rolle des Vergessens verwiesen wird, was die Stellung des Gedächtnisses als Gegenstand der Trauer um Vergangenes relativiert. Weiterhin, wenn Christus (als der letzte antike Gott gedacht) „bleibet und selbst die Spur der entflohenen Götter Götterlosen hinab unter das finstere bringt." (V. 147/148). Nicht zuletzt aber in den Schlussversen, wo das Bild einer erneuten Auferstehung der alten Götter entfaltet wird und somit geschichtsphilosophisch der Bogen zum Anfang gespannt wird, erscheinen die Konservierung (als Bewahren des Wesentlichen, Eigentlichen) und Vermittlung von Gedachtnis als essentielle Grundfunktionen. Auch die Allegorie des Wandels in „Mnemosyne" („und gewaltig / Die Monde gehn", ZF, V. 5-6) kiindigt den genealogischen Fortgang des Gedachtnisses an, wenn „Das Meer auch und Ströme [...] / Den Pfad sich suchen" (V. 7-8).
Noch deutlicher tritt dieser Gedanke in „Andenken"6 hervor. Erinnerung hat hier einen diskursiven Charakter, im Dialog wird Gedachtnis erlebt: „Doch gut ist ein Gesprach und [...] zu hören viel / Von Tagen der Lieb', / Und Taten, welche geschehen" (V. 32-36). Nicht zuletzt melden sich dennoch Bedenken um die Bestandigkeit an, „Es nehmet aber / Und gibt Gedachtnis die See" (V. 56-57). Der Tragik, "[...] die verwundenden Zeichen der Verganglichkeit des Schönen und Hohen."7, dass Vieles der Vergessenheit anheim fallt, halt Hölderlin die heroisch-tragische Aufgabe des Dichters entgegen: „Was bleibet aber, stiften die Dichter." (V. 5 9).
4 . Die Konstitution des Ged ie htnisses
Die erste Strophe der Hymne beginnt mit dem Bild einer Vollendung, der Vorstellung „Reif sind [...] Die Friicht" (V. 1-2), was symbolisch auf den sich entwickelten Menschen oder die gewachsenen historischen Möglichkeiten hinweist. Mit diesem Bild einer vorlaufigen Vollendung korreliert die Ahnung eines entgrenzten „Gesez[es]" (V. 2), das auf der irdischen Ebene Geltung beanspruchen kann, aber von jenseits (göttlich), „Prophetisch, traumend auf / Den Hiigeln des Himmels" (V. 4-5) waltet. Genauer besehen handelt es sich um ein zukunftsgewisses Universalgesetz, in „DaB alles hineingeht" (V. 3). Der Vergleich mit den „Schlangen" (V. 3) als symbolisch-chthonischen Tieren (der Mensch als der Erde verhaftet) verweist daher viel eher auf die Exklusivitat dieses Gesetzes und den Tod als letztlichen Ausgang des menschlichen Lebens, als auf die Vorstellung „[...] das alles die Klugheit von Schlangen zeigen soll, indem es in die Schutz bietende Erde hineinschliipft."8 Das Negative dieses allgemeinen Gesetzes wird noch weiter intensiviert, wenn angehauftes Gedachtnis pejorativ als „eine / Last von Scheitern" (V. 6-7) umschrieben wird. Auch auf Gedachtnis als einer chaotischen Unordnung („Wie Rosse, gehen die gefangenen / Element", V. 10-11) und einem System iiberholter Meinungen oder Denkvorstellungen („alte[n] / Gesez der Erd.", V. 11-12) Bezug nehmend, ergibt sich eine Wertung des Gedächtnisses als hemmendes und zugleich begrenzendes Element, das dennoch imperativisch „Zu behalten" (V. 8) sei. Gleichsam als Kontraposition zu dieser Abschilderung des Einschränkenden von Gedächtnis, wirft das lyrische Ich die wesentliche Problematik des Gedichtes auf: „Und immer / Ins Ungebundene gehet eine Sehnsucht" (V. 12-13).
Das als gefährdend bestimmte Gedächtnis drängt den Menschen, sich vom Bezug auf das Eigene („Last von Scheitern") zu lösen und erschafft einen „dämonischen Wesenszug, [einen] Drang ins Ungebundene [...]". 9, als die Flucht ins Uberzeitliche. Erneut aber wird, graphisch durch den Zeilensprung dargestellt, die Forderung „Zu behalten" (V. 14) wiederholt und mit dem paradox anmutendem „Und Noth [also auch Notwendigkeit ] die Treue" (V. 14) eine stagnierende Stimmung evoziert. Dies steigert sich noch in der erlebten Passivität, "[D]em Zustand der seligen 'Vergessenheit' [wie im Hyperion ] [...], nicht 'vorwärts' und nicht 'riickwärts' zu sehn, [...]"10 in der Metapher des „schwanke[nden] Kahn[s]" (V. 17), wo das Relative (im Sinne von Bezug zu Gedächtnis) dem Absoluten vollends weicht. Dem Bedrohlichen von Gedächtnis wird daher das Rettende in der Form des Vorwurfs „Vorwärts aber und riikwärts wollen wir / Nicht sehn" (V. 15-16) entgegengestellt. In Anlehnung an Beissners Interpretation finden sich also deutliche Hinweise auf die Annahme, dass "[...] der Mensch in den gewaltigen Ereignissen einer geschichtlichen Wendezeit in Versuchung gefiihrt [wird], in Apathie alles geschehen zu lassen."11 Die Tendenz, welche Gedächtnis zwischen den Polen der Bedrohung und der Rettung einnimmt, erfährt daher im Gang durch die Strophe eine Wandlung: wenn in einer Zeit eines als negativ oder involutiv erfahrenen geschichtlichen Ubergangs (bzw. durch die Erkenntnis der Bedingtheit des menschlichen Daseins) das Gedächtnis als Last empfunden wird (wenn jede Hoffnung, hervorgerufen durch Erinnern, im Hinblick auf das Unvermeidliche, Vergängliche bereits obsolet scheint), so wird es mit Blick auf das selbstvergessene Streben ins Ungebundene als ein Ubel ausgemacht, dessen Notwendigkeit aber erkannt und somit ein rettender Charakter zugestanden wird.
Der ambivalente Wert des Gedächtnisses ergibt sich also zunächst aus seiner Zweckbestimmtheit, die es um den zentralen Begriff des Ungebundenen einnimmt.
[...]
1 Die Quellentexte betreffend beziehe ich mich auf: Hölderlin, Friedrich: Sämtliche Werke. Zweiter Band. Gedichte nach 1800. Erste Hälfte (Text). Hrsg. von Friedrich Beissner. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag 1 951 (= GroBe Stuttgarter Ausgabe. Bd. II/1). S. 1 93-1 98. Fortan wird die erste Fassung als „EF", die zweite als „ZF" abgekiirzt. Der Analyse liegt die dritte Fassung zugrunde (S. 1 97-1 98).
2 Harrison, Robin: „Das Rettende" oder „Gefahr"? Die Bedeutung des Gedächtnisses in Hölderlins Hymne 'Mnemosyne'. In: Hölderlin-Jahrbuch 1 984-1 985. Hrsg. von Bernhard Böschenstein und Gerhard Kurz. Tubingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 1 986. S. 1 96.
3 Ebd.
4 Vgl. Beissner, Friedrich: Hölderlins letzte Hymne. Ein Vortrag von Friedrich Beissner. In: Hölderlin-Jahrbuch 1 948/49. Hrsg. von Friedrich Beissner und Paul Kluckhohn. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 1 94 9. S. 87-88.
5 Hölderlin, Friedrich: Gedichte nach 1800. S. 91- 95.
6 Ebd. S. 188-18 9.
7 Schmidt, Jochen: Hölderlins letzte Hymnen 'Andenken' und 'Mnemosyne'. Tiibingen: Max Niemeyer Verlag 1 970 (= Untersuchungen zur deutschen Literaturgeschichte. Bd. 7). S. 58.
8 Harrison, Robin: „Das Rettende" oder „Gefahr"? S. 1 97.
9 Schmidt, Jochen: Hölderlins letzte Hymnen 'Andenken' und 'Mnemosyne'. S. 62.
10 Ebd. S. 56.
11 Harrison, Robin: „Das Rettende" oder „Gefahr"? S. 1 95.
- Citar trabajo
- Alexander Mischke (Autor), 2009, Die Konstitution des Gedächtnisses in Hölderlins Hymne 'Mnemosyne', Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137885