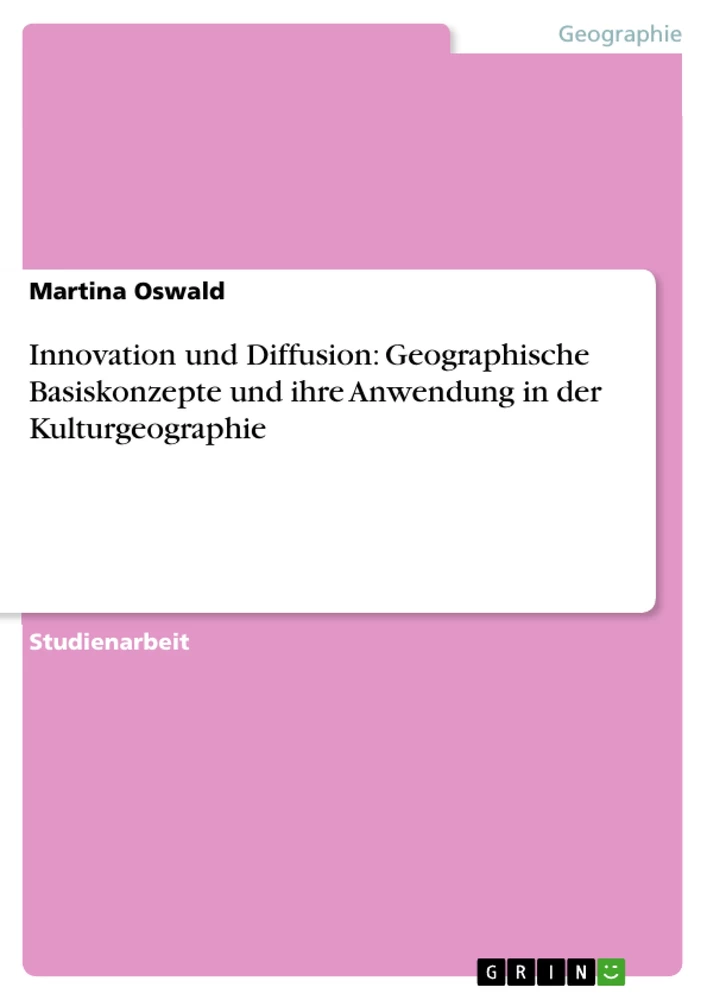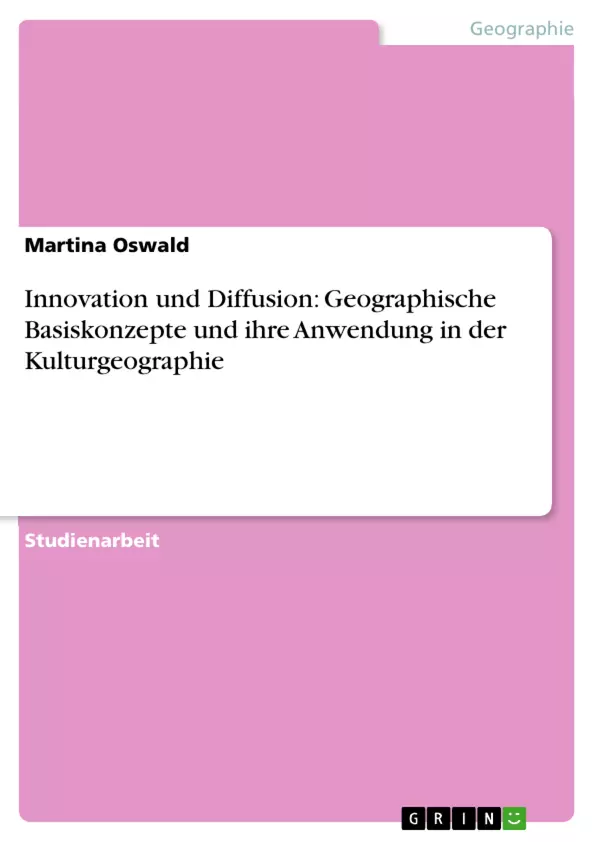Die folgende Hausarbeit zum Thema „Innovation und Diffusion: Geographische Basiskonzepte und ihre Anwendung in der Kulturgeographie“ beschäftigt sich unter anderem mit der Sachlage, wie sich eine Innovation in räumlicher und zeitlicher Hinsicht verbreiten kann. Hierzu ein Fallbeispiel aus den USA während der Großen Depression in den späten 1920er- Jahren: Farmer der amerikanischen Landwirtschaft klagten über starke Bodenerosion, woraufhin die US Soil Conservation die Anwendung bestimmter Bodenschutzmaßnahmen vorschlug, um vor allem auch gefährdete Böden vor Bodenerosion zu schützen. Zunächst stellte sich das Problem dar, die konservativen und skeptischen Farmer von dieser Innovation zu überzeugen. Nachdem die Farmer den Erfolg der Bodenschutztechniken erkannten, verbreitete sich diese Innovation wellenartig, vergleichbar wie die Wellen eines ins Wasser geworfenen Steines [Haggett, 2001: 501].
Inhaltsverzeichnis:
Einleitung
1. Innovationen als Grundlage kulturellen Wandels
2. Begriffserläuterungen
3. Entwicklungsgeschichte der Innovations- und Diffusionsforschung
4. Räumliche Diffusion
4.1 Welche Diffusionsarten gibt es?
4.2 Welche Formen der Ausbreitung gibt es?
5. Diffusionsprozess nach Hägerstrand
5.1 Diffusionswelle im Profil
5.2 Grundmodelle des Diffusionsprozesses
5.2.1 Kontaktfelder
5.2.2 MIF (mean information field)
5.3 Diffusionswelle in Raum und Zeit
6. Anwendung der Innovations- und Diffusionsforschung auf die Kulturgeographie
Fazit
Literaturverzeichnis
Einleitung
Die folgende Hausarbeit zum Thema „Innovation und Diffusion: Geographische Basiskonzepte und ihre Anwendung in der Kulturgeographie“ beschäftigt sich unter anderem mit der Sachlage, wie sich eine Innovation in räumlicher und zeitlicher Hinsicht verbreiten kann. Hierzu ein Fallbeispiel aus den USA während der Großen Depression in den späten 1920er- Jahren: Farmer der amerikanischen Landwirtschaft klagten über starke Bodenerosion, woraufhin die US Soil Conservation die Anwendung bestimmter Bodenschutzmaßnahmen vorschlug, um vor allem auch gefährdete Böden vor Bodenerosion zu schützen. Zunächst stellte sich das Problem dar, die konservativen und skeptischen Farmer von dieser Innovation zu überzeugen. Nachdem die Farmer den Erfolg der Bodenschutztechniken erkannten, verbreitete sich diese Innovation wellenartig, vergleichbar wie die Wellen eines ins Wasser geworfenen Steines [Haggett, 2001: 501].
Im Laufe der Hausarbeit stelle ich noch weitere Beispiel dar, die den Innovations-/ Diffusionsprozess verdeutlichen sollen. Doch zu Beginn werde ich die Auswirkungen und Bedeutungen von Innovationen im Hinblick auf die Kultur darstellen. Anschließend steige ich in die Thematik der Arbeit ein und werde zunächst einige Grundbegriffe definieren, die die Basis für das Verständnis der Hausarbeit darstellen. Außerdem werde ich die Geschichte der Innovation- und Diffusionsforschung erläutern, bevor ich auf die räumliche Diffusion und den Diffusionsprozess eingehe. Abschließend erläutere ich einige Anwendungsbeispiele des Innovations- und Diffusionsprozesses im Hinblick auf die Kulturgeographie.
1. Innovationen als Grundlage kulturellen Wandels
Kultureller Wandel ist ein stetig fortlaufender Prozess, der durch zahlreiche Neuerungen, neue Verhaltensweisen, Ideen und Alternativen zur Verbesserung und Modernisierung des alltäglichen Lebens angetrieben wird.
Selbstverständlich tragen auch andere Ursachen (z.B.: Historische) zum Kulturwandel bei.
Krieg, Eroberungen und Wettbewerb/ Kampf um Ressourcen oder ein abrupter Wandel in der physikalischen Umwelt kann eine Kultur verändern. Ebenso wie ein stetiger Anstieg der Bevölkerungsdichte oder eine gezwungene Anpassung einer Gesellschaft in eine andere ökologisch- kulturelle Umwelt sind Ursachen kulturellen Wandels.
Doch der Focus dieser Arbeit richtet sich unter anderem auf die Veränderung einer Kultur durch Innovationen [Röpke, 1970: 59- 60].
Doch welche Faktoren beeinflussen die Annahme einer Innovation?
Zunächst ist die geistige und moralische Bereitschaft einer Gesellschaft, also die Kompatibilität, Vorraussetzung, um eine Innovation annehmen zu können.
Eine Innovation sollte bei dem einzelnen Individuum ein gewisses Bedürfnis hervorrufen. Das heißt, dass eine Innovation eine besondere Bedeutung haben muss und sich mit gegebenen Erfahrungselementen identifizieren lassen sollte. Des Weiteren muss sich eine Innovation für den einzelnen lohnen. Eine Verifizierung der Erwartungen muss stattfinden, ein erwarteter Wert muss erfüllt werden, damit sich eine Innovation durchsetzt und angenommen werden kann [Röpke, 1970: 76- 84].
Die Bereitschaft, eine Innovation anzunehmen, ist von jedem Individuum abhängig. Der einzelne Mensch und nicht etwa ein System oder der Staat steht in der Theorie des Kulturwandels im Vordergrund.
2. Begrifferläuterungen
Für das Grundverständnis der Hausarbeit sind einige Definitionen notwendig, da diese Begriffe die Basis des Themas darstellen. Liest man den Titel dieser Arbeit „Innovation und Diffusion: Geographische Basiskonzepte und ihre Anwendung in der Kulturgeographie“, stellt sich die Frage, was bedeutet eigentlich Innovation und Diffusion?
Eine Innovation ist die „Bezeichnung für neues Wissen, neue Produkte (Produktinnovation) oder neue Verfahren (Prozessinnovation oder organisatorische Innovation). Der Innovation geht die Invention (Erfindung) voraus“ [Brunotte, Gebhardt, Meurer, Meusburger, Nipper, 2002: 164]. Das bedeutet, dass es sich bei einer Innovation um eine vollkommen neue Erfindung handelt, die es auf dem Markt noch niemals gab. Allerdings kann es sich bei einer Innovation auch um eine Produkterneuerung handeln, also ein Entwicklungsprozess von Produkten, bei dem ein älteres Produkt von einem neueren Produkt verdrängt wird. Der Begriff Innovation schließt auch neue oder verbesserte Produktionsverfahren mit ein, die in ein Unternehmen eingeführt werden [Brunotte et al., 2002: 82].
Diffusion „ bedeutet im allgemeinen Sinne einen Prozess der Ausbreitung einer Gegebenheit (materieller wie immaterieller Art). In der Anthropogeographie bedeutet das konkret die Ausbreitung technischer Neuerungen (Innovationen), sowohl in räumlicher und zeitlicher Hinsicht“ [Brunotte, Gebhardt, Meurer, Meusburger, Nipper, 2002: 257]. Zur Erläuterung dieser Definition, erwähne ich erneut das Beispiel der amerikanischen Landwirte, die mit Bodenerosionsvorgängen in den späten 1920er- Jahren zu kämpfen hatten. Die Innovation war in diesem Falle eine Bodenschutzmaßnahme der US Soil Conservation, die sich durch Face- to- Face- Kontakte wellenartig ausbreitete (Diffusion).
Doch bevor sich eine Innovation in Raum und Zeit ausbreiten kann, bedarf es einer Erfindung (Invention), die dem Innovationsprozess hervorgeht. Eine Erfindung kann zufällig oder durch Forschung und Entwicklung entstehen. Wird diese Erfindung erstmals in den Markt eingeführt, spricht man nun von einer Innovation. Anschließend muss sich diese Innovation auf dem Markt durchsetzen, das bedeutet es muss eine ausreichende Zahl an Adoptoren geben, Menschen oder Unternehmen, die diese Innovation übernehmen, damit man von einer Diffusion sprechen kann. Rückschläge kann der Innovationsprozess durch die Konkurrenz von Nachahmern erleiden, die ein ähnliches Produkt in den Markt einführen.
Nachdem nun die Begriffe Innovation, Diffusion, Innovationsprozess und Adoptoren definiert wurden, werde ich auf die Entwicklungsgeschichte der Innovations- und Diffusionsforschung, die bis ins 19. Jahrhundert hineinreicht, eingehen und einige bedeutende Vertreter erläutern, die zur Entwicklungsgeschichte beigetragen haben.
3. Entwicklungsgeschichte der Innovations- und Diffusionsforschung
Seit dem 19. Jahrhundert lässt sich eine große Zahl von geographischen Arbeiten/ Studien bezüglich der Innovations- und Diffusionsforschung zuordnen, sodass sich dieses Gebiet im Laufe der Jahre in der Humangeographie und in anderen Nachbarwissenschaften zu einem traditionellen Forschungsfeld entwickelt hat. Aus dieser Entwicklung lässt sich die Geschichte der Innovations- und Diffusionsforschung in vier Phasen gliedern [Windhorst, 1983: 5].
Ethnographische Phase:
Die erste Phase der Entwicklungsgeschichte lässt sich mit dem Namen Friedrich RATZEL verbinden, der sich mit seinem Werk „Anthropogeographie“ (1981) einen bedeutenden Namen in der Innovations- und Diffusionsforschung gesetzt hat. In seiner Arbeit geht es um die Erfassung von Kulturräumen und die Ausbreitung von Kulturelementen, das bedeutet, für Ratzel steht der Mensch im Mittelpunkt und nicht etwa Prozesse der Aufnahme, Entscheidungen und Ausbreitungsmechanismen.
Ein weiterer Vertreter der Ethnographischen Phase war Gabriel TARDE mit seiner Arbeit „The Laws of Imitation“ (1895). Auch er trug wesentlich zur Entwicklungsgeschichte bei, denn er schilderte erstmals das Bild der wellenförmigen Ausbreitung einer Neuerung (Innovation). Spricht man von einer wellenförmigen Ausbreitung, bedeutet das, dass sich eine Innovation um ein Zentrum herum vergrößert, also nach außen strebt, man nennt dies auch den zentrifugalen Effekt [Windhorts, 1983: 6].
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Invention und Innovation?
Eine Invention ist die bloße Erfindung; eine Innovation liegt erst vor, wenn dieses neue Wissen oder Produkt erfolgreich in den Markt eingeführt wird.
Wie verbreiten sich Innovationen räumlich?
Die Diffusion erfolgt oft wellenartig um ein Zentrum herum, was auch als zentrifugaler Effekt bezeichnet wird.
Was besagt das Diffusionsmodell nach Hägerstrand?
Torsten Hägerstrand entwickelte Modelle, die den Diffusionsprozess in Raum und Zeit durch Kontaktfelder und Informationsaustausch erklären.
Welche Faktoren beeinflussen die Annahme einer Neuerung?
Wichtige Faktoren sind die Kompatibilität mit bestehenden Werten, das individuelle Bedürfnis und die Verifizierung der Erwartungen (Lohnt es sich?).
Was sind Adoptoren im Diffusionsprozess?
Adoptoren sind Individuen oder Unternehmen, die eine Innovation übernehmen und so zu deren Ausbreitung beitragen.
- Quote paper
- Martina Oswald (Author), 2008, Innovation und Diffusion: Geographische Basiskonzepte und ihre Anwendung in der Kulturgeographie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137902