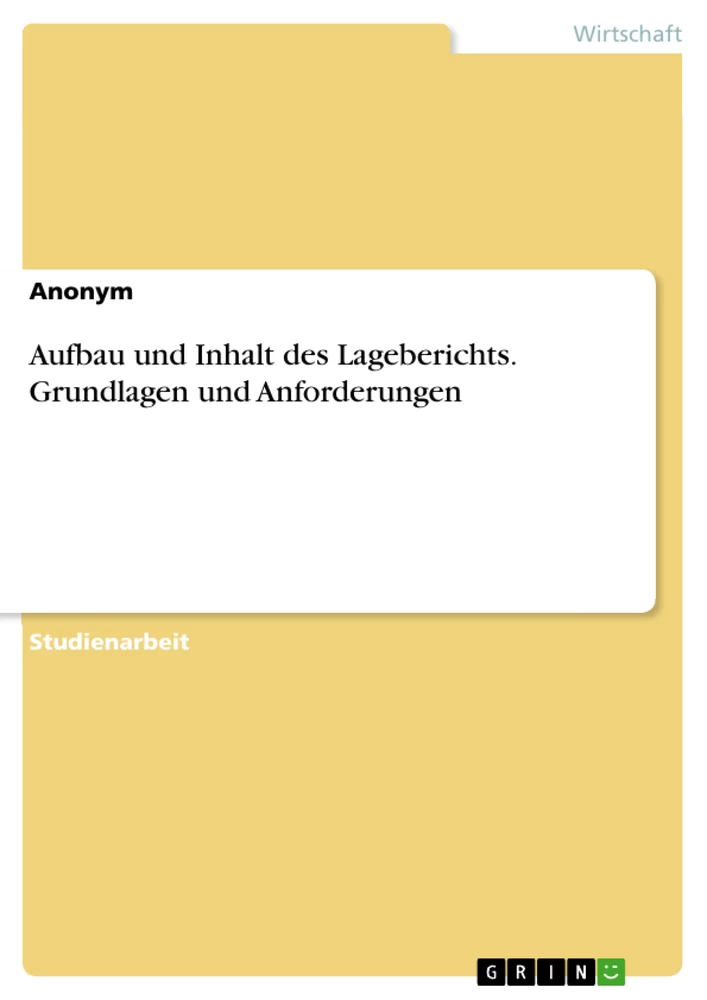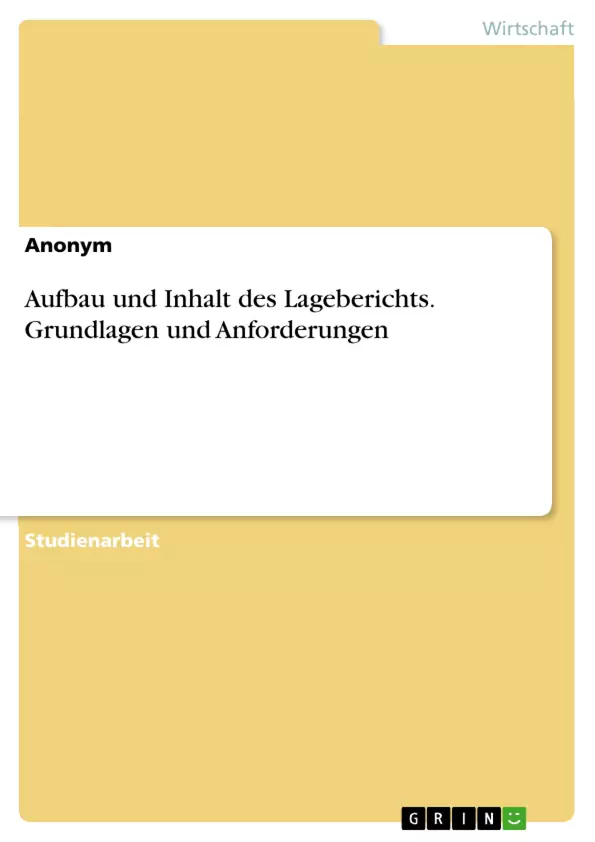Das Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit besteht darin, den Inhalt des Lageberichts zu erläutern und ein besseres Verständnis für die Funktion des Berichts zu vermitteln. Zudem sollen die Vorgaben des Handelsgesetzbuchs und des Deutschen Rechnungslegung Standards Committee (kurz DRSC) bezüglich des Lageberichts verständlich gemacht werden.
Durch die Gegenüberstellung der deutschen gesetzlichen Vorschriften für den Lagebericht mit dem freiwillig zu erstellenden Management Commentary gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS) sollen die wesentlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Aufstellungspflicht und der inhaltlichen Ausrichtung aufgezeigt werden. Mit einer abschließenden kritischen Stellungnahme gilt zu klären, ob die Lageberichterstattung ein realistisches Bild der tatsächlichen wirtschaftlichen Lage aufzeigen kann.
In dieser Ausarbeitung werden zunächst auf die Grundlagen des Lageberichts beleuchtet und in diesem Zusammenhang der Begriff der „wirtschaftlichen Lage" sowie wichtige Funktionen des Berichts definiert. Im weiteren Verlauf werden die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Qualität und des Umfangs genannt. Hierbei wird auf die Grundsätze des DRSC eingegangen. Weiterhin werden die Regelungen des Handelsgesetzbuchs mit den Regelungen nach IFRS verglichen. Dabei wird insbesondere auf die angesprochenen Adressaten, die Inhalte sowie deren Vergleichbarkeit zwischen den Unternehmen geachtet.
Im Anschluss wird sich den Inhalten des Lageberichts zugewandt. Zu den inhaltlichen Angaben gehören beispielsweise die Angaben zu Geschäftsentwicklung, Risikolage, Mitarbeiterzahl, Umweltaspekte sowie den wesentlichen Chancen und Risiken des Unternehmens. Die gesetzliche Aufstellungspflicht des Lageberichts findet, sofern es für den Kontext erforderlich ist, eine Erwähnung. Schließlich erfolgt eine kritische Stellungnahme zum Erfolg des Lageberichts als Instrument der externen Rechnungslegung.
Lageberichte sind für Unternehmen ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensberichterstattung und ein Werkzeug zur Vermittlung von Informationen an die Bilanzadressaten. Angesichts der Komplexität und Dynamik von Unternehmen und Marktumfeldern werden die Vorschriften für die externe Rechnungslegung kontinuierlich weiterentwickelt, um eine Anpassung
an sich ändernde Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Der Lagebericht gibt einen Überblick über die aktuelle Lage sowie die zukünftigen Entwicklungen eines Unternehmens.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Relevanz des Themas
- 1.2 Ziel der Arbeit
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2. Grundlagen des Lageberichts
- 3. Anforderungen an den Lagebericht
- 3.1 Handelsrechtliche Vorschriften
- 3.2 Gesetzliche inhaltliche Mindestanforderung
- 3.3 Deutscher Rechnungslegungsstandard (kurz DRS)
- 3.4 Analogie HGB zu Management Commentary nach IFRS
- 4. Aufbau und Inhalte des Lageberichts
- 4.1 Wirtschaftsbericht
- 4.2 Prognose- Chancen und Risikobericht
- 4.3 Verwendung von Finanzinstrumenten
- 4.4 Bericht über Forschungs- und Entwicklungsbericht
- 4.5 Zweigniederlassungsbericht
- 4.6 Nichtfinanzielle Erklärung
- 4.7 Weitere Berichte für kapitalmarktorientierte Unternehmen
- 5. Kritische Stellungnahme zum Erfolg des Lageberichts
- 6. Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, den Inhalt des Lageberichts zu erklären und ein tieferes Verständnis für seine Funktion zu vermitteln. Sie untersucht die Vorgaben des Handelsgesetzbuchs und des Deutschen Rechnungslegung Standards Committee (DRSC) bezüglich des Lageberichts und stellt diese den freiwillig zu erstellenden Management Commentary gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS) gegenüber. Darüber hinaus wird die Frage geklärt, ob die Lageberichterstattung ein realistisches Bild der tatsächlichen wirtschaftlichen Lage widerspiegeln kann.
- Die Relevanz des Lageberichts als Instrument der Unternehmensberichterstattung
- Die gesetzlichen Anforderungen an den Lagebericht nach HGB und DRSC
- Der Vergleich des Lageberichts mit dem Management Commentary nach IFRS
- Die Inhalte des Lageberichts und deren Aussagekraft
- Die Kritikfähigkeit des Lageberichts als Instrument der externen Rechnungslegung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Relevanz des Lageberichts für Unternehmen und erläutert die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 definiert die Grundlagen des Lageberichts, wobei der Begriff der „wirtschaftlichen Lage" und wichtige Funktionen des Berichts im Fokus stehen. Kapitel 3 widmet sich den gesetzlichen Anforderungen an den Lagebericht, insbesondere den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs und des DRSC. Darüber hinaus werden die Regelungen des HGB mit den Regelungen nach IFRS verglichen, wobei die angesprochenen Adressaten, die Inhalte und deren Vergleichbarkeit zwischen den Unternehmen im Vordergrund stehen.
Kapitel 4 befasst sich mit dem Aufbau und den Inhalten des Lageberichts, darunter die Angaben zu Geschäftsentwicklung, Risikolage, Mitarbeiterzahl, Umweltaspekte sowie den wesentlichen Chancen und Risiken des Unternehmens. Die gesetzliche Aufstellungspflicht des Lageberichts findet, sofern es für den Kontext erforderlich ist, eine Erwähnung. Abschließend erfolgt in Kapitel 5 eine kritische Stellungnahme zum Erfolg des Lageberichts als Instrument der externen Rechnungslegung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den wichtigsten Aspekten des Lageberichts, darunter die gesetzliche Regulierung durch das Handelsgesetzbuch und den Deutschen Rechnungslegungsstandard (DRS), die Anforderungen an den Inhalt und die Struktur des Berichts, sowie die Vergleichbarkeit mit dem Management Commentary nach IFRS. Wichtige Themen sind die Vermittlung von Informationen an Bilanzadressaten, die Darstellung der wirtschaftlichen Lage eines Unternehmens, die Transparenz und Nachhaltigkeit der Unternehmensberichterstattung sowie die Kritikfähigkeit des Lageberichts als Instrument der externen Rechnungslegung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Lagebericht?
Ein Lagebericht ergänzt den Jahresabschluss und gibt einen Überblick über den Geschäftsverlauf, die Lage des Unternehmens sowie die voraussichtliche Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken.
Was ist der Unterschied zwischen HGB und IFRS beim Lagebericht?
Nach HGB ist der Lagebericht gesetzlich vorgeschrieben, während der „Management Commentary“ nach IFRS eine freiwillige Ergänzung darstellt, die jedoch ähnliche Informationsziele verfolgt.
Welche Mindestinhalte muss ein Lagebericht enthalten?
Dazu gehören der Wirtschaftsbericht, der Prognosebericht, der Chancen- und Risikobericht sowie Angaben zu Forschung, Entwicklung und Zweigniederlassungen.
Was ist die „Nichtfinanzielle Erklärung“?
Sie enthält Informationen zu Umweltbelangen, Arbeitnehmerfragen, Sozialbelangen, Menschenrechten und Korruptionsbekämpfung im Rahmen der Unternehmensberichterstattung.
Was prüft der Deutsche Rechnungslegungsstandard (DRS)?
Der DRS (insb. DRS 20) konkretisiert die gesetzlichen Anforderungen des HGB, um eine hohe Qualität und Vergleichbarkeit der Lageberichte sicherzustellen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2023, Aufbau und Inhalt des Lageberichts. Grundlagen und Anforderungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1379932