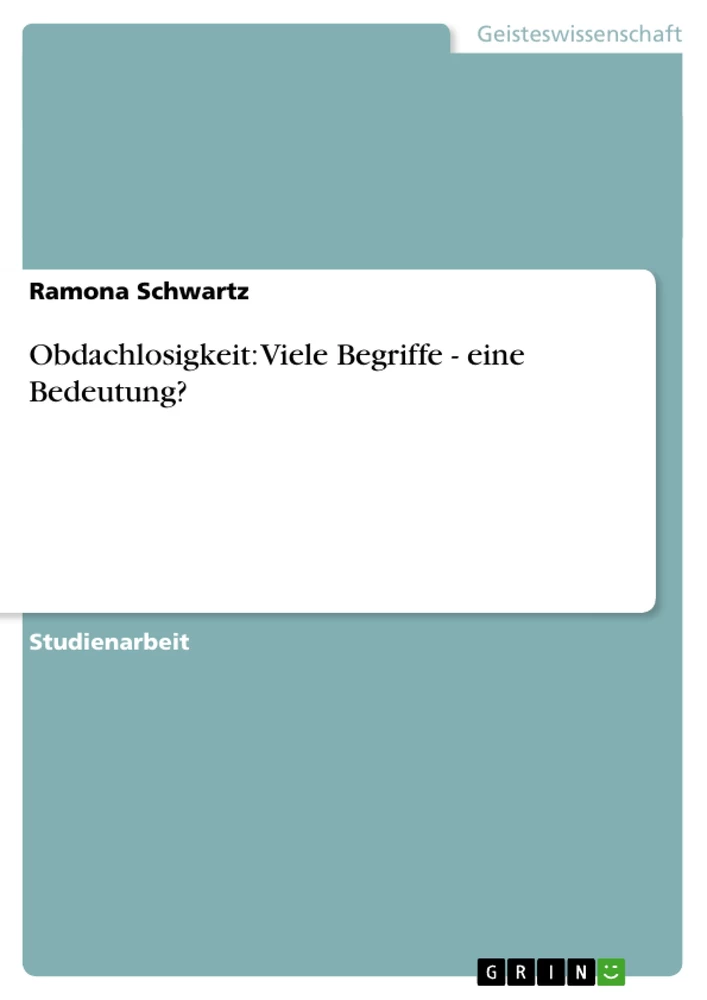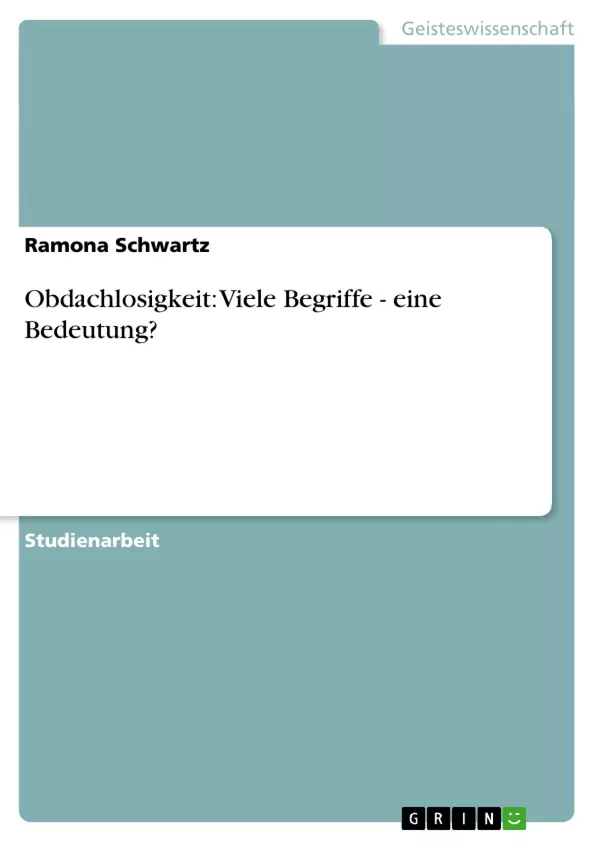Wenn man von Wohnungslosigkeit spricht, dann weiß jeder etwas damit anzufangen. Nicht zuletzt deswegen, weil wir – meiner Meinung nach zumindest in den Großstädten - jeden Tag Erfahrungen damit machen. Und sei es nur, dass wir durch die Straßen gehen, voll bepackt mit Einkaufstüten, einem Lächeln auf den Lippen und an der nächsten Ecke strecken uns plötzlich zwei schmutzige Hände entgegen, ein trauriger Blick bittet uns etwas Kleingeld da zulassen. Manch einer von uns erbarmt sich, die meisten hingegen gehen weiter und denken sich: selber Schuld! Professor Dr. Faust hat es passend formuliert: „Und weil wir wissen, dass in eben dieser unserer Zeit und Gesellschaft niemand als „Bettler“ oder „Stadt- bzw. Landstreicher“ geboren wird, müssen wir auch mit der Erkenntnis fertig werden: Hier steht offenbar ein trauriges Schicksal dahinter“. In diesem schlichten Satz steckt die geheime Erkenntnis dessen, was wir wirklich tun, nämlich solche Gedanken schnell wieder zu vergessen. Dabei ist das Problem der Wohnungslosigkeit ein altbekanntes wie aktuelles Problem.
Seit der zweiten Hälfte der neunziger Jahre hat sich das Interesse an Wohnungslosen, auch in Verbindung mit psychischen Erkrankungen, wieder verstärkt. Im Jahr 2000 beispielsweise lebten ca. 500.000 Menschen (nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe) ohne eine eigene, gesicherte Wohnung. Darunter waren 170.000 allein stehende Menschen zwischen Straße und Notunterkunft oder im Hilfesystem sowie 24.000 auf der Straße.
Diese Hausarbeit soll keine Lösungsvorschläge liefern, sondern lediglich einen groben Ein- und Überblick in die Problematik und vor allem die Vielfältigkeit der Begrifflichkeiten geben. Fragen die ich mir dabei stelle sind unter anderem die, was sich eigentlich genau hinter dem Wort Wohnungslosigkeit verbirgt, welche Unterscheidungen es hinsichtlich der unterschiedlichen Begrifflichkeiten gibt und wer eigentlich davon betroffen ist.
Inhaltsverzeichnis
1 Obdachlosigkeit- eine Einführung in das Thema
2 Viele Begriffe- eine Bedeutung?
2.1 Obdachlosigkeit/Wohnungslosigkeit
2.2 Nichtsesshafte
2.3 Forschungsergebnisse
3. Wer ist betroffen?
3.1 Wohnungslosigkeit bei Frauen
4 Resümee
5. Literaturnachweis
1 Obdachlosigkeit- eine Einführung in das Thema
Sie gehören zum Erscheinungsbild einer jeden Stadt und jeder kennt sie: die Wohnungslosen/Obdachlosen. Für sie gibt es viele Worte, wie zum Beispiel Penner, arbeitsscheue Nichtsesshafte, Bettler und Landstreicher sind mitunter die gängigsten. Heutzutage ist der Begriff Obdachlosigkeit allerdings nicht mehr so gebräuchlich, da er eine abwertende Haltung zum Ausdruck bringt. Ersetzt wird die Obdachlosigkeit durch den Begriff der Wohnungslosigkeit. In meiner Arbeit werde ich diesen Ausdruck benutzen, allerdings nicht in den Zitaten die teilweise von früher stammen, in der diese Thematik noch nicht zur Sprache kam.
Wenn man von Wohnungslosigkeit spricht, dann weiß jeder etwas damit anzufangen. Nicht zuletzt deswegen, weil wir –meiner Meinung nach zumindest in den Großstädten- jeden Tag Erfahrungen damit machen. Und sei es nur, dass wir durch die Straßen gehen, voll bepackt mit Einkaufstüten, einem Lächeln auf den Lippen und an der nächsten Ecke strecken uns plötzlich zwei schmutzige Hände entgegen, ein trauriger Blick bittet uns etwas Kleingeld da zulassen. Manch einer von uns erbarmt sich, die meisten hingegen gehen weiter und denken sich: selber Schuld! Professor Dr. Faust hat es passend formuliert: „Und weil wir wissen, dass in eben dieser unserer Zeit und Gesellschaft niemand als „Bettler“ oder „Stadt- bzw. Landstreicher“ geboren wird, müssen wir auch mit der Erkenntnis fertig werden: Hier steht offenbar ein trauriges Schicksal dahinter“ (Faust, 16.04.09, S.2). In diesem schlichten Satz steckt die geheime Erkenntnis dessen, was wir wirklich tun, nämlich solche Gedanken schnell wieder zu vergessen. Dabei ist das Problem der Wohnungslosigkeit ein altbekanntes wie aktuelles Problem. Seit der zweiten Hälfte der neunziger Jahre hat sich das Interesse an Wohnungslosen, auch in Verbindung mit psychischen Erkrankungen, wieder verstärkt. Im Jahr 2000 beispielsweise lebten ca. 500.000 Menschen (nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe) ohne eine eigene, gesicherte Wohnung. Darunter waren 170.000 allein stehende Menschen zwischen Straße und Notunterkunft oder im Hilfesystem sowie 24.000 auf der Straße (vgl. Faust, 16.04.09).
Diese Hausarbeit soll keine Lösungsvorschläge liefern, sondern lediglich einen groben Ein- und Überblick in die Problematik und vor allem die Vielfältigkeit der Begrifflichkeiten geben. Fragen die ich mir dabei stelle sind unter anderem die, was sich eigentlich genau hinter dem Wort Wohnungslosigkeit verbirgt, welche Unterscheidungen es hinsichtlich der unterschiedlichen Begrifflichkeiten gibt und wer eigentlich davon betroffen ist.
2 Viele Begriffe- eine Bedeutung?
Wenn man sich mit der Thematik der Obdachlosigkeit/Wohnungslosigkeit auseinandersetzt geht man nicht umhin sich näher mit den Begriffen, die die Obdachlosigkeit/Wohnungslosigkeit beschreiben, auseinander zu setzen. Dabei wird man relativ schnell feststellen, dass es in diesem Bereich sehr viele Begriffe gibt unter denen man im allgemeinen Sprachgebrauch etwas anderes versteht als unter ihrer eigentlichen fachlichen Bedeutung. Folglich ist es also zwingend notwendig, die fachlichen Bedeutungen der unterschiedlichen Begriffe zu kennen.
Laut Holtmannspötter ist gerade das aber nicht so einfach, da es keine allgemeingültigen und vor allem von allen Fachleuten anerkannten Begriffe und Definitionen zur Beschreibung von Menschen gibt, die über keinen Wohnraum verfügen. So unterscheiden sich allein schon die Begriffe „obdachlos“, „wohnungslos“ und „nichtsesshaft“ grundlegend voneinander. Wichtig sind solche Unterscheidungen zum Beispiel auch für Gemeinden, denn der Grad der Hilfe die sie anbieten ist stark abhängig von der Einstufung der Betroffenen. Je nach Zuordnung werden andere Maßnahmen angewendet (vgl. Holtmannspötter, 2002).
Meine kommenden Ausführungen beschäftigen sich mit der Erklärung einiger prägnanter Begriffe und deren Abgrenzung zu anderen ebenfalls wichtigen Begrifflichkeiten.
2.1 Obdachlosigkeit/Wohnungslosigkeit
Die Begriffe der Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit haben wir alle schon einmal gehört, doch die fachliche Unterscheidung wissen nur die Wenigsten. Eine Definition für den Begriff „obdachlos“ die bundesweit verwendet werden kann, stammt von der bayrischen Empfehlung für das Obdachlosenwesen. Demnach wird jemand als obdachlos eingestuft, der
- „akut keine Unterkunft hat (Fallgruppe eins)
- vom Verlust einer gegenwärtigen Unterkunft bedroht ist (Fallgruppe zwei)
- lediglich eine menschenunwürdige Unterkunft hat (Fallgruppe drei)“ (BVS,2006, S.20)
Fallgruppe eins tritt nicht all zu häufig in Erscheinung. Als typisches Beispiel sind hier Jugendliche im Alter zwischen 18 und 25 Jahren zu nennen die aus ihrem Elternhaus, meist unfreiwillig, ausgezogen sind. Am häufigsten findet sich die Fallgruppe zwei wieder. Sie tritt dann in Erscheinung, wenn die Miete nicht mehr bezahlt werden kann und der Vermieter Anklage erhebt die mit einer anschließenden Zwangsräumung verbunden sein kann.
Am seltensten findet sich die Fallgruppe drei. Unter menschenunwürdige Unterkunft versteht man in der Regel Bedingungen die der Gesundheit schaden und nicht zumutbar sind. Diese Gruppe kann aber unter Umständen auch Personen treffen, die im Leben nicht daran gedacht hätten irgendwann einmal obdachlos zu werden. Das kann zum Beispiel dann passieren, wenn in einer Wohnung plötzlich eine Asbestvergiftung auftaucht und geräumt werden muss.
[...]
- Quote paper
- Ramona Schwartz (Author), 2009, Obdachlosigkeit: Viele Begriffe - eine Bedeutung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138031