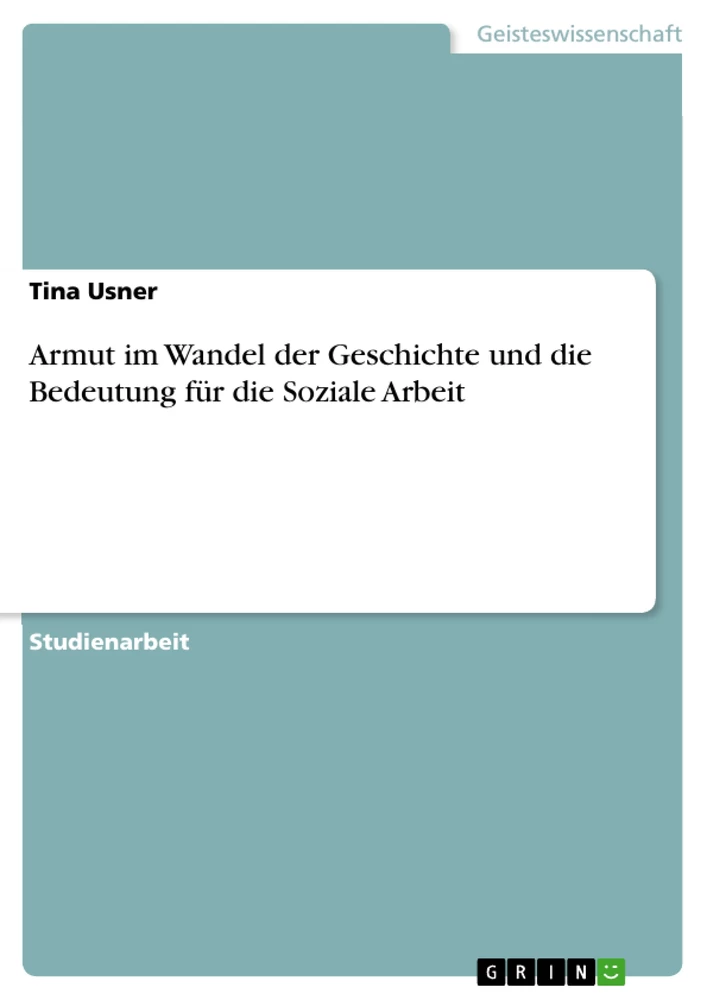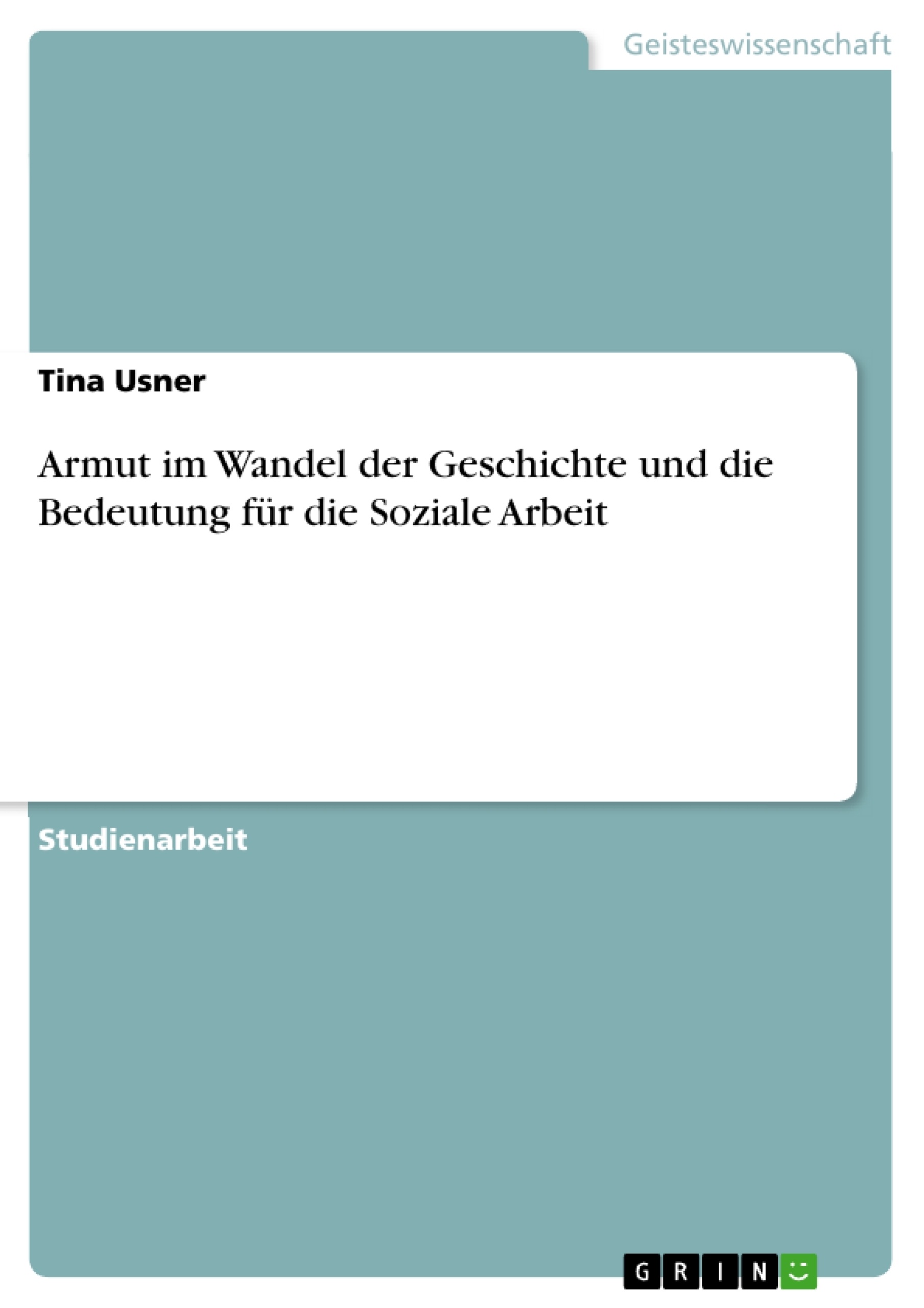Zu dem Begriff der Armut kann nahezu jeder Menschen einen Bezug herstellen, sei es eine rein kognitive oder aus eigenen Erfahrungen abgeleitete Bezugsnahme So assoziiert man all zu häufig mit diesem Wort Bilder von stark abgemagerten Menschen aus Ländern der Dritten Welt oder man hat die Vorstellung von Kindern vor Augen, die in Slums „Essbares“ auf Mülldeponien suchen und stark verwahrlost aussehen. Doch müssen wir, um Armut zu erfahren, nicht über die Grenzen unseres Landes hinweg schauen, denn auch hier in Deutschland war sie in der Vergangenheit immer wieder Thema und ist es auch heute noch. Zwar kann die Armut der Dritte Welt Länder nicht unbedingt mit jener in Deutschland als konvergent angesehen werden, da unterschiedliche Bedingungen bestehen und das Verständnis von Armut von Gesellschaft zu Gesellschaft ein differenziertes ist. Dennoch ergeben sich auch für die hier in Deutschland lebenden Menschen häufig Lebensumstände am Existenzminimum.
Grundsätzlich kann Armut als Zustand angesehen werden, der in allen Epochen zu finden ist. Schon immer gab es Momente, in denen Menschen mit existenzwidrigen Umständen, wie Hungersnöten bedingt durch spärliche Ernten und Massenelend zu kämpfen hatten. Doch haben sich mit der Zeit immer wieder gesellschaftliche Änderungen im Umgang mit der Problematik der Armut ergeben. Das soziale Bewusstsein von Not und die Abhilfe von dieser haben sich daher unter temporären Aspekten stets gewandelt. Verfolgte man im Mittelalter zunächst noch die Intention, die Armen durch Almosen im Sinne der Nächstenliebe und Barmherzigkeit zu unterstützen und sah man die Armut als gottgewolltes Schicksal an, so wandelte sich der Umgang mit den Armen im Spätmittelalter. Armut wurde fortan als subjektiv zugeschrieben verstanden und Unterstützung erhielt nur noch derjenige, der dieser auch würdig war (Kranke, Behinderte…).
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- 1. Verständnis von und Umgang mit Armut im Laufe der Historie - vom frühen Mittelalter bis heute
- 1.1. Mittelalter
- 1.1.1. Formen der Armenfürsorge im Mittelalter
- 1.1.2. Franz von Assisi und die freiwillige Armut
- 1.2. Das späte Mittelalter
- 1.3. Neuzeit
- 1.4. Industrialisierung
- 1.5. Preußisches Landrecht und Elberfelder System
- 1.5.1. Heimatsprinzip und Unterstützungswohnsitz
- 1.5.2 Elberfelder System
- 1.6. Bismarck
- 1.7 NS-Zeit
- 2. Armut in der Gegenwart
- 2.1 Definitionen von Armut
- 2.1.1. Vier Formen der Armut
- 2.1.1.1. absolute Armut
- 2.1.1.2. relative Armut
- 2.1.1.3. subjektive Armut
- 2.1.1.4. politische Armut
- 2.2. Risikogruppen in Deutschland
- 2.2.1. Die Gruppe der Arbeitslosen
- 2.3. Ursachen der Armut
- 2.3.1 Ansatz Kardorff und Oppl
- 2.3.3. Verdeckte Armut
- 3. Bedeutung für die Soziale Arbeit
- 3.1. Theorien der Armutsforschung
- 3.1.1. Townsend, „soziale Deprivation“
- 3.1.2. Lebenslagenkonzept von Neurath bzw. Weisser
- 3.1.3. Das Pentagon der Armut nach Tschümperlin
- 3.2. Armut als sozialarbeiterische Problemstellung
- 3.3. Das Armutsverständnis der Sozialen Arbeit
- II Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die historische Entwicklung des Armutsverständnisses und dessen Bedeutung für die Soziale Arbeit. Ziel ist es, den Wandel im Umgang mit Armut von Mittelalter bis in die Gegenwart aufzuzeigen und die daraus resultierenden Herausforderungen für die Soziale Arbeit zu beleuchten.
- Historischer Wandel des Armutsverständnisses
- Definitionen und Formen von Armut
- Risikogruppen und Ursachen von Armut in der Gegenwart
- Theorien der Armutsforschung
- Handlungsauftrag der Sozialen Arbeit im Kontext von Armut
Zusammenfassung der Kapitel
1. Verständnis von und Umgang mit Armut im Laufe der Historie - vom frühen Mittelalter bis heute: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Entwicklung des Verständnisses und des Umgangs mit Armut von den Anfängen des Mittelalters bis in die Gegenwart. Es wird der Wandel von der karitativen Armenfürsorge des frühen Mittelalters, geprägt von religiösen Motiven und der Vorstellung von Armut als gottgegebenem Schicksal, bis hin zu komplexeren Ansätzen der Armutsbekämpfung in der Neuzeit nachgezeichnet. Die Rolle der Kirche, die Entwicklung des Elberfelder Systems und die Auswirkungen von politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen wie der Industrialisierung und den Weltkriegen auf das Armutsverständnis und die sozialen Maßnahmen werden detailliert beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Veränderung der sozialen Normen und des moralischen Umgangs mit Armut im Laufe der Zeit.
2. Armut in der Gegenwart: Dieses Kapitel widmet sich der aktuellen Situation von Armut in Deutschland. Es werden verschiedene Definitionen von Armut (absolute, relative, subjektive, politische Armut) vorgestellt und ihre Anwendung in der Praxis diskutiert. Es werden Risikogruppen identifiziert, darunter Arbeitslose und Familien mit Migrationshintergrund, und die Ursachen von Armut anhand von soziologischen Ansätzen analysiert. Der Begriff der „verdeckten Armut“ wird erläutert und seine Bedeutung hervorgehoben. Das Kapitel bietet eine aktuelle Bestandsaufnahme der Armutsproblematik in Deutschland und legt den Grundstein für die folgenden Kapitel über die Rolle der Sozialen Arbeit.
3. Bedeutung für die Soziale Arbeit: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Bedeutung von Armut für die Soziale Arbeit. Es werden relevante Theorien der Armutsforschung (Townsend, Neurath/Weisser, Tschümperlin) vorgestellt und ihre unterschiedlichen Perspektiven auf Armut diskutiert. Das Kapitel erläutert den Handlungsauftrag der Sozialen Arbeit im Umgang mit Armut und zeigt auf, wie Soziale Arbeit intervenieren kann und welche Orientierungsrahmen ihr zur Verfügung stehen. Es verdeutlicht die Komplexität der Armutsproblematik und die Notwendigkeit, multiperspektivisch vorzugehen.
Schlüsselwörter
Armut, Soziale Arbeit, Armutsforschung, Armutsbekämpfung, historische Entwicklung, Mittelalter, Neuzeit, Industrialisierung, Risikogruppen, Definitionen von Armut, Theorien der Armutsbekämpfung, soziale Deprivation, Lebenslagenkonzept, Handlungsauftrag.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Armut - Historische Entwicklung und Bedeutung für die Soziale Arbeit
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die historische Entwicklung des Armutsverständnisses und dessen Bedeutung für die Soziale Arbeit. Sie beleuchtet den Wandel im Umgang mit Armut vom Mittelalter bis in die Gegenwart und die daraus resultierenden Herausforderungen für die Soziale Arbeit. Die Arbeit umfasst eine historische Betrachtung der Armut, Definitionen und Formen von Armut, Risikogruppen und Ursachen von Armut in der Gegenwart sowie relevante Theorien der Armutsforschung und den daraus resultierenden Handlungsauftrag der Sozialen Arbeit.
Welche historischen Phasen der Armut werden behandelt?
Die Hausarbeit betrachtet die Entwicklung des Umgangs mit Armut vom Mittelalter (frühes und spätes Mittelalter, inklusive der Rolle von Franz von Assisi), über die Neuzeit, die Industrialisierung, das preußische Landrecht und das Elberfelder System, die Bismarck-Zeit und die NS-Zeit bis hin zur Gegenwart. Der Fokus liegt auf dem Wandel des Verständnisses von Armut und den jeweiligen sozialen Maßnahmen.
Wie werden Armut und ihre Formen definiert?
Die Hausarbeit differenziert zwischen verschiedenen Definitionen von Armut: absolute Armut, relative Armut, subjektive Armut und politische Armut. Diese Definitionen werden erläutert und ihre Anwendung in der Praxis diskutiert.
Welche Risikogruppen und Ursachen von Armut werden in der Gegenwart betrachtet?
Die Arbeit identifiziert Risikogruppen wie Arbeitslose und Familien mit Migrationshintergrund. Die Ursachen von Armut werden anhand soziologischer Ansätze analysiert, und der Begriff der „verdeckten Armut“ wird erläutert.
Welche Theorien der Armutsforschung werden vorgestellt?
Die Hausarbeit präsentiert und diskutiert verschiedene Theorien der Armutsforschung, darunter das Konzept der „sozialen Deprivation“ nach Townsend, das Lebenslagenkonzept von Neurath/Weisser und das Pentagon der Armut nach Tschümperlin. Die unterschiedlichen Perspektiven dieser Theorien auf Armut werden verglichen.
Welche Bedeutung hat Armut für die Soziale Arbeit?
Die Hausarbeit erläutert den Handlungsauftrag der Sozialen Arbeit im Umgang mit Armut und zeigt auf, wie Soziale Arbeit intervenieren kann und welche Orientierungsrahmen ihr zur Verfügung stehen. Die Komplexität der Armutsproblematik und die Notwendigkeit eines multiperspektivischen Vorgehens werden hervorgehoben.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit ist in drei Hauptkapitel gegliedert: Kapitel 1 behandelt das Verständnis und den Umgang mit Armut im Laufe der Geschichte, Kapitel 2 widmet sich Armut in der Gegenwart und Kapitel 3 diskutiert die Bedeutung von Armut für die Soziale Arbeit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Armut, Soziale Arbeit, Armutsforschung, Armutsbekämpfung, historische Entwicklung, Mittelalter, Neuzeit, Industrialisierung, Risikogruppen, Definitionen von Armut, Theorien der Armutsbekämpfung, soziale Deprivation, Lebenslagenkonzept, Handlungsauftrag.
- Citar trabajo
- Tina Usner (Autor), 2008, Armut im Wandel der Geschichte und die Bedeutung für die Soziale Arbeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138082