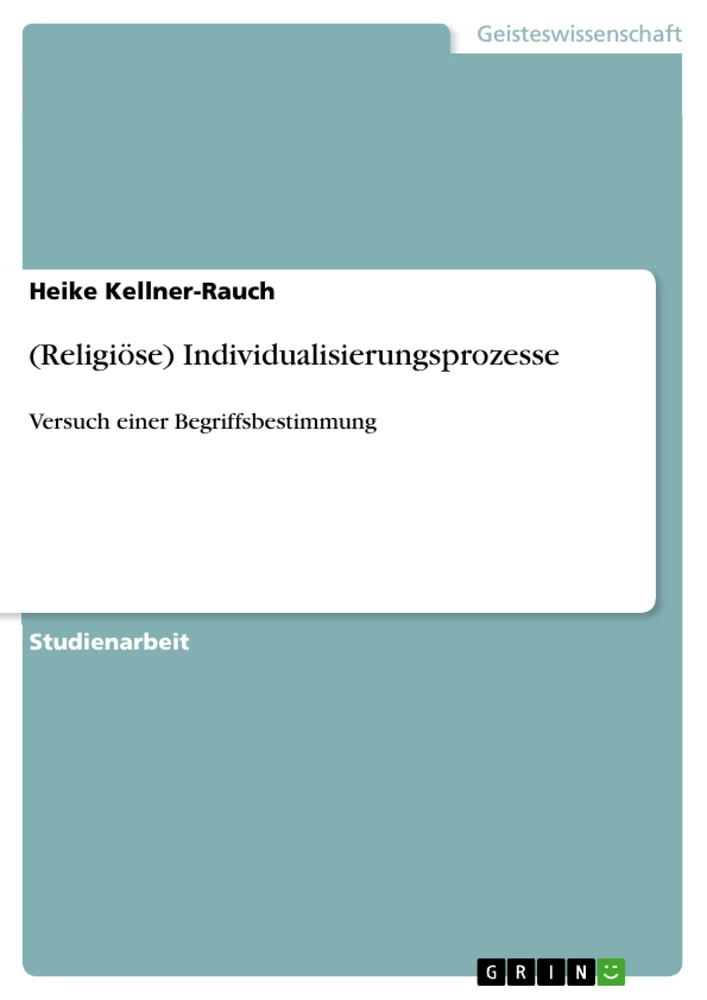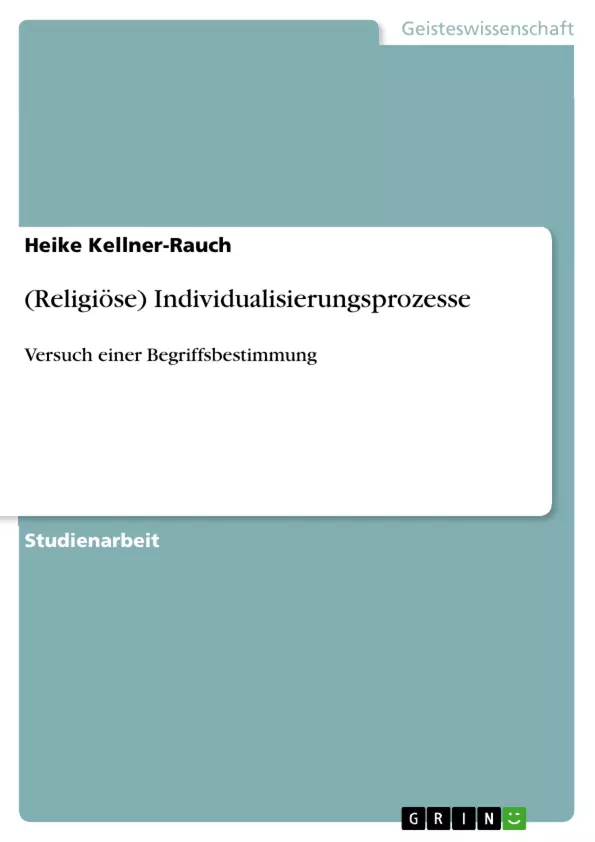1 Klärung der Problemstellung. Eingrenzung. Erkenntnisinteresse
„Individualisierung“ ist ein vielschichtiger und immer zwiespältiger Begriff, der
begrifflich nicht klar gefasst ist. Was verbirgt sich hinter diesem vielgebrauchten
Begriff, der nicht zuletzt durch die Veröffentlichungen Becks (Jenseits von Stand und
Klasse 1983; Risikogesellschaft 1986; Riskante Freiheiten 1994) eine heftige Debatte
ausgelöst hat? Welches Phänomen wird mit diesem soziologischen Konzept
beschreiben? Welche Entwicklungsgeschichte hat das soziologische Konzept von der
Individualisierung? Diese Arbeit unternimmt den Versuch, greifbar zu machen, was mit
„Individualisierung“ und der Rede von der „individualisierten Gesellschaft“ gemeint ist.
Das ist ein waghalsiges Unterfangen, weist u.a. EBERS 1995, 21 darauf hin, dass die
„mit dem Konzept „Individualisierung“ beschriebenen Phänomene variieren,
unterschiedlichste Erklärungs- und Deutemuster (...) für die Herleitung des fraglichen
Entwicklungsprozesses herangezogen (werden und) die Ebenen in der Beschreibung
und Erklärung von „Individualisierung“ divergieren. Der Begriff bleibt unscharf und
vielseitig verwendbar“. Eingedenk dieser ernüchternden Diagnose möchte ich, nach der
Darstellung einer knappen Abgrenzung und dem Entwurf einer „Minimaldefinition“ des
Begriffs, durch die Darstellung „realgeschichtlicher“ Eckpunkte der in der Literatur
beschriebenen Individualisierungsschübe und den Rückgriff auf die klassische
Perspektiven Simmels u.a eine Basis für ein Verständnis des Begriffs
„Individualisierung“ schaffen. Im Weiteren gehe ich der Frage nach, was die
Begrifflichkeit der „religiösen Individualisierung“ meint und inwieweit diese
Terminologie dienlich ist, Erscheinungsformen von Religiosität der Gegenwart
darzustellen und zu deuten.
[...]
Gliederung
1 Klärung der Problemstellung. Eingrenzung. Erkenntnisinteresse
2. Begriffsklärung
2.1 Abgrenzung
2.2 Minimaldefinition
2.3 Realgeschichtliche Eckpunkte des Individualisierungsprozesses: Was hat den Wandel im Verhältnis von Individuum und Gesellschaft bedingt?
2.4 Innehalten: Ambivalenz des Individualisierungsbegriffs
3. Konzepte des Individualisierungstheorems
3.1 Die soziologischen Klassiker
3.1.1 Individualisierung bei Max Weber (1864 – 1920)
3.1.2 Individualisierung bei Durkheim (1858-1917)
3.1.3 Individualisierung bei Georg Simmel (1858 -1918)
3.1.4 Norbert Elias (1897 – 1990)
3.2 Theoriebildung der Gegenwart
3.2.1 Ulrich Beck (geb. 1944): Chance und Risiko
3.2.2 Niklas Luhmann (1927-1998): Individualisierung als Folge zunehmender Komplexität und Autonomisierung sozialer Systeme
3.3. Zur Kritik an der Individualisierungsthese. Vorschlag zur Verfahrensweise
4. Versuch einer handhabbaren Begriffsbestimmung:
4.1 Individuelle Rollenkombinationen
4.2 Auseinanderfallen der Lebensbereiche
4.3 Aufgabe der Weltdeutung verbleibt beim Einzelnen
4.4 Ambivalenter Bewusstseinszustand der Moderne
4.5 Veränderte Handlungsorientierung der individualisierten Akteure
4.6 Privatisierte Verantwortung
5. Religiöse Individualisierung
Literatur
1 Klärung der Problemstellung. Eingrenzung. Erkenntnisinteresse
„Individualisierung“ ist ein vielschichtiger und immer zwiespältiger Begriff, der begrifflich nicht klar gefasst ist. Was verbirgt sich hinter diesem vielgebrauchten Begriff, der nicht zuletzt durch die Veröffentlichungen Becks (Jenseits von Stand und Klasse 1983; Risikogesellschaft 1986; Riskante Freiheiten 1994) eine heftige Debatte ausgelöst hat? Welches Phänomen wird mit diesem soziologischen Konzept beschreiben? Welche Entwicklungsgeschichte hat das soziologische Konzept von der Individualisierung? Diese Arbeit unternimmt den Versuch, greifbar zu machen, was mit „Individualisierung“ und der Rede von der „individualisierten Gesellschaft“ gemeint ist.
Das ist ein waghalsiges Unterfangen, weist u.a. Ebers 1995, 21 darauf hin, dass die „mit dem Konzept „Individualisierung“ beschriebenen Phänomene variieren, unterschiedlichste Erklärungs- und Deutemuster (...) für die Herleitung des fraglichen Entwicklungsprozesses herangezogen (werden und) die Ebenen in der Beschreibung und Erklärung von „Individualisierung“ divergieren. Der Begriff bleibt unscharf und vielseitig verwendbar“. Eingedenk dieser ernüchternden Diagnose möchte ich, nach der Darstellung einer knappen Abgrenzung und dem Entwurf einer „Minimaldefinition“ des Begriffs, durch die Darstellung „realgeschichtlicher“ Eckpunkte der in der Literatur beschriebenen Individualisierungsschübe und den Rückgriff auf die klassische Perspektiven Simmels u.a eine Basis für ein Verständnis des Begriffs „Individualisierung“ schaffen. Im Weiteren gehe ich der Frage nach, was die Begrifflichkeit der „religiösen Individualisierung“ meint und inwieweit diese Terminologie dienlich ist, Erscheinungsformen von Religiosität der Gegenwart darzustellen und zu deuten.
2. Begriffsklärung
2.1 Abgrenzung
„Es ist schwer, Individualisierung (...)
nicht misszuverstehen.“
(Beck 2002, 227)
Mit dem soziologischen Begriff der Individualisierung ist weder der mit „Individuation“ benannte psychologische Prozess der Personwerdung und zunächst auch nicht die ideengeschichtliche Ausformung des Individualismus gemeint, der im Wesentlichen die Einzigartigkeit, die Eigenverantwortung, Selbst- bzw. Ichbewusstsein und Würde und die Autonomie des Menschen meint. Diese Eckpfeiler des modernen Menschenbildes (vgl. Ebers 1995, 34), die den Menschen als „souveränes Subjekt“ (ebd.) begreift, wurzelt in der griechischen Philosophie und wird in der jüdisch-christlichen Tradition im Konzept der Gottesebenbildlichkeit des Menschen, in der seine Einmaligkeit, seine Würde und sein freier Wille gründet, fortgeführt und zur Basis des europäisch-abendländischen Denkens. In seiner Bedeutung wiederentdeckt wird dieses Fundament im 15. Jahrhundert: „Die Renaissance markiert die Epoche, in der die Individuen beginnen, ein reflexives individuelles Bewußtsein zu entwickeln“ (Ebers 1995, 35). Die europäische Aufklärung nimmt diese Idee auf. Die Forderung Kants nach dem Mut sich seines eigenen Verstandes zu bedienen („Sapere aude“) und nach von der Religion losgelöster Ethik („Sittlichkeit braucht keine Religion“) sind Grundgehalt dieses humanistischen Emanzipationsprozesses des 18. Jahrhunderts.
Wohl ist mit dem Individualisierungstheorem diese ideengeschichtliche Entwicklung nicht gemeint, verbunden ist der soziologische Begriff der Individualisierung dennoch mit dieser Idee des Individualismus: Die Veränderung des herrschenden Menschenbildes – und als solche kann diese Entwicklung gekennzeichnet werden – geht einher mit veränderter sozialer, damit gesellschaftlicher Realität.
Mit Kippele 1998, 159 ist darauf zu verweisen, dass die Idee vom Individuum immer auf das Gesamt verweist: Der Einzelne ist ohne das Ganze, das Individuum ohne die Gesellschaft nicht denkbar. Makro- und mikrosoziologische Perspektiven müssen somit immer zusammen gedacht werden.
2.2 Minimaldefinition
Individualisierung ist ein soziologisches Konzept, dass eine prinzipielle Veränderung in der Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft beschreibt.
Diese Veränderung ist kein Phänomen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, frühe Individualisierungsphasen sind ab dem Mittelalter beobachten. „Im Kern bezeichnet (der Begriff Individualisierung – hkr) die Herauslösung des Einzelnen aus traditionalen Sozialbeziehungen.“ (Schroer 2000, 13) Damit stehen dem Einzelnen mehr Gestaltungsmöglichkeiten für sein eigenes Leben zur Verfügung als dies in traditionalen, i.S. vorheriger, Gesellschaften die Regel war. Die Modernisierung, verstanden als Übergang von traditionalen zu modernen Gesellschaften, bringt Individualisierungsschübe mit sich. An die Stelle der traditionellen Bindungen und Sozialformen treten neue Bindungen: Individualisierung ist gleichsam ein Kreislauf aus Freisetzung, verbunden mit dem Verlust an Stabilität und Reintegration – wohl weil der Mensch nur in sozialen Zusammenhängen leben kann. Individualisierung ist in diesem Sinne eine analytische Kategorie, die eben die Veränderung im Verhältnis von Individuum und Gesellschaft und damit den veränderten Vergesellschaftungsmodus beschreibt.
Bedingt wird „Individualisierung“ durch die gesellschaftliche Differenzierung, die den europäischen Modernisierungsprozess begleitet, die die Komplexität von Sozialstrukturen erhöht und so an die Individuen höhere Anforderungen stellt (vgl. Ebers 1995, 16). In diesem Sinne bezeichnet „Individualisierung“ gesellschaftshistorische Prozesse, die sich an realgeschichtlichen Eckpunkten festmachen lassen:
2.3 Realgeschichtliche Eckpunkte des Individualisierungsprozesses: Was hat den Wandel im Verhältnis von Individuum und Gesellschaft bedingt?
Als erste Phase der Individualisierung, gilt nach Ebers 1995, 26 u.a. der Übergang von „vormodernen zu modernen Gesellschaften im Sinne einer prinzipiellen Freisetzung des Menschen aus vormodernen Bindungen und Zwängen“. Dieser „primäre Individualisierungsschub“ wird von den soziologischen Klassikern beschreiben und hat nach Kippele 1998, 201 seinen Grund im Bevölkerungswachstum[1] und in der Arbeitsteilung, die im Übergang zur Geldwirtschaft und in der veränderten (religiösen) Weltanschauung notwendig wurde. Soziale Differenzierungsprozesse und religiöse Rationalisierung im Sinne Max Webers formten neue soziale Beziehungen und Integrationsmodi des Individuums in die Gesellschaft (vgl. auch Ebers 1995, 333).
Beginnend mit dem Zeitalter der Reformation, in der die (heils-)vermittelnde Autorität der Kirche hinter die „Freiheit des Christenmenschen“ zurücktritt, sich die Landesherren unabhängig von der Kirche machen und sich die calvinistisch-pietistisch geprägte Prädestinationslehre[2] entwickelt, rückt, gefolgt von den Entwicklungen der Renaissance, in der der Einzelne nicht mehr hauptsächlich als Teil eines Kollektivs gesehen wird, das ins Zentrum des Denkens, was zuvor die Ausnahme war: Der einzelne „freie“ Mensch, der nun nicht mehr „außerhalb der sozialen Ordnung“ (Ebers 1995, 35), etwa als Held oder Ketzer, steht. Mit der industriellen Revolution im 18./19. Jahrhundert, der „zunehmenden funktionalen Differenzierung und mit dem Aufstieg des ‚Dritten Standes’“(Ebers 1995, 37) wird das „Subjekt zur Inklusionsformel“ (ebd.): Ideengeschichtliche Individualisierung, i.S. einer Emanzipation von mythischen und politischen Mächten, findet ihren Niederschlag in der Gesellschaftsform.
Individualisierung erscheint so eingebettet in den Prozess der Modernisierung, deren Beginn ihren Höhepunkt in der industriellen Revolution fand: Ideengeschichtlich, gesellschaftlich und auch politisch (Stichwort: Legitimierte Herrschaft) kristallisierte sich ein fundamentaler Wandel im Vergleich zur Vergangenheit heraus. Die entstehende moderne Industriegesellschaft zeichnet sich aus durch Technisierung, Ökonomisierung und Institutionalisierung, dem Primat der Wissenschaften vor der Religion, der Rationalität und durch eine funktionale Differenzierung der Gesellschaft. Dieser Wandel in der Gesellschaftsform bewirkte einen fundamentalen Wandel in der Existenzweise des Einzelnen: Traditionale Bindungen traten zurück, individuelle Leistung und Karriere treten an die Stelle von vererbten Privilegien, Familienbindungen lockern sich – zumindest für die Männer des neu entstehenden Bürgerstandes (vgl. Ebers 1995, 37).
In diesem Übergang von der ständischen Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft veränderten sich die gesellschaftsprägenden- und tragenden Mythen: An die Stelle der – an sich unbeherrschbaren - Natur, ständischer Privilegien, auch der „gottgegebenen“, also religiös legitimierten Feudalherrschaft, religiöser Weltbilder, Bräuchen und Ritualen treten nun das Leistungsprinzip, damit Konkurrenz und ein Berechtigungssystem, weiters die Verwirklichung rechtsstaatlicher Demokratie und nicht zuletzt die Idee des autonomen Individuums gleichsam als neue Mythen.
Als „sekundären Individualisierungsschub“ gilt der gegenwärtige Prozess „innerhalb der Moderne“ (Ebers 1995, 26), der jedoch die erste Individualisierungsphase und die Modernisierung voraussetzt.
Ulrich Beck macht einen Prozess reflexiver Modernisierung aus, der den ursprünglichen Modernisierungsprozess selbst hinterfragt, diese „Zweite Moderne“ lässt die Selbstverständlichkeiten der ersten Moderne fragwürdig werden: „das Zusammenspiel von Wirtschaft und Politik, (…) Männer- und Frauenrollen, die Normalität der Kleinfamilie, der Glaube an die technische Machbarkeit, das Wahrheitsmonopol der Wissenschaft“ (Nollmann/Strasser 2002, 5). Dies und anderes, auch die Erfahrung der Grenze des Wachstums führt zu einem tiefgehenden Zweifel am Primat der Wissenschaften und der Technik und zu der Erkenntnis, dass diese nicht nur in der Lage sind Probleme zu lösen, sondern selbst zum Problem werden können.
Die „alten“ Antworten der Moderne, auch die traditionellen Institutionen der Moderne verlieren in ihrer Handlungsorientierung an Gültigkeit für das Individuum: Der Einzelne muss selbst Antworten finden und die individuelle biografische Verantwortung für gesellschaftliche Vorgänge übernehmen. Folgerichtig formuliert Beck, der „gegenwärtig (...) exponierteste Vertreter des Individualisierungstheorems“ (Ebers 1995, 30) das Charakteristische des sekundären Individualisierungsschubs, der zeitlich Mitte des 20. Jahrhunderts verordet ist, mit der Formel „Freisetzung ohne Wiedereinbettung“ und sieht als Novum dieses sekundären Individualisierungsschubs, dass das Individuum nun selbst soziale Reproduktionseinheit sei, Individualisierung werde nun selbst Sozialstruktur (vgl. Beck 2002, 228).
Ausgelöst wurde dieser sekundäre Individualisierungsschub durch die Steigerung und Stabilisierung des Lebensstandards unter den Bedingungen des gut ausgebildeten Sozialstaates, die gestiegene soziale und geographische Mobilität und die durch die Bildungsexpansion in den 1960er Jahren erweiterten Bildungschancen (vgl. Schroer 1997, 186; Beck 1986, 122ff).
Soziale Ungleichheit wurde nicht aufgelöst, die konstanten Ungleichheitsrelationen („Fahrstuhleffekt“) führten jedoch zu einem von existentieller Bedrohung überwiegend befreiten Leben auf hohem, relativ sicherem Niveau. Familiale, regionale, kulturelle und berufliche Bindungen verlieren ihre determinierende Macht: Ein Leben ohne Familie wird möglich, Ehe und Elternschaft trennen sich ebenso wie Elternschaft und Sexualität (Verhütungsmittel). Geschlechterrollen brechen auf, Mobilität wird zur Norm der modernen Gesellschaft; An die Stelle totaler (weil lebensbereichsübergreifender) Lebensorientierung in subkulturellen Milieus treten individuelle Rollenkombinationen, plurale Familienformen und „Bastelbiografien“ – zumindest für die jungen, gut ausgebildeten „Nutznieser“ der beschriebenen sozioökonomischen Entwicklung – die Generation zwischen Wirtschaftswunder und Kaltem Krieg.
Die diesen Wohlstand sichernden Institutionen werden für die Sicherung der persönlichen Existenz zunächst unwichtig: Die Aufgabe der Existenzsicherung verlagert sich in den Einzelnen hinein. Beziehungen werden zur Bewältigung konkreter Aufgaben situativ und thematisch eingegangen. In der Gesellschaft kommt es so zu einem Schwund an Solidarität, damit zu einem Identitätsverlust und schließlich zur – scheinbaren – Auflösung subkultureller sozialer Milieus und Klassen.
Gemeinsam ist diesen „Individualisierungsschüben“, dass es dabei immer um Freisetzungsprozesse des Individuums aus „historisch vorgegebenen und zugewiesenen Rollen (geht). Traditionale Sicherheiten (...) wurden unterminiert, während zugleich neue Formen sozialer Bindungen (...) kreiert wurden.“ (Beck 2002, 227f)
2.4 Innehalten: Ambivalenz des Individualisierungsbegriffs
Schon jetzt wird eine Schwierigkeit in der Rede von Individualisierung deutlich: Die Entwicklung des Selbstbewusstseins, des „Ich“ ist von gesellschaftlicher Entwicklung nicht bzw. nur analytisch zu trennen. Diese Verwobenheit von Ideengeschichte und Sozialgeschichte prägt auch die Individualisierungsprozesse, die immer von einer gewissen Zweischneidigkeit gekennzeichnet zu sein scheinen: Einerseits das Risiko, der Verlust an Bindung und Solidarität und andererseits die positiv erlebte Befreiung aus bzw. von Traditionen, ihren Abhängigkeiten, einengenden Verpflichtungen und Zuweisungen und damit verbunden die gewonnene Wahlfreiheit des Einzelnen. Die Entlassung des Einzelnen aus traditionalen Sozialbeziehungen scheint zugleich ein tiefgreifender sozialer Wandel zu sein, der den Einzelnen mit Entscheidungsfreiheit und scheinbarer Autonomie ausstattet (vgl. Schroer 1997, 158).
Das Ineinandergreifen dieser verschiedenen Ebenen und die Schwierigkeit, dass Ausgangspunkte und Wirkungen kaum getrennt werden können, machen den Begriff der Individualisierung so verwirrend und schwer zu handhaben.
Damit wird der Begriff jedoch selbst zum Spiegelbild subjektiver Empfindungen angesichts der reflexiven, der zweiten Moderne: Die Zustimmung zu diesen Positionsbeschreibungen muss immer wieder relativiert werden, die offensichtliche Chance zur Freiheit und Autonomie relativiert sich in der Beobachtung des Gegenteils. Empirisch hält das Individualisierungstheorem nicht stand (vgl. Kap. 3.3) und dennoch verbleiben der Eindruck der Stimmigkeit und die hohe Popularität der Analyse Ulrich Becks. Eine „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ (Ernst Bloch) scheint auch die zweite Moderne zu begleiten: In der Zustimmung zum gesellschaftlichen Wandel und seiner Ablehnung durch das Individuum ebenso, wie im soziologischen Versuch der Beschreibung und Analyse.
3. Konzepte des Individualisierungstheorems
Die wesentlichen Elemente des soziologischen Indivualisierungskonzepts sind bereits bei den soziologischen Klassikern, Max Weber, Emile Durkheim und Georg Simmel zu finden.
3.1 Die soziologischen Klassiker
3.1.1 Individualisierung bei Max Weber (1864 – 1920)
Schroer 2000, 15 rechnet die Position Max Webers einer von Max Horkheimer, Theodor W. Adorno und Michel Foucault fortgesetzten Argumentationslinie zu: „Im Mittelpunkt ihrer Analysen steht das gefährdete Individuum, das durch Rationalisierungs-, Bürokratisierungs- und Disziplinierungsprozesse in seiner Bewegungsfreiheit gehindert und zu einem willenlos funktionierenden Rädchen im Getriebe domestiziert wird. Sie thematisieren eine negative Individualisierung, nach der die Individuen aus ehemaligen Zwangsverhältnissen herausgelöst werden, um sie einer noch perfekteren Überwachung und Kontrolle zu unterziehen.“ (Schroer 2000, 15) Für Weber ist die Modernisierung gekennzeichnet durch eine „Entzauberung der Welt“, in der Vernunft und rationales Denken alle Lebensbereiche durchdringen und sie durch ihre analytische Kraft fragmentieren.
Rationalisierungsprozesse verlaufen parallel zu einem Individualisierungsprozess, den Weber im Sozialtypus des bürgerlichen Individuums beschreibt: Geprägt von der „protestantischen Ethik“, die „Zeitdisziplin, Bedürfnisunterdrückung, Befriedigungsaufschub und eine puritanische Arbeitsmoral“ (Ebers 1995, 40) internalisiert, versteht sich der Einzelne als rational und autonom Handelnder, die vormals durch Institutionen vermittelten Orientierungen werden in den Einzelnen verlagert, Selbstkontrolle ersetzt institutionelle Kontrolle. Die durchgängig rationalisierte, kapitalistische Gesellschaft der Moderne engt jedoch das Individuum ein und standardisiert, uniformiert und entindividualisiert das Leben der Menschen (vgl. Schroer 2000, 20). Kanacher 2001, 130 stellt die Versachlichung der Geschäfts-bzw. Berufslebens, in dem Emotionen hinter zweckrationale Entscheidungen zurück treten, in direkten Zusammenhang mit der innerweltlichen Askese des Pietismus: Das (religiöse) Erwählt-Sein trifft jeweils den Einzelnen, der mit seinen Entscheidungen und seinen Handlungen dafür Verantwortung übernehmen muss. Dies hat identitätsprägende Wirkung.
[...]
[1] Gemeint ist damit wohl das vorindustrielle Bevölkerungswachstum im 18. Jahrhundert, bei dem v.a. die Bauern, bedingt durch die verbesserte Nahrungsmittelversorgung und dem Wegfall von Heiratsbeschränkungen, zu vermehrter Familiengründung – und dem Überleben, wenngleich auf materiell niedrigem Niveau – in der Lage waren.
[2] Prädestinationslehre meint, dass Erfolg durch Arbeit von der Vorherbestimmung des Individuums für die endzeitliche Rettung zeugt: Diese Gnade Gottes darf nicht durch Müßiggang, Zeitvergeudung oder Luxus verscheudert werden. Arbeit hat für den Christen Selbstzweck. Misserfolg hingegen zeigt an, dass der Mensch nicht zu den von Gott auserwählten Eretteten gehört. Nachdem nun niemand der Gnade Gottes sicher sein konnte, muss der Fleiß und das sparsame und tugendhafte Leben ebenso wie das Streben nach Reichtum Christenpflicht sein: Der Erfolg dieser Anstrengungen jedoch liegt in der Vorherbestimmung Gottes und ist Zeichen für das persönliche Errettetsein.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem soziologischen Begriff der Individualisierung?
Individualisierung bezeichnet die Herauslösung des Einzelnen aus traditionalen Sozialbeziehungen und die damit verbundenen neuen Gestaltungsmöglichkeiten des eigenen Lebens.
Was ist ein "primärer Individualisierungsschub"?
Es ist die Freisetzung des Menschen aus vormodernen Bindungen, die durch Ereignisse wie die Reformation, die Renaissance und die industrielle Revolution ausgelöst wurde.
Welche soziologischen Klassiker haben das Thema geprägt?
Wichtige Theoretiker sind Max Weber (Rationalisierung), Émile Durkheim (Arbeitsteilung), Georg Simmel (Geldwirtschaft) und Norbert Elias.
Was bedeutet "religiöse Individualisierung"?
Es beschreibt den Prozess, bei dem die Deutungshoheit über religiöse Fragen von Institutionen auf das Individuum übergeht und Religiosität zur Privatsache wird.
Welche Kritik gibt es an der Individualisierungsthese?
Kritiker weisen auf die Unschärfe des Begriffs hin und betonen, dass Individualisierung oft mit neuen Zwängen und einer "privatisierten Verantwortung" einhergeht.
- Citar trabajo
- Heike Kellner-Rauch (Autor), 2007, (Religiöse) Individualisierungsprozesse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138149