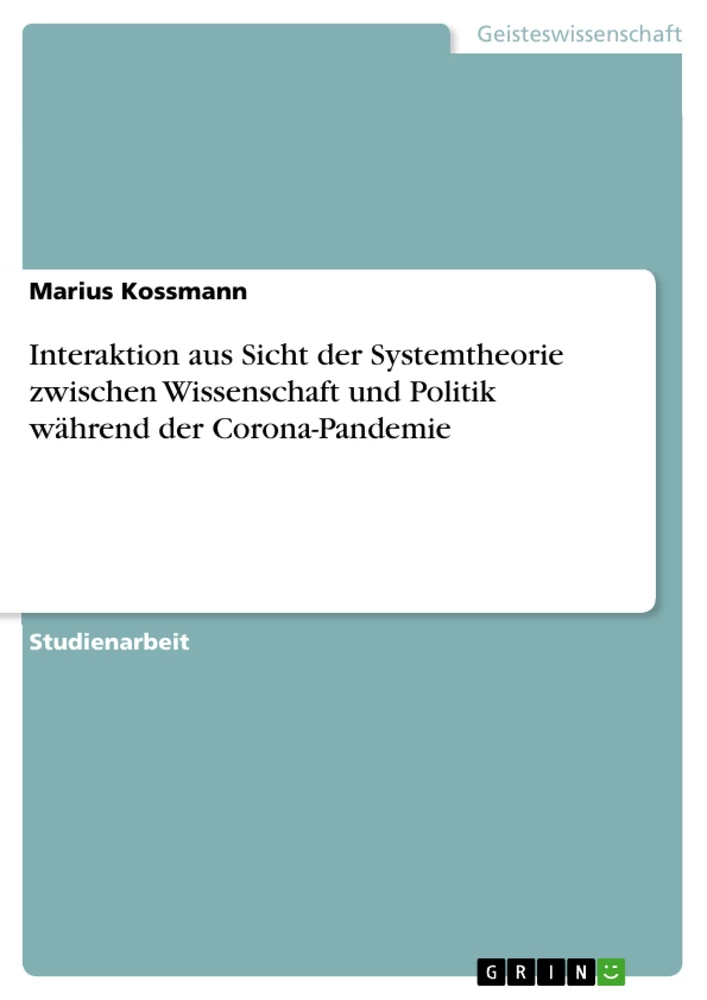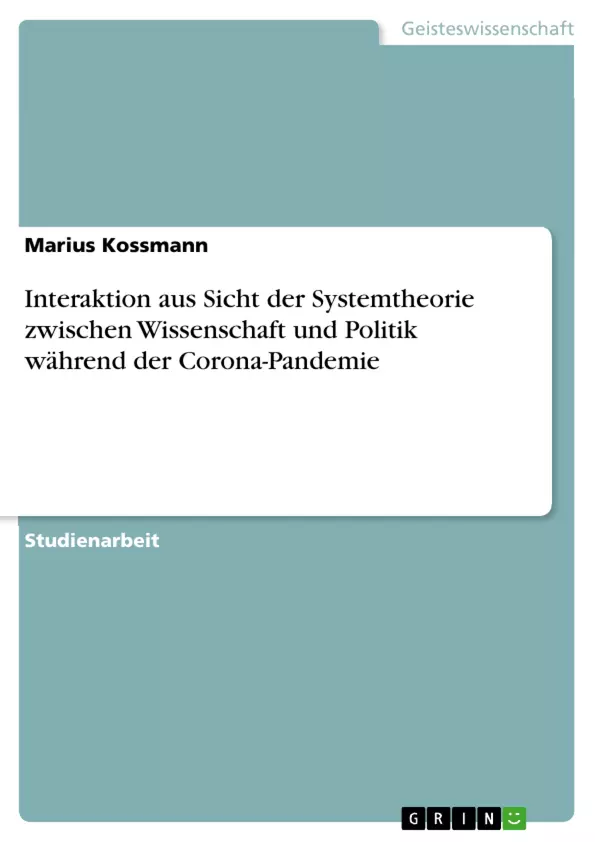In der jüngsten Vergangenheit wurde der Begriff „alternativlos“ im Kontext von Entscheidungsprozessen hervorgehoben, wobei suggeriert wird, dass keine Alternativen oder Diskussionen notwendig sind. Diese Vorstellung wird vor allem in der Corona-Pandemie deutlich, in der jede politische Entscheidung potenziell ungewisse zukünftige Folgen hat. In der modernen Demokratie, wie in Deutschland, zeigt sich die Gemeinsamkeit der ungewissen Zukunft unter Politikern, die Entscheidungen von hoher Bedeutung treffen müssen. Auch die Wissenschaft steht vor einem Dilemma, da sie Prognosen über ungewisse Entwicklungen abgeben soll. Dies politisiert das wissenschaftliche Wissen und führt zu Fragen über die Rolle der wissenschaftlichen Politikberatung in der Prognose von zukünftigen Entwicklungen. Der Text schlägt die Systemtheorie als Forschungsansatz vor, um diese Problematik in den Dimensionen Sach-, Zeit- und Sozialdimension zu analysieren.
Die moderne, funktional differenzierte Gesellschaft konfrontiert Politik und Wissenschaft mit komplexen Herausforderungen. Ohne territoriale Grenzen fließen Daten, Waren und Geld grenzenlos durch die Welt, während sich die Gesellschaft in autonome Funktionssysteme wie Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Massenmedien aufteilt. Diese Systeme agieren selbstreferenziell und autopoetisch. Die moderne Gesellschaft unterteilt sich in Risiken, die sowohl unvermeidbar als auch selbstproduziert sind, wobei das Risiko in Entscheidungen liegt, die im Unbekannten getroffen werden. Luhmann beschreibt diese Situation als Risikogesellschaft, wobei Baumann und Vorderstraße den Begriff weiter präzisieren. Die Unsicherheit in der Sachdimension, die Unversehrtheit in der Sozialdimension und die Ungewissheit in der Zeitdimension charakterisieren das Dilemma, in dem sich Wissenschaft und Politik befinden. Dabei werden Fragen aufgeworfen, wie diese Systeme interagieren können, wenn sie gleichzeitig vor äußeren Einflüssen geschützt werden müssen, und wie Entscheidungen im Kontext der unbekannten Zukunft getroffen werden können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Problemskizze und Lösungsansatz
- 3. Theoretische und Methodologische Grundlage
- 3.1. Die Drei Sinndimensionen
- 4. Interaktion zwischen Wissenschaft und Politik aus Sicht der Systemtheorie
- 4.1. Politikberatung als Interaktion (Sozialdimension)
- 4.1.1. Die Unversehrtheit des eigenen Systems
- 4.2. Die Grenzen der Interaktion (Sachdimension)
- 4.2.1. Unsicherheit der Beobachtung
- 4.3. Das Risiko der Interaktion (Zeitdimension)
- 4.3.1. Ungewissheit der Zukunft
- 5. Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text analysiert die Interaktion zwischen Wissenschaft und Politik während der Corona-Pandemie im Lichte der Systemtheorie. Er untersucht, wie sich die beiden Systeme in ihren jeweiligen Sinndimensionen (Sachdimension, Sozialdimension, Zeitdimension) voneinander abgrenzen und gleichzeitig interagieren. Dabei werden insbesondere die Herausforderungen und Chancen der wissenschaftlichen Politikberatung in einer Risikogesellschaft beleuchtet.
- Die Grenzen der Interaktion zwischen Wissenschaft und Politik in Bezug auf die Sachdimension (Unsicherheit der Beobachtung)
- Die Bedeutung der Unversehrtheit des eigenen Systems für die Interaktion in der Sozialdimension
- Die Rolle der Zeitdimension (Ungewissheit der Zukunft) in der Interaktion zwischen Wissenschaft und Politik
- Die Herausforderungen der wissenschaftlichen Politikberatung in einer Risikogesellschaft
- Die Anwendung der Systemtheorie als methodischer Ansatz für die Analyse der Interaktion zwischen Wissenschaft und Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet den Begriff der „Alternativlosigkeit“ im Kontext der Corona-Pandemie. Sie stellt die Problematik der politischen Entscheidungsfindung bei ungewisser Zukunft und der Notwendigkeit wissenschaftlicher Beratung heraus.
Kapitel 2 skizziert die Herausforderungen der modernen, funktional differenzierten Gesellschaft für die Politik und stellt die Konzepte der Risikogesellschaft und der selbstreferentiellen Systeme nach Luhmann vor. Die Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Begriffe Unsicherheit, Unversehrtheit und Ungewissheit im Zusammenhang mit der Interaktion zwischen Wissenschaft und Politik.
Kapitel 3 erläutert die systemtheoretische Grundlage des Textes und beschreibt den konstruktivistischen Ansatz der Systemtheorie. Es werden die Konzepte der Selbstreferenz und der Unterscheidung von System und Umwelt nach Luhmann vorgestellt.
Kapitel 4 analysiert die Interaktion zwischen Wissenschaft und Politik aus Sicht der Systemtheorie. Es untersucht die drei Sinndimensionen (Sachdimension, Sozialdimension, Zeitdimension) und zeigt auf, wie diese die Interaktion zwischen den beiden Systemen beeinflussen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Interaktion zwischen Wissenschaft und Politik im Kontext der Corona-Pandemie. Zu den wichtigsten Schlüsselbegriffen zählen die Systemtheorie, die drei Sinndimensionen (Sachdimension, Sozialdimension, Zeitdimension), die Risikogesellschaft, Selbstreferenz, Politikberatung, Unversehrtheit, Unsicherheit und Ungewissheit.
Häufig gestellte Fragen
Wie interagieren Wissenschaft und Politik laut Systemtheorie?
Wissenschaft und Politik sind autonome Funktionssysteme, die selbstreferenziell agieren. In der Pandemie müssen sie interagieren, während sie gleichzeitig ihre eigene Logik (Wahrheit vs. Macht) schützen müssen.
Was bedeutet „Alternativlosigkeit“ in der Corona-Pandemie?
Der Begriff suggeriert, dass keine Diskussion notwendig sei. Systemtheoretisch ist dies problematisch, da jede Entscheidung in einer Risikogesellschaft ungewisse zukünftige Folgen hat.
Was sind die drei Sinndimensionen nach Luhmann?
Die Sachdimension (Unsicherheit der Beobachtung), die Sozialdimension (Unversehrtheit der Systeme) und die Zeitdimension (Ungewissheit der Zukunft) prägen das Dilemma zwischen Wissen und Entscheiden.
Warum politisiert sich wissenschaftliches Wissen in Krisen?
Da die Politik auf Prognosen angewiesen ist, um Entscheidungen zu rechtfertigen, wird die Wissenschaft in eine Beraterrolle gedrängt, die ihre eigentlich neutrale Beobachtungsposition gefährdet.
Was kennzeichnet eine „Risikogesellschaft“?
Eine Risikogesellschaft produziert ihre Gefahren selbst durch Entscheidungen, die im Unbekannten getroffen werden müssen, wobei die Folgen dieser Entscheidungen oft unvermeidbar und global sind.
- Citar trabajo
- Marius Kossmann (Autor), 2021, Interaktion aus Sicht der Systemtheorie zwischen Wissenschaft und Politik während der Corona-Pandemie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1381824