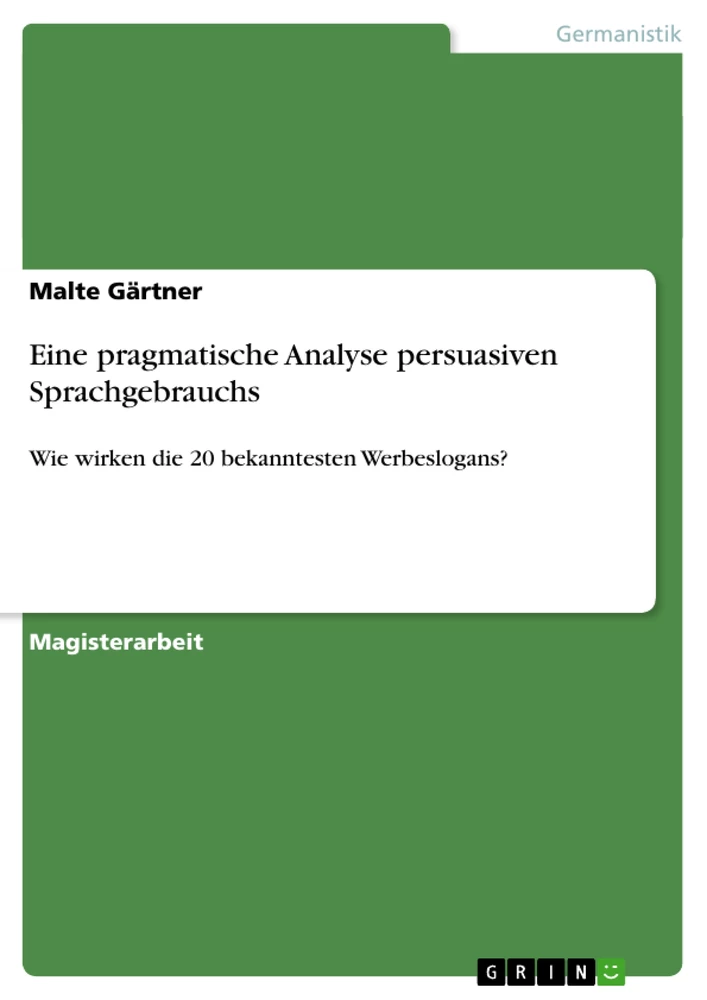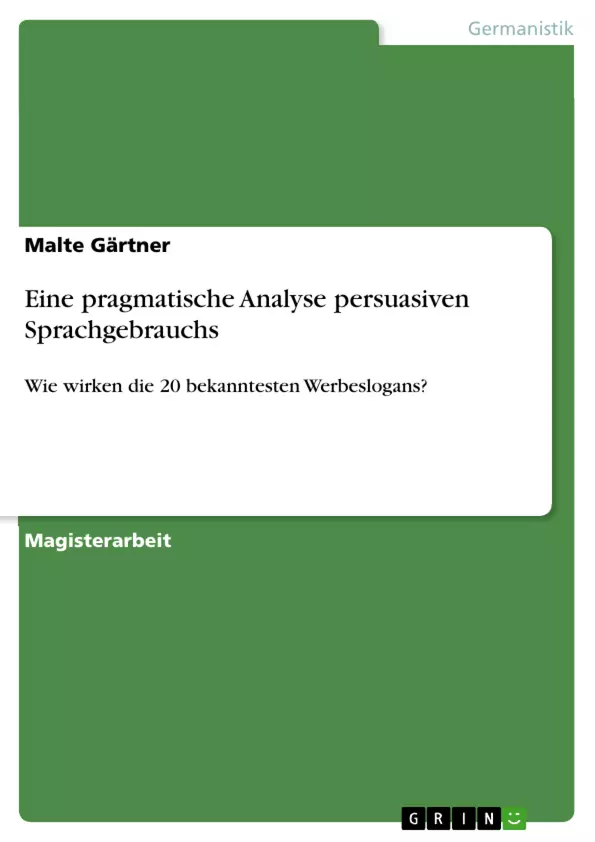In dieser Arbeit werden, nach allgemeinen Erläuterungen zu Persuasion und persuasivem Sprachgebrauch in Kapitel 2. und einer knappen Abhandlung von dessen verschiedenen Formen und Bereichen in Kapitel 2.1., in Kapitel 2.2. die Spezifika der Werbesprache untersucht. Insbesondere werden dabei in Kapitel 2.2.1. und 2.2.2. Schlaglichter auf das Spannungsverhältnis von Text und Bild in der Werbung bzw. die Besonderheiten von Werbeslogans geworfen.
Kapitel 3. beginnt mit einer Beschreibung der Schwierigkeiten, die sich ergeben,
versucht man persuasivem Sprachgebrauch mittels linguistischer Pragmatik näher zu kommen. Beispielhaft gemacht und erläutert werden diese Schwierigkeiten an zwei Klassikern der Pragmatik, nämlich am Kooperationsprinzip von GRICE und der Sprechakttheorie AUSTINs und vor allem SEARLEs. Kapitel 3.1. und 3.2. referieren daraufhin zwei Vorschläge, wie diesen beiden Problemfeldern begegnet werden kann.
In Kapitel 3.1. wird Werben als dialogisches Handlungsmuster beschrieben, innerhalb dessen auch Informationshandlungen persuasiv beschreibbar sind; in Kapitel 3.2. wird Inferenz mittels der Relevanztheorie erklärt, die der Position des Hörers größere Bedeutung zumisst als andere Theorien. Kapitel 3.3. skizziert im Anschluss ein pragmatisches Analysemodell für Werbeslogans, das Ansätze und Erkenntnisse des dialogischen Handlungsmuster-Modells und der Relevanztheorie aufgreift und zu vereinen versucht.
In Kapitel 4. schließlich wende ich das in Kapitel 3.3. herausgearbeitete Modell
stichprobenhaft auf einige Werbeslogans an. Die hierfür herangezogenen Slogans sind laut einer repräsentativen Erhebung des IMAS (Institut für Markt- und Sozialanalysen) die in Deutschland derzeit bekanntesten Slogans.
Aufgrund der Schwierigkeiten, Sprechaktklassen hörerseitig zuzuordnen, erfolgt die Grobsortierung der Slogans anhand eines Musters, das in der Relevanztheorie zur Einordnung von Äußerungstypen entwickelt wurde.
Kapitel 5. fasst die gesamte Arbeit noch einmal speziell unter den
Gesichtspunkten zusammen, inwiefern es einerseits gelungen ist, die Persuasivität von Werbeslogans pragmatisch nachzuzeichnen, und wo andererseits weiterer
Erklärungsbedarf besteht. Den Abschluss bildet ein kurzer und schattenrissartiger
Ausblick darauf, welche theoretischen und praktischen Konsequenzen der erzielte
Erkenntnisgewinn haben könnte; zum Beispiel wie der ideale Werbeslogan gestaltet sein müsste.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Persuasion
- 2.1. Erscheinungsformen persuasiven Sprachgebrauchs
- 2.2. Werbung und Werbesprache
- 2.2.1. Spannungsverhältnis Text-Bild in der Werbung
- 2.2.2. Bedeutung und Funktion von Slogans in der Werbung
- 3. Die Pragmatik der Werbesprache
- 3.1. Werben als direktives dialogisches Handlungsmuster
- 3.2. Relevanztheorie und Werbesprache
- 3.2.1. Kommunikation
- 3.2.2. Inferenz
- 3.2.3. Relevanz
- 3.2.4. Aspekte sprachlicher Kommunikation
- 3.2.5. Werbesprachliche Untersuchungen
- 3.2.5.1. Tanakas, Advertising Language
- 3.2.5.2. Forcevilles, Pictorial Metaphor in Advertising
- 3.3. Ein Analysemodell
- 4. Pragmatische Analyse ausgewählter Werbeslogans
- 4.1. Slogans, die einen tatsächlichen Zustand beschreiben
- 4.2. Slogans, die einen erstrebenswerten Zustand beschreiben
- 4.3. Slogans, die eine zugeschriebene Äußerung interpretieren
- 4.4. Slogans, die eine erstrebenswerte Äußerung interpretieren
- 4.5. Zusammenfassung der Slogan-Analyse
- 5. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht den persuasiven Sprachgebrauch in der Wirtschaftswerbung, fokussiert auf die pragmatische Analyse von Werbeslogans. Ziel ist es, ein pragmatisches Analysemodell zu entwickeln und anzuwenden, um die Wirkungsweise dieser Slogans zu verstehen.
- Pragmatische Analyse persuasiver Sprache in der Werbung
- Entwicklung und Anwendung eines Analysemodells für Werbeslogans
- Untersuchung des Verhältnisses von Text und Bild in der Werbung
- Analyse der Bedeutung und Funktion von Slogans
- Relevanztheorie und ihre Anwendung auf die Werbesprache
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des persuasiven Sprachgebrauchs ein und begründet die Wahl der Wirtschaftswerbung als Untersuchungsgegenstand. Sie betont die allgegenwärtige Präsenz persuasiver Kommunikation und argumentiert für die Relevanz einer pragmatischen Analyse, die den Handlungsaspekt sprachlicher Äußerungen in den Mittelpunkt stellt. Die Arbeit fokussiert sich auf Werbeslogans, wobei die Beschränkung auf textliche Elemente und die Ausklammerung bildlicher Aspekte begründet wird.
2. Persuasion: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Persuasion“ und seine deutsche Übersetzung („Überredung/Überzeugung“). Es wird auf die unterschiedlichen Konnotationen dieser Begriffe eingegangen und die Wahl des englischen Begriffs „Persuasion“ im Kontext der Arbeit gerechtfertigt. Das Kapitel legt den Grundstein für die anschließende Analyse, indem es den Fokus auf den persuasiven Aspekt sprachlicher Handlungen lenkt.
3. Die Pragmatik der Werbesprache: Dieses Kapitel beschreibt die Herausforderungen bei der Anwendung pragmatischer Theorien auf persuasive Sprache in der Werbung. Es wird auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die sich aus dem Fokus vieler pragmatischer Theorien auf informative Handlungen und dem impliziten und uneindeutigen Sprachgebrauch in der Werbung ergeben. Es werden Lösungsansätze vorgestellt, die auf dem Konzept des dialogischen Handlungsmusters und der Relevanztheorie basieren. Ein pragmatisches Analysemodell für Werbeslogans wird skizziert.
4. Pragmatische Analyse ausgewählter Werbeslogans: Dieses Kapitel präsentiert die Anwendung des in Kapitel 3 entwickelten Modells auf ausgewählte, bekannte deutsche Werbeslogans. Die Slogans werden anhand eines Musters aus der Relevanztheorie grob sortiert und analysiert. Die Analyse fokussiert sich auf die pragmatischen Aspekte der Slogans und untersucht, wie sie persuasiv wirken.
Schlüsselwörter
Persuasion, Werbesprache, Pragmatik, Werbeslogans, Relevanztheorie, Dialogisches Handlungsmuster, Analysemodell, impliziter Sprachgebrauch, Überredung, Überzeugung.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Pragmatische Analyse von Werbeslogans
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht den persuasiven Sprachgebrauch in der Wirtschaftswerbung, mit dem Schwerpunkt auf der pragmatischen Analyse von Werbeslogans. Ziel ist die Entwicklung und Anwendung eines pragmatischen Analysemodells, um die Wirkungsweise dieser Slogans zu verstehen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Pragmatische Analyse persuasiver Sprache in der Werbung, Entwicklung und Anwendung eines Analysemodells für Werbeslogans, Untersuchung des Verhältnisses von Text und Bild in der Werbung, Analyse der Bedeutung und Funktion von Slogans und die Anwendung der Relevanztheorie auf die Werbesprache.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Persuasion (inkl. Erscheinungsformen persuasiven Sprachgebrauchs und Werbung/Werbesprache), Die Pragmatik der Werbesprache (inkl. eines Analysemodells), Pragmatische Analyse ausgewählter Werbeslogans und Zusammenfassung und Ausblick.
Wie wird der Begriff "Persuasion" definiert und verwendet?
Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Konnotationen von „Persuasion“, „Überredung“ und „Überzeugung“. Die Wahl des englischen Begriffs "Persuasion" wird im Kontext der Arbeit begründet und der Fokus auf den persuasiven Aspekt sprachlicher Handlungen gelegt.
Welche Herausforderungen werden bei der Anwendung pragmatischer Theorien auf Werbesprache angesprochen?
Die Arbeit diskutiert die Schwierigkeiten, die sich aus dem Fokus vieler pragmatischer Theorien auf informative Handlungen und dem impliziten und uneindeutigen Sprachgebrauch in der Werbung ergeben. Lösungsansätze basieren auf dem Konzept des dialogischen Handlungsmusters und der Relevanztheorie.
Welches Analysemodell wird verwendet?
Die Arbeit entwickelt ein pragmatisches Analysemodell für Werbeslogans, welches auf der Relevanztheorie basiert und in Kapitel 3 skizziert und in Kapitel 4 auf ausgewählte deutsche Werbeslogans angewendet wird. Die Slogans werden anhand eines Musters grob sortiert und analysiert, wobei der Fokus auf den pragmatischen Aspekten und der persuasiven Wirkung liegt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Persuasion, Werbesprache, Pragmatik, Werbeslogans, Relevanztheorie, Dialogisches Handlungsmuster, Analysemodell, impliziter Sprachgebrauch, Überredung, Überzeugung.
Wie wird das Verhältnis von Text und Bild in der Werbung behandelt?
Die Arbeit thematisiert das Verhältnis von Text und Bild, beschränkt sich in der Analyse jedoch primär auf die textlichen Elemente der Werbeslogans. Die Begründung für diese Beschränkung findet sich in der Einleitung.
Welche Art von Slogans werden analysiert?
Die Arbeit analysiert ausgewählte, bekannte deutsche Werbeslogans, die nach einem Muster aus der Relevanztheorie grob in Kategorien sortiert werden (z.B. Slogans, die einen tatsächlichen oder erstrebenswerten Zustand beschreiben, oder solche, die eine zugeschriebene oder erstrebenswerte Äußerung interpretieren).
- Citation du texte
- Malte Gärtner (Auteur), 2009, Eine pragmatische Analyse persuasiven Sprachgebrauchs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138185