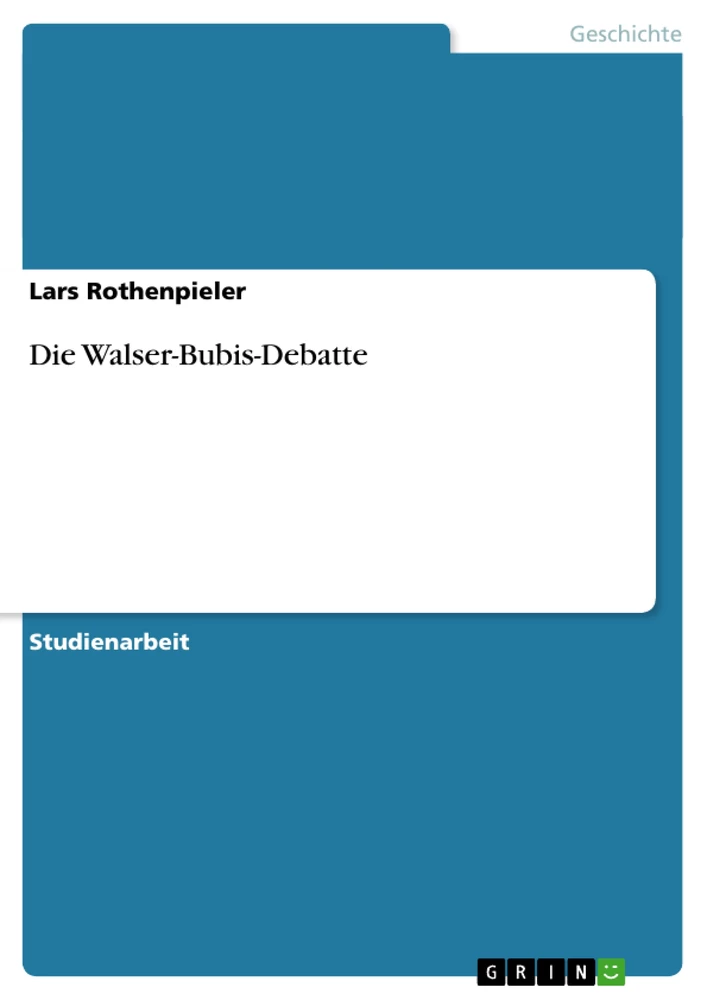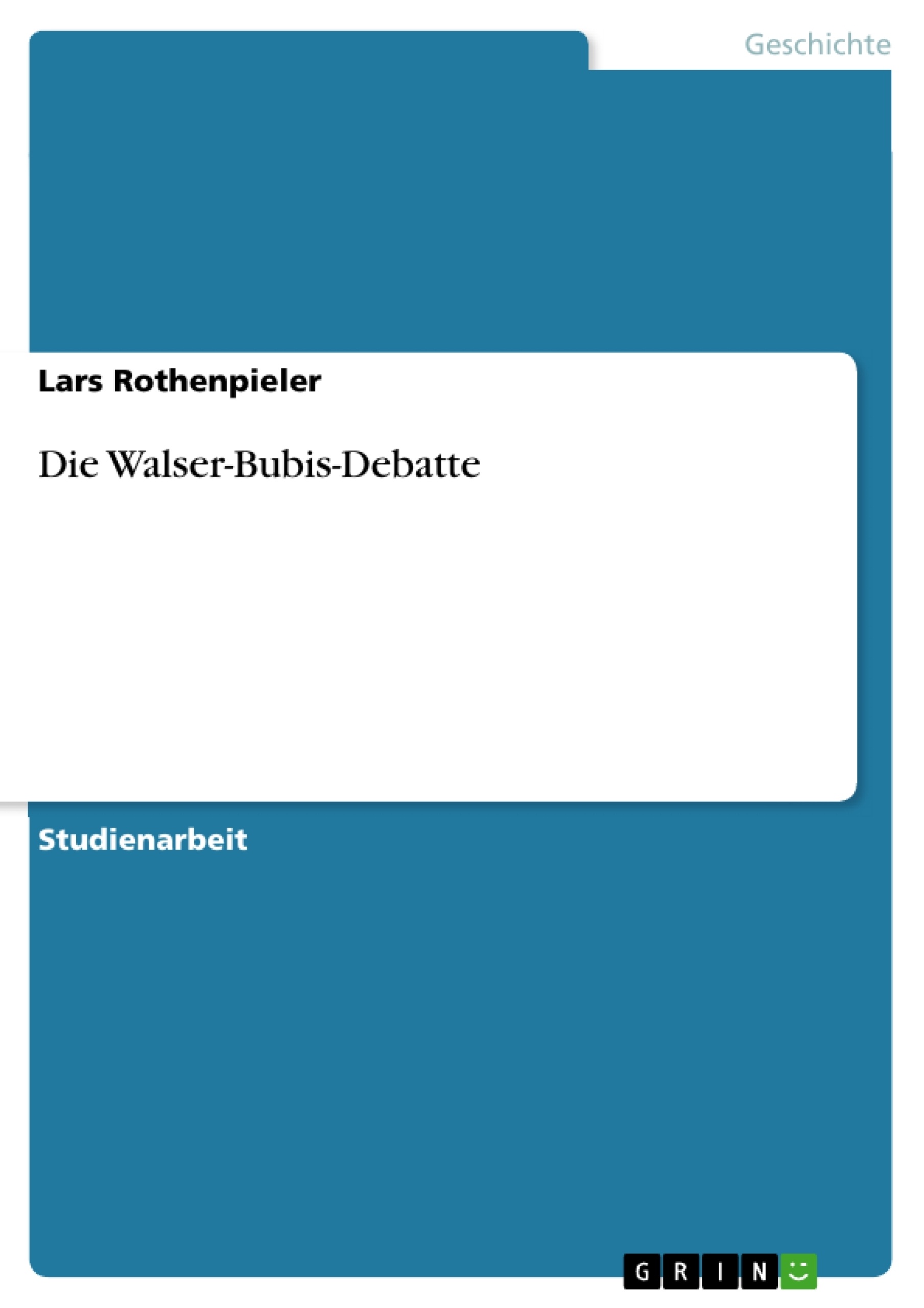Diese Arbeit beschäftigt sich im Rahmen des Seminars Kontroversen um die deutsche Geschichte mit der Walser-Bubis-Debatte, die im Spätherbst und Winter des Jahres 1998 geführt wurde. Auslöser hierfür war eine Rede, die der Schriftsteller Martin Walser zur Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels hielt und die von Ignatz Bubis, damaliger Vorsitzender des Zentralrates der Juden in Deutschland, heftig kritisiert wurde. Die darauf folgende Debatte sollte bis zum Jahresende 1998 andauern.
Im Verlauf dieser Arbeit soll es nicht darum gehen, diese Debatte noch einmal zu führen oder zu entscheiden, wer als Sieger daraus hervorgegangen ist. Vielmehr soll geklärt werden, warum Walsers Rede diese Debatte auslöste, wer die darauf folgende Debatte hauptsächlich geführt hat, wie diese geführt wurde und wie sie sich entwickelt hat. Die erste Frage wird in Kapitel 2 geklärt, das Walsers Rede auf seine Brisanz untersucht. Den Fragen zur Debatte wird dann in Kapitel 3 nachgegangen, welches die Debatte einer genaueren Analyse unterzieht. In einem eigenen Abschnitt (Kap. 4) wird nun der Frage nachgegangen, ob diese Debatte als eine Zeitenwende im Umgang mit der Vergangenheit gesehen werden kann. Schließlich befasst sich das fünfte und letzte Kapitel mit den Ergebnissen dieser Arbeit.
Bei der Bearbeitung dieses Themas wurde auf viele Quellen, besonders Pressemeldungen, Kommentare und Leserbriefe, zurückgegriffen, die in ausreichender Form verfügbar waren. Ebenfalls wurde Literatur benutzt, die aber aufgrund der zeitlichen Nähe des Themas bisher keine sehr große Anzahl umfasst.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Eine Debatte
- 2. Der Auslöser: Martin Walsers Friedenspreisrede
- 3. Die Debatte
- 3.1 Erste Reaktionen auf die Friedenspreisrede
- 3.2 Die Antwort: Ignatz Bubis Rede am 9. November
- 3.3 Dohnanyi contra Bubis
- 3.4 Augsteins Kommentar
- 3.5 Walsers Rede an der Duisburger Universität
- 3.6 Weitere Stimmen
- 3.7 Der Schlusspunkt der Debatte: Ein Gespräch
- 4. Eine Zeitenwende?
- 5. Zusammenfassender Überblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Walser-Bubis-Debatte von 1998, die durch Martin Walsers Friedenspreisrede ausgelöst wurde. Ziel ist nicht die Bewertung der Debatte selbst, sondern die Untersuchung ihrer Ursachen, Beteiligten, Verlaufsform und Entwicklung. Die Arbeit beleuchtet die Brisanz von Walsers Rede, die Hauptargumente der Debatte und die Frage nach ihrer Bedeutung als möglicher Wendepunkt im Umgang mit der deutschen Vergangenheit.
- Analyse der kontroversen Friedenspreisrede von Martin Walser.
- Untersuchung der Reaktionen auf Walsers Rede und der darauf folgenden Debatte.
- Bewertung der Argumentationslinien der beteiligten Personen (Walser, Bubis, u.a.).
- Erörterung der Rolle der Medien in der öffentlichen Wahrnehmung der Debatte.
- Diskussion der Frage, ob die Debatte eine Zeitenwende im Umgang mit der deutschen Vergangenheit darstellt.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Eine Debatte: Dieses einleitende Kapitel beschreibt den Kontext und den Fokus der Arbeit: die Analyse der Walser-Bubis-Debatte im Spätherbst und Winter 1998. Es wird klargestellt, dass die Arbeit nicht die Debatte selbst neu führen, sondern deren Entstehung, Verlauf und Bedeutung untersuchen will. Die Kapitel 2 und 3 widmen sich der Analyse der auslösenden Rede Walsers und der darauf folgenden Debatte. Kapitel 4 befasst sich mit der möglichen Bedeutung der Debatte als Zeitenwende, während Kapitel 5 die Ergebnisse zusammenfasst. Der methodische Ansatz betont die Verwendung vielfältiger Quellen wie Pressemitteilungen, Kommentare und Leserbriefe.
2. Der Auslöser: Martin Walsers Friedenspreisrede: Dieses Kapitel untersucht Walsers Friedenspreisrede als Auslöser der Debatte. Die Rede wird detailliert analysiert, wobei besonders Walsers Ambivalenz gegenüber der öffentlichen Erinnerung an den Holocaust herausgearbeitet wird. Seine Aussagen zum „Wegschauen“ und zur „Instrumentalisierung der Schande“ werden im Kontext seiner Kritik an der medialen Darstellung des Holocaust und der öffentlichen Trauerkultur diskutiert. Die Analyse zeigt, wie Walsers ambivalente Haltung zur Erinnerungskultur die heftigen Reaktionen hervorrief. Die Rede wird als komplex und vielschichtig dargestellt, deren Interpretationsspielraum zu den Kontroversen beitrug.
3. Die Debatte: Dieses Kapitel analysiert die Debatte selbst, beginnend mit den ersten Reaktionen auf Walsers Rede. Der Fokus liegt auf der Konfrontation zwischen Walser und Bubis, sowie weiteren beteiligten Akteuren. Die unterschiedlichen Argumentationslinien und die Rolle der Medien werden beleuchtet. Die Kapitel 3.1 bis 3.7 untersuchen verschiedene Aspekte der Debatte, wie die initialen positiven Reaktionen der Presse im Kontrast zu Bubis’ scharfer Kritik, die folgenden Beiträge von Dohnanyi und Augstein und die Entwicklung der Debatte in ihren verschiedenen Phasen. Die Synthese aller Unterkapitel zeigt die Vielschichtigkeit und die Dynamik der öffentlichen Auseinandersetzung, deren Verlauf und verschiedene Positionen mit ihren jeweiligen Argumenten.
Schlüsselwörter
Walser-Bubis-Debatte, Friedenspreisrede, Holocaust-Erinnerung, öffentliche Erinnerungskultur, Medien, kollektives Gedächtnis, Moral, Gewissen, Vergangenheitsbewältigung, deutsche Geschichte, Kontroverse.
Häufig gestellte Fragen zur Walser-Bubis-Debatte
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Walser-Bubis-Debatte von 1998, ausgelöst durch Martin Walsers Friedenspreisrede. Der Fokus liegt nicht auf der Bewertung der Debatte selbst, sondern auf der Untersuchung ihrer Ursachen, Beteiligten, des Verlaufs und ihrer Entwicklung. Es wird die Brisanz von Walsers Rede, die Hauptargumente und die mögliche Bedeutung als Wendepunkt im Umgang mit der deutschen Vergangenheit beleuchtet.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Analyse der kontroversen Friedenspreisrede von Martin Walser, die Untersuchung der Reaktionen und der darauf folgenden Debatte, die Bewertung der Argumentationslinien der Beteiligten (Walser, Bubis etc.), die Rolle der Medien und die Diskussion, ob die Debatte eine Zeitenwende im Umgang mit der deutschen Vergangenheit darstellt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln. Kapitel 1 gibt eine Einleitung und beschreibt den Fokus der Arbeit. Kapitel 2 analysiert Walsers Friedenspreisrede als Auslöser der Debatte. Kapitel 3 analysiert die Debatte selbst, beginnend mit den ersten Reaktionen und der Konfrontation zwischen Walser und Bubis. Kapitel 4 befasst sich mit der möglichen Bedeutung der Debatte als Zeitenwende. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse zusammen. Die Methodik basiert auf vielfältigen Quellen wie Pressemitteilungen, Kommentaren und Leserbriefen.
Welche Aspekte von Walsers Rede werden analysiert?
Die Analyse von Walsers Rede konzentriert sich auf seine Ambivalenz gegenüber der öffentlichen Erinnerung an den Holocaust, seine Aussagen zum „Wegschauen“ und zur „Instrumentalisierung der Schande“, seine Kritik an der medialen Darstellung des Holocaust und der öffentlichen Trauerkultur. Die Analyse zeigt, wie Walsers ambivalente Haltung die heftigen Reaktionen hervorrief und wie der Interpretationsspielraum der Rede zu den Kontroversen beitrug.
Wie wird die Debatte selbst beschrieben?
Die Debatte wird detailliert analysiert, beginnend mit den ersten Reaktionen auf Walsers Rede. Es wird die Konfrontation zwischen Walser und Bubis und weiteren Beteiligten beleuchtet, sowie die unterschiedlichen Argumentationslinien und die Rolle der Medien. Die Analyse umfasst die initialen Reaktionen der Presse, Bubis' Kritik, die Beiträge von Dohnanyi und Augstein und die Entwicklung der Debatte in ihren verschiedenen Phasen, um die Vielschichtigkeit und Dynamik der öffentlichen Auseinandersetzung aufzuzeigen.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit fasst die Ergebnisse der Analyse der Walser-Bubis-Debatte zusammen und diskutiert die Bedeutung der Debatte im Kontext des Umgangs mit der deutschen Vergangenheit. Ob die Debatte tatsächlich eine Zeitenwende darstellt, wird diskutiert und anhand der gewonnenen Erkenntnisse bewertet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Walser-Bubis-Debatte, Friedenspreisrede, Holocaust-Erinnerung, öffentliche Erinnerungskultur, Medien, kollektives Gedächtnis, Moral, Gewissen, Vergangenheitsbewältigung, deutsche Geschichte, Kontroverse.
- Arbeit zitieren
- Lars Rothenpieler (Autor:in), 2005, Die Walser-Bubis-Debatte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138204