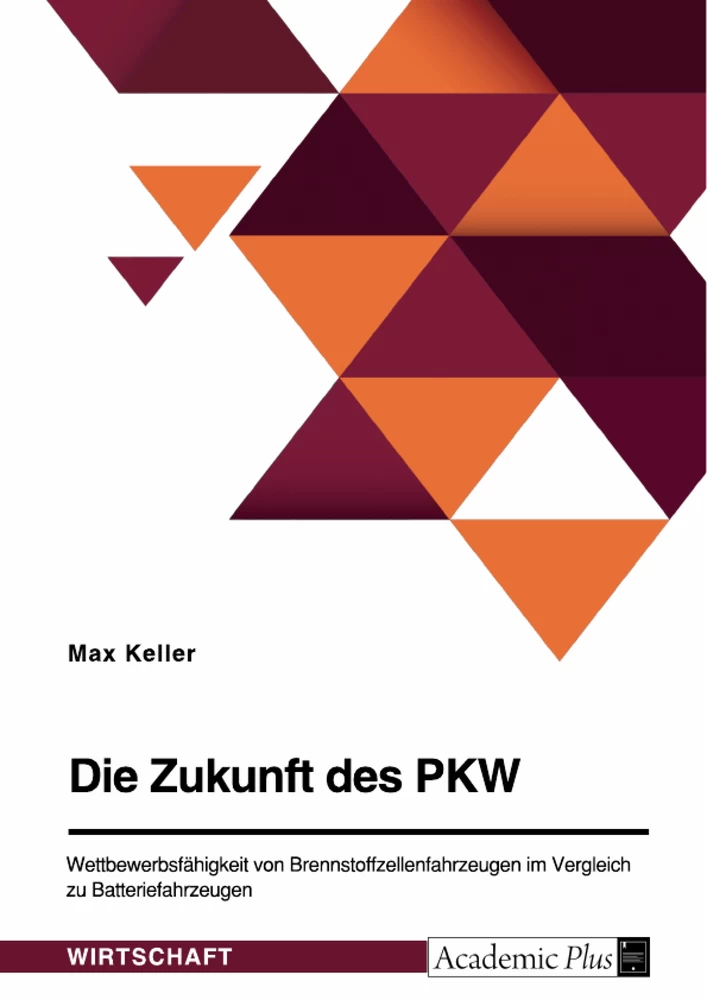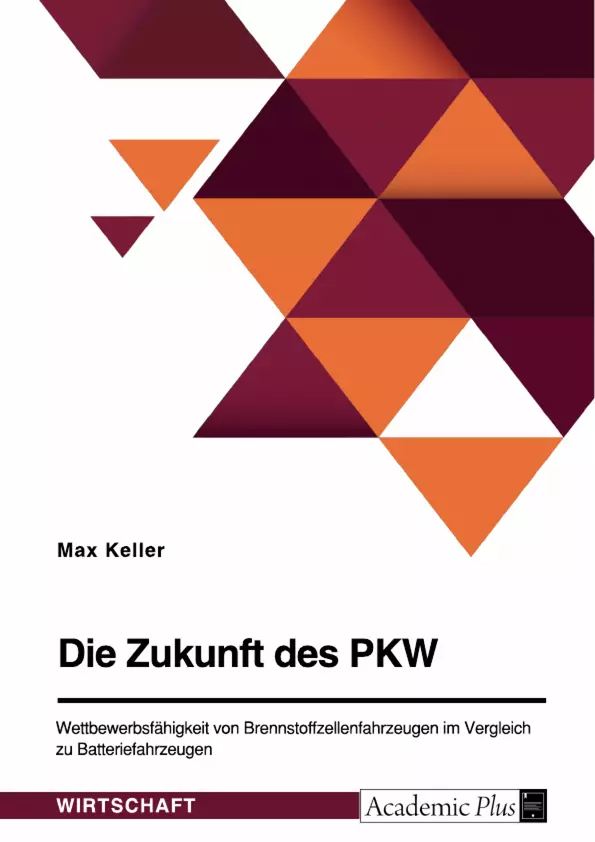Zielsetzung der Arbeit soll es sein, zu untersuchen, ob die Technologie der Brennstoffzelle im Vergleich zu Batteriefahrzeugen wettbewerbsfähig ist bzw. noch werden kann. Die Forschungsfrage das Ziel, eine neutrale und zielgerichtete Auseinandersetzung mit den Antriebstechnologien des batteriebetriebenen und wasserstoffbetriebenen Elektrofahrzeugs zu ermöglichen. Hierbei soll der aktuelle Entwicklungsstand beider Technologien unter verschiedenen Blickwinkeln analysiert wer-den, um eine Aussage darüber treffen zu können, ob Wasserstofffahrzeuge im Bereich der PKW gegenüber Batteriefahrzeugen konkurrenzfähig sein können.
Ebenso wird versucht, die verschiedenen Entwicklungsstände beider Technologien zu berücksichtigen sowie eine Prognose für die zukünftige Entwicklung der verschiedenen Antriebskonzepte zu tätigen. Da die Thematik der aktuellen und zukünftigen Entwicklung neuer Antriebsarten sehr weitreichend ist, wird eine Eingrenzung auf den europäischen Markt und auf die Klasse der PKW vorgenommen. Die strengen EU-Vorschriften bezüglich der Emissionen von PKW, die innerhalb der europäischen Unionen zugelassen werden, drängt die Hersteller auf dem europäischen Markt zu einer schnellen Anpassung der hergestellten Fahrzeuge an die gültigen Gesetze.
Die Analyse der Wettbewerbsfähigkeit von Brennstoffzellenfahrzeugen gegenüber Batteriefahrzeugen ist aus vielen verschiedenen Blickwinkel möglich. Um eine mehrdimensionale Untersuchung aus verschiedenen Standpunkten zu ermöglichen, wird sich dem Modell der PESTEL-Analyse bedient. Hierbei wird ein Unternehmen oder eine Technologie eingebettet in das Makroumfeld betrachtet, welches durch verschiedene äußere Einflussfaktoren geprägt wird. Durch die Aufteilung der Analyse nach politischen (political), wirtschaftlichen (economic), sozio-kulturellen (social), technologischen (technological), ökologischen (environmental) und rechtlichen Einflussfaktoren (law), ist eine mehrdimensionale Betrachtung unter verschiedenen Rahmenbedingungen möglich.
Dieses Element bildet den Hauptteil der Ausarbeitung. Aus den angestellten Überlegungen und Eingrenzungen resultiert somit folgende Forschungsfrage für die wissenschaftliche Arbeit: Sind Brennstoffzellenfahrzeuge unter Betrachtung der Umfeldfaktoren nach PESTEL trotz der weit fortgeschrittenen Entwicklung und Einführung des Batteriefahrzeugs noch wettbewerbsfähig?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Problemstellung
- 1.1. Motivation und Zielsetzung
- 1.2. Methodisches Vorgehen
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1. Betrachtung der Automobilindustrie – Ist-Zustand
- 2.2. Rolle des Sektors Verkehr im Klimawandel
- 2.3. Umfeldanalyse nach PESTEL
- 3. Durchführung der PESTEL-Analyse
- 3.1. Politische und rechtliche Einflussfaktoren
- 3.1.1. Vorgaben aus der Politik als Rahmenbedingung
- 3.1.2. Weitere politische und rechtliche Einflussfaktoren
- 3.2. Technische Einflussfaktoren
- 3.2.1. Beschreibung der Technologie
- 3.2.2. Nutzen und Reifegrad der Technologien
- 3.2.3. Betrachtung des Wirkungsgrads
- 3.2.4. Technischer Vergleich und Herausforderungen
- 3.2.5. Zwischenfazit – Technische Einflussfaktoren
- 3.3. Ökologische Einflussfaktoren
- 3.3.1. Ökologischer Vergleich anhand des CO2-Ausstoßes
- 3.3.1.1. Bewertung der Technologien anhand des Well-to-Wheel CO2-Ausstoßes
- 3.3.1.2. Erweiterte Betrachtung des CO2-Ausstoßes über den gesamten Lebenszyklus
- 3.3.2. Energiebedarf für den Sektor Verkehr
- 3.3.3. Rohstoffe und Recycling
- 3.3.4. Zwischenfazit - Ökologische Einflussfaktoren
- 3.4. Ökonomische Einflussfaktoren
- 3.4.1. Marktanalyse und wirtschaftliche Einflussfaktoren
- 3.4.2. Betrachtung der benötigten Infrastruktur
- 3.4.3. Synergien durch den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft
- 3.4.4. Zwischenfazit – Ökonomische Einflussfaktoren
- 3.5. Sozio-kulturelle Einflussfaktoren
- 3.5.1. Soziale Akzeptanz
- 3.5.2. Nutzungsverhalten und Wandel im urbanen Raum
- 3.5.3. Weitere zu benennende soziale Einflussfaktoren
- 3.5.4. Zwischenfazit – Sozio-kulturelle Einflussfaktoren
- 4. Abschließende Bewertung
- 5. Kritische Reflexion
- 6. Ausblick
- 7. Anhang
- Einfluss politischer und rechtlicher Rahmenbedingungen auf die Entwicklung und Verbreitung beider Technologien
- Technologischer Vergleich der Brennstoffzellen- und Batterietechnologie bezüglich Wirkungsgrad, Reifegrad und Herausforderungen
- Ökologische Bewertung unter Berücksichtigung von Well-to-Wheel-Emissionen und des gesamten Lebenszyklus
- Wirtschaftliche Aspekte wie Anschaffungskosten, Betriebskosten und notwendige Infrastrukturen
- Sozio-kulturelle Faktoren wie Akzeptanz, Nutzungsverhalten und soziale Auswirkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wettbewerbsfähigkeit von Brennstoffzellenfahrzeugen im Vergleich zu Batteriefahrzeugen auf dem europäischen PKW-Markt. Die Analyse berücksichtigt die aktuellen Entwicklungen und Prognosen für die Zukunft beider Technologien.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Problemstellung: Dieses Kapitel beschreibt den Wandel im Markt der Personenkraftwagen und die Notwendigkeit emissionsarmer Antriebskonzepte aufgrund verschärfter EU-Vorgaben zum CO2-Ausstoß. Es werden batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) und Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV) als mögliche Lösungen vorgestellt, wobei die Forschungsfrage nach der Wettbewerbsfähigkeit von FCEV im Vergleich zu BEV formuliert wird.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse. Es beschreibt die Bedeutung der Automobilindustrie für die europäische Wirtschaft, die Rolle des Verkehrssektors im Klimawandel und erläutert das methodische Vorgehen der PESTEL-Analyse, welche die Basis für die weitere Untersuchung bildet.
3. Durchführung der PESTEL-Analyse: Dieser umfangreiche Abschnitt untersucht die Wettbewerbsfähigkeit von FCEV gegenüber BEV unter verschiedenen Blickwinkeln, basierend auf der PESTEL-Analyse (politische, wirtschaftliche, sozio-kulturelle, technologische, ökologische und rechtliche Faktoren). Jeder Faktor wird einzeln analysiert und mit Zwischenfazits versehen.
4. Abschließende Bewertung: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der PESTEL-Analyse zusammen und bewertet die Wettbewerbsfähigkeit von FCEV im Vergleich zu BEV unter Berücksichtigung der verschiedenen Einflussfaktoren. Es wird festgestellt, dass BEV derzeit einen deutlichen Vorteil aufweisen.
5. Kritische Reflexion: Hier wird die Methodik der Arbeit kritisch reflektiert, insbesondere die Limitationen der PESTEL-Analyse und die Notwendigkeit der Gewichtung von Argumentationspunkten werden hervorgehoben. Die Auswahl und Fokussierung auf einzelne Themen werden ebenfalls kritisch beleuchtet, sowie die Notwendigkeit einer kritischen Betrachtung der verwendeten Forschungsstudien.
6. Ausblick: Das Kapitel skizziert weitere Forschungsfragen und mögliche zukünftige Entwicklungen, die die Wettbewerbsfähigkeit der beiden Technologien beeinflussen könnten, u.a. der Einsatz in anderen Verkehrssektoren und der Einfluss der Entwicklung synthetischer Kraftstoffe.
Schlüsselwörter
Brennstoffzellenfahrzeug (FCEV), Batterieelektrisches Fahrzeug (BEV), Elektromobilität, Wasserstoff, CO2-Emissionen, PESTEL-Analyse, Klimawandel, Energiewende, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, soziale Akzeptanz, Infrastruktur, Technologiereifegrad, Well-to-Wheel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Wettbewerbsfähigkeit von Brennstoffzellen- und Batteriefahrzeugen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Wettbewerbsfähigkeit von Brennstoffzellenfahrzeugen (FCEV) im Vergleich zu batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) auf dem europäischen PKW-Markt. Die Analyse berücksichtigt aktuelle Entwicklungen und Prognosen für beide Technologien.
Welche Methode wird verwendet?
Die Analyse basiert auf einer PESTEL-Analyse, die politische, wirtschaftliche, sozio-kulturelle, technologische, ökologische und rechtliche Faktoren untersucht. Jeder Faktor wird einzeln analysiert und bewertet.
Welche Faktoren werden in der PESTEL-Analyse betrachtet?
Die PESTEL-Analyse umfasst detaillierte Untersuchungen folgender Faktoren: Politische und rechtliche Rahmenbedingungen, technologische Aspekte (Wirkungsgrad, Reifegrad, Herausforderungen), ökologische Auswirkungen (Well-to-Wheel-Emissionen, Lebenszyklus), wirtschaftliche Aspekte (Anschaffungskosten, Betriebskosten, Infrastruktur), und sozio-kulturelle Faktoren (Akzeptanz, Nutzungsverhalten).
Wie werden die ökologischen Auswirkungen bewertet?
Die ökologische Bewertung berücksichtigt den Well-to-Wheel-CO2-Ausstoß und den CO2-Ausstoß über den gesamten Lebenszyklus beider Fahrzeugtypen.
Welche wirtschaftlichen Aspekte werden berücksichtigt?
Die wirtschaftliche Analyse umfasst Anschaffungskosten, Betriebskosten und den Bedarf an entsprechender Infrastruktur für beide Technologien.
Welche sozio-kulturellen Faktoren spielen eine Rolle?
Die Analyse berücksichtigt die soziale Akzeptanz, das Nutzungsverhalten und die sozialen Auswirkungen beider Fahrzeugtypen.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass BEV derzeit einen deutlichen Wettbewerbsvorteil gegenüber FCEV aufweisen. Die genauen Gründe werden detailliert in der PESTEL-Analyse dargelegt.
Welche kritischen Aspekte werden angesprochen?
Die Arbeit reflektiert kritisch die Limitationen der PESTEL-Analyse, die Gewichtung der Argumentationspunkte, die Auswahl der Themen und die verwendete Forschungsliteratur.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die Darstellung theoretischer Grundlagen, die Durchführung der PESTEL-Analyse, eine abschließende Bewertung, eine kritische Reflexion, einen Ausblick und einen Anhang. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis ist enthalten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Brennstoffzellenfahrzeug (FCEV), Batterieelektrisches Fahrzeug (BEV), Elektromobilität, Wasserstoff, CO2-Emissionen, PESTEL-Analyse, Klimawandel, Energiewende, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, soziale Akzeptanz, Infrastruktur, Technologiereifegrad, Well-to-Wheel.
- Citation du texte
- Max Keller (Auteur), 2021, Die Zukunft des PKW. Wettbewerbsfähigkeit von Brennstoffzellenfahrzeugen im Vergleich zu Batteriefahrzeugen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1382100