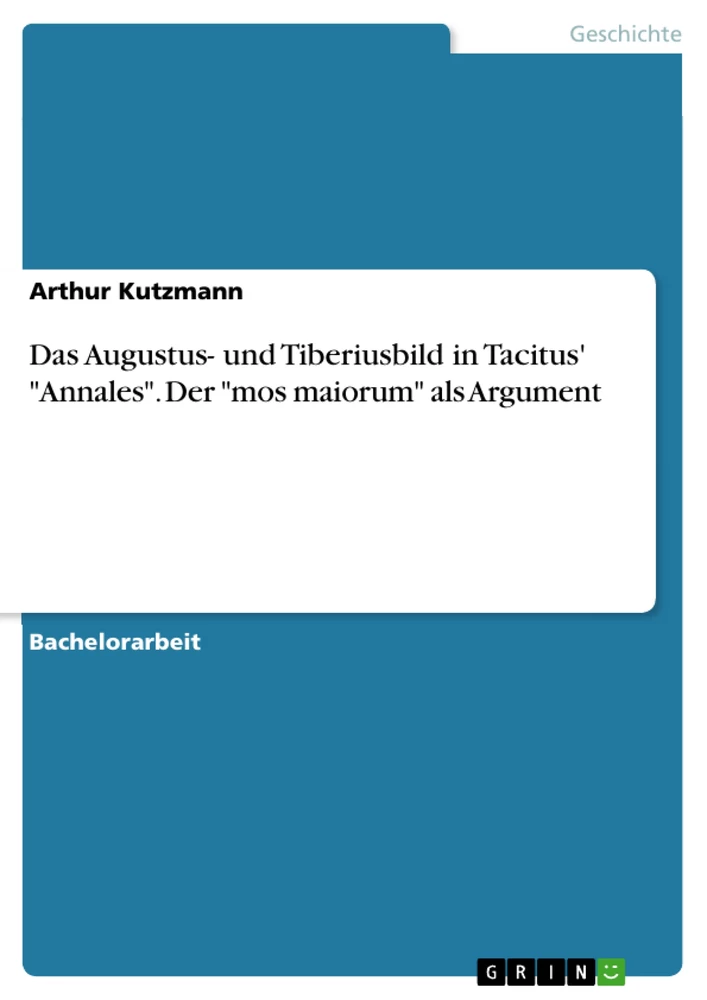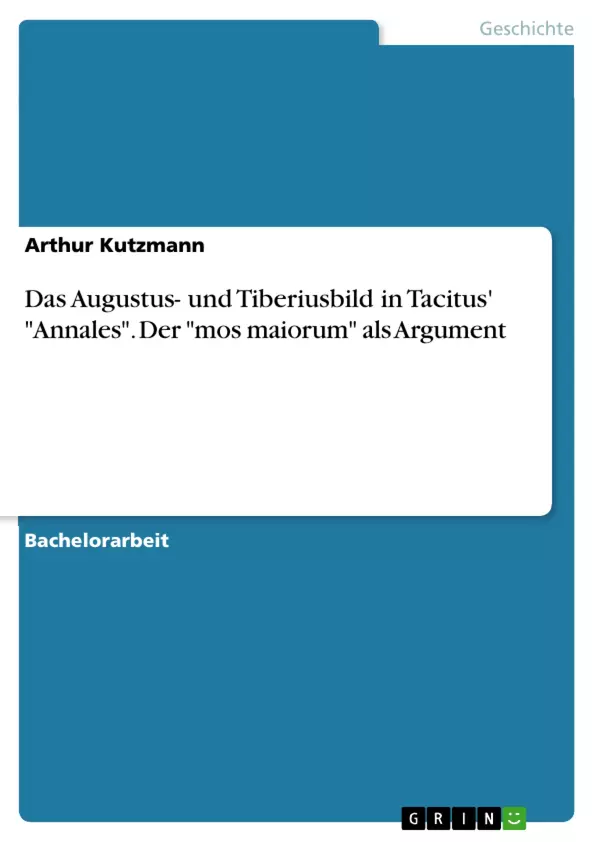Ziel dieser Arbeit ist es, erst einmal das grundlegende Argumentationspotential des "mos maiorum" in Tacitus‘ Augustus- und Tiberiusbild aufzuzeigen. Über Tacitus‘ spezifischen Gebrauch des argumentativen "mos maiorum", lassen sich die von Tacitus möglicherweise korrumpierten Kaiserbilder entlarven. Sollte sie die Methodik als geeignetes Mittel erweisen, wäre es insofern hilfreich, als dass man die Kaiserdarstellungen nicht zwangsläufig gegenhalten muss (z.B. an Suetons oder Dios Darstellungen), um Konstruktionen und Abweichungen vom ‚realen‘ Bild zu erkennen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Tacitus - Zeitzeuge des politischen Umbruchs
- 2.1. Literarische Einordnung der Annales
- 2.2. Moralgeschichte - Tacitus in der Tradition senatorischer Gegenwarts-/Vergangenheitsdeutung
- 2.3. Der mos maiorum - Vom „Maß aller Dinge“ zum Argument
- 3. Begriffstheoretische Voraussetzungen – Der mos maiorum als dynamisches Konzept
- 3.1. mos maiorum – Begriffsgeschichte
- 3.2. Der Verhaltens- und Tugendkodex des mos maiorum – exempla virtutis
- 3.3. Annullierung des methodischen Einwandes – Der republikanische mos maiorum als taciteisches Argument in der Kaiserzeit?
- 4. Tacitus Konstruktion des Augustus- und Tiberiusbildes
- 4.1. Augustus - Begründer des Prinzipates und Ursprung allen Übels
- 4.2. Tiberius Zwischen „gut“ und „böse“
- 4.2.1. Senatssitzung: Luxusproblem und Sittenverfall I
- 4.2.2. Crimen laesae maiestatis I
- 4.2.3. Germanicus’ Tod und Beisetzung
- 4.2.4. Crimen laesae maiestatis II
- 4.2.5. Brief an Senat: Luxusproblem und Sittenverfall II
- 4.2.6. Tiberius’ Rüge für Drusus
- 4.2.7. Der mos maiorum als tiberianisches Handlungsparadigma
- 5. Tacitus Geschichtsbild
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Augustus- und Tiberiusbild in Tacitus' Annalen, indem sie den "mos maiorum" als zentrales Argumentationsmittel analysiert. Ziel ist es, das Argumentationspotential des "mos maiorum" aufzuzeigen und zu beleuchten, wie Tacitus dieses Konzept verwendet, um die Kaiserbilder zu konstruieren und möglicherweise zu "korrumpieren". Die Methode soll dabei helfen, die Kaiserdarstellungen ohne direkten Vergleich mit anderen Quellen zu überprüfen.
- Der "mos maiorum" als dynamisches Konzept und Argumentationsmittel in Tacitus' Annalen.
- Die Konstruktion der Augustus- und Tiberiusbilder durch Tacitus.
- Die Rolle des "mos maiorum" bei der Bewertung der Handlungen der Kaiser.
- Tacitus' Geschichtsbild und seine Positionierung gegenüber dem Prinzipat.
- Die literarische Einordnung der Annalen und ihre Stellung in der Tradition römischer Geschichtsschreibung.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Augustus- und Tiberiusbild in Tacitus' Annalen unter Berücksichtigung des "mos maiorum" als Argument. Sie skizziert die methodische Vorgehensweise der Arbeit, die in drei Abschnitte gegliedert ist: historische Einordnung Tacitus, begriffliche Klärung des "mos maiorum" und die Analyse des Augustus- und Tiberiusbildes unter Berücksichtigung des "mos maiorum".
2. Tacitus - Zeitzeuge des politischen Umbruchs: Dieses Kapitel widmet sich der Einordnung Tacitus in seinen historischen Kontext. Es beleuchtet sein Leben und seine Erfahrungen als Zeitzeuge des politischen Umbruchs vom Prinzipat. Die literarische Einordnung der Annalen in den Gesamtkontext von Tacitus' Werk und in die Tradition der römischen Geschichtsschreibung wird erörtert. Besondere Aufmerksamkeit erhält die Bedeutung des "mos maiorum" für die senatorische Geschichtsschreibung und seine Übertragung auf Tacitus' Werk. Die Kapitel behandelt die Positionierung des Autors gegenüber dem Prinzipat und dessen Herrschern.
3. Begriffstheoretische Voraussetzungen – Der mos maiorum als dynamisches Konzept: Dieses Kapitel befasst sich mit der begrifflichen Klärung des "mos maiorum". Es analysiert die Begriffsgeschichte und erarbeitet einen Verhaltens- und Tugendkodex, der dem "mos maiorum" als Argument einen greifbaren Rahmen verleiht. Ein methodischer Einwand bezüglich der Anwendbarkeit eines republikanischen Konzepts auf die Kaiserzeit wird diskutiert und widerlegt.
4. Tacitus Konstruktion des Augustus- und Tiberiusbildes: Die Analyse konzentriert sich auf die Darstellung von Augustus und Tiberius in den Annalen. Das Kapitel untersucht, inwiefern der "mos maiorum" als Argument für eine positive oder negative Bewertung der beiden Kaiser fungiert. Es wird analysiert, wie Tacitus den "mos maiorum" verwendet, um seine Konstruktion der Kaiserbilder zu stützen, und welche Rolle dabei die jeweiligen Handlungen der Kaiser im Verhältnis zum traditionellen Wertkanon spielen.
5. Tacitus Geschichtsbild: Dieses Kapitel zieht Schlussfolgerungen aus der Analyse des "mos maiorum" als Argumentationsmittel in der Darstellung von Augustus und Tiberius. Es beleuchtet, wie Tacitus' spezifischer Gebrauch des "mos maiorum" sein Geschichtsbild und seine Sicht auf das Prinzipat prägt.
Schlüsselwörter
Tacitus, Annalen, Augustus, Tiberius, mos maiorum, Prinzipat, Republik, Sittenverfall, Geschichtsbild, Kaiserbild, Argumentation, Konstruktion, Dekonstruktion, senatorische Geschichtsschreibung.
Häufig gestellte Fragen zu: Tacitus' Annalen - Augustus und Tiberius im Lichte des mos maiorum
Was ist das zentrale Thema der Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Darstellung von Augustus und Tiberius in Tacitus' Annalen, wobei der Fokus auf dem "mos maiorum" als zentrales Argumentationsmittel liegt. Es wird untersucht, wie Tacitus dieses Konzept verwendet, um die Kaiserbilder zu konstruieren und zu bewerten.
Welche Forschungsfrage wird behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage untersucht, wie Tacitus' Augustus- und Tiberiusbild in den Annalen durch den Gebrauch des "mos maiorum" geprägt ist und welche Funktion dieses Konzept in seiner Argumentation einnimmt.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit analysiert die Darstellung der Kaiser anhand des "mos maiorum" ohne direkten Vergleich mit anderen Quellen. Die methodische Vorgehensweise gliedert sich in drei Abschnitte: historische Einordnung Tacitus, begriffliche Klärung des "mos maiorum" und die Analyse der Kaiserbilder im Kontext des "mos maiorum".
Was ist der "mos maiorum"?
Der "mos maiorum" bezeichnet die Sitten und Gebräuche der römischen Vorfahren, die als Verhaltens- und Tugendkodex galten. Die Arbeit analysiert dessen Begriffsgeschichte und erarbeitet einen konkreten Verhaltens- und Tugendkodex, um dessen Anwendung in Tacitus' Argumentation zu untersuchen.
Wie wird der "mos maiorum" in der Arbeit verwendet?
Der "mos maiorum" dient als zentrales analytisches Werkzeug, um die von Tacitus konstruierten Kaiserbilder zu untersuchen. Es wird analysiert, wie Tacitus dieses Konzept verwendet, um die Handlungen der Kaiser positiv oder negativ zu bewerten und seine eigene Positionierung zum Prinzipat zum Ausdruck zu bringen.
Wie werden Augustus und Tiberius dargestellt?
Die Arbeit untersucht, inwiefern der "mos maiorum" als Argument für eine positive oder negative Bewertung von Augustus und Tiberius in den Annalen dient. Es wird analysiert, wie Tacitus das Konzept einsetzt, um seine Darstellung der beiden Kaiser zu stützen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Tacitus als Zeitzeuge, begriffliche Klärung des "mos maiorum", Analyse der Augustus- und Tiberiusbilder, Tacitus' Geschichtsbild und Fazit.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen aus der Analyse des "mos maiorum" als Argumentationsmittel in der Darstellung von Augustus und Tiberius. Es wird beleuchtet, wie Tacitus' spezifischer Gebrauch des "mos maiorum" sein Geschichtsbild und seine Sicht auf das Prinzipat prägt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Tacitus, Annalen, Augustus, Tiberius, mos maiorum, Prinzipat, Republik, Sittenverfall, Geschichtsbild, Kaiserbild, Argumentation, Konstruktion, Dekonstruktion, senatorische Geschichtsschreibung.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht und richtet sich an Leser, die sich mit Tacitus' Annalen, dem Prinzipat und der römischen Geschichte auseinandersetzen. Die OCR-Daten dienen der akademischen Analyse von Themen in strukturierter und professioneller Weise.
- Citar trabajo
- Arthur Kutzmann (Autor), 2019, Das Augustus- und Tiberiusbild in Tacitus' "Annales". Der "mos maiorum" als Argument, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1382255