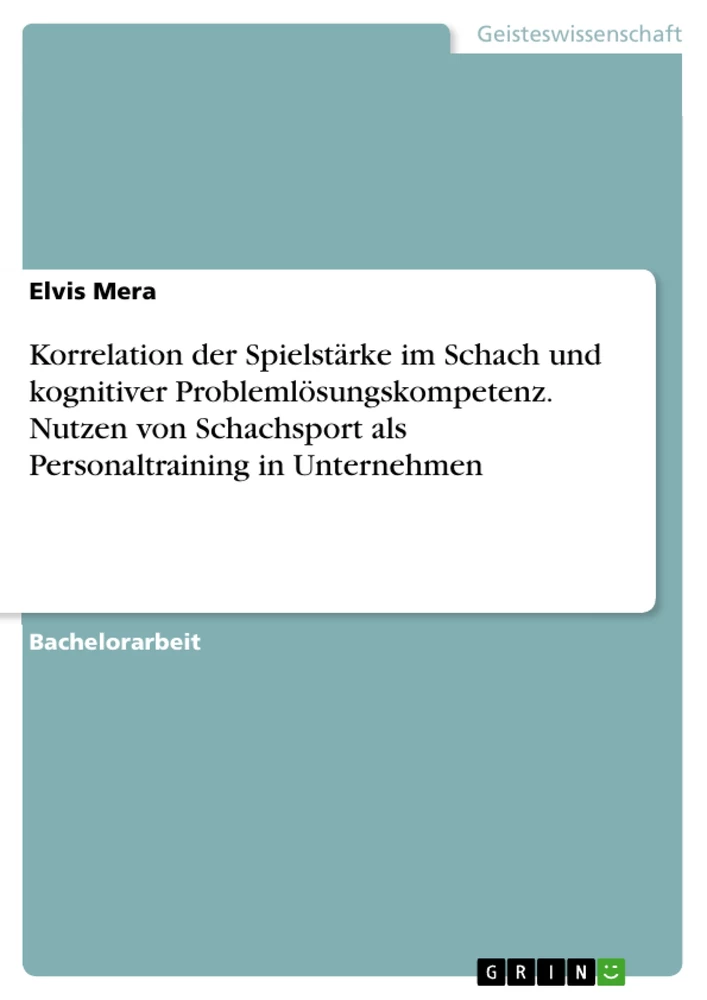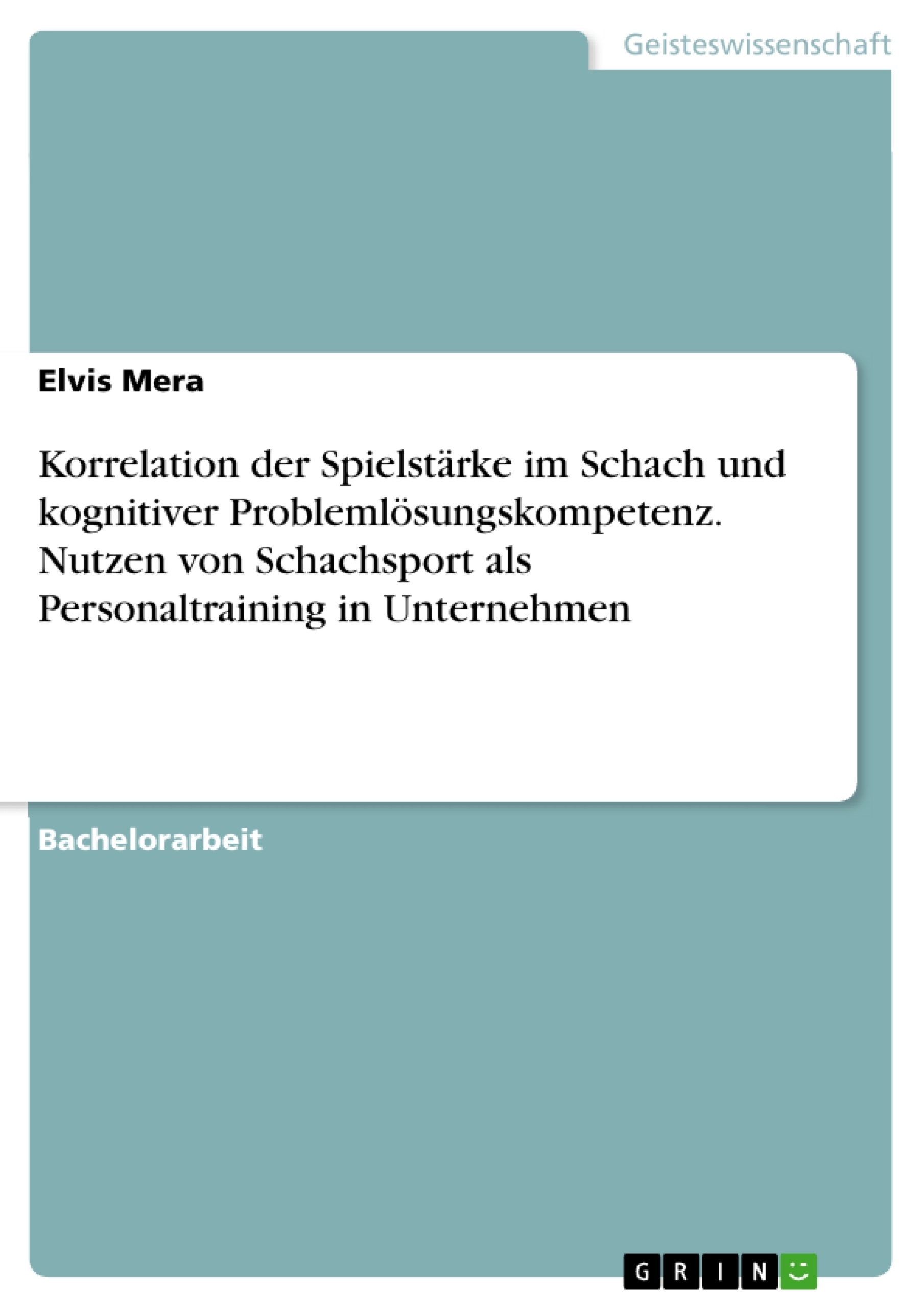In einem Online-Assessment wurden die kognitiven Problemlösungskompetenzen von Schachspielern bewertet und diese Wertung auf einen Zusammenhang zur Spielstärke im Schach hin untersucht. Das Resultat zeigte eine schwach positive signifikante Korrelation zwischen dem Resultat des Assessments im kognitiven Problemlösen und der Elo-Wertungszahl der Schachspieler. Gründe dafür konnten nicht in der Demografie oder in den Schachmetriken der Teilnehmer gefunden werden. Die theoretischen Ansätze deuten an, dass stärkere Schachspieler im Spiel über eine bessere Mustererkennung verfügen als schwächere Spieler. Dies legt die Vermutung nahe, dass eine bessere Mustererkennung den kognitiven Problemlösungsprozess unterstützt und somit die Problemlöser bessere Ergebnisse, unterstützt durch die zu den Mustern gespeicherten Lösungen, liefern können.
Durch die höhere Bearbeitungszeit der Aufgabenstellungen durch Schachspieler im Vergleich zur Kontrollgruppe konnte die bestehende Forschung repliziert werden. Eine neue Erkenntnis ist eine sich nach oben verschiebende Normalverteilung der Bearbeitungszeit, je höher die Spielstärkeklasse der teilnehmenden Schachspieler ist. Dies deutet darauf hin, dass Schach die Motivation, Beharrlichkeit und Suchtiefe der Problemlöser fördert. Abschließendes Fazit ist, dass sich ein Nutzen von Schachsport für die Wirtschaft als Training der Musterspeicherung und -erkennung sowie der Bildung und Stärkung von Persönlichkeitsmerkmalen herauskristallisiert.
Inhaltsverzeichnis
- I. Abstract
- II. Vorwort
- III. Inhaltsverzeichnis
- IV. Abkürzungsverzeichnis
- V. Tabellenverzeichnis
- VI. Abbildungsverzeichnis
- 1. Beschreibung und Ausgangslage der Thesis
- 1.1 Thema
- 1.2 Einleitung
- 1.3 Hypothese der Thesis
- 1.4 Erläuterungen zur Hypothese der Thesis
- 1.5 Nutzen und Relevanz der Thesis
- 1.6 Fragestellung und Ziele der Thesis
- 1.7 Hypothesen und Forschungsfragen der Thesis
- 1.8 Erwartete Ergebnisse der Studie dieser Thesis
- 1.9 Methodisches Vorgehen in der Thesis
- 1.9.1 Überblick der Arbeitsschritte im methodischen Vorgehen der Thesis
- 1.9.2 Notwendige Bezüge zu bestehenden Theorien
- 1.9.3 Online-Assessment
- 1.9.4 Demografische Daten Online-Assessment
- 1.9.5 Im Online-Assessment abzufragende Schachmetriken
- 1.10 Auswertungen Problemlösung Online-Assessment
- 2. Das Brettspiel Schach
- 2.1 Geschichte
- 2.2 Gesellschaftliche Bedeutung des Schachspiels
- 2.2.1 Kulturelle Verankerung des Schachspiels
- 2.2.2 Vergleich Schachspieler mit Computerspieler
- 2.2.3 Schach als Sport
- 2.2.4 Herausforderungen für die Zukunft des Schachsports
- 2.3 Die Wertungszahl Elo im Schachsport
- 2.3.1 Beschreibung und Grundprinzip der Wertungszahl Elo
- 2.3.2 Geschichte der Wertungszahl Elo
- 2.3.3 Berechnung der Wertungszahl Elo
- 2.4 Schachpsychologie
- 2.4.1 Geschichte der Schachpsychologie
- 2.4.2 Forschungsstand Schachpsychologie
- 2.4.3 Motivation zum Schachspiel
- 2.4.4 Schach und lebenslanges Lernen
- 2.4.5 Schach als Wissenschaft
- 2.4.6 Denkmethoden im Schach
- 2.4.7 Prozesse von Schachspielern in der Problemlösung
- 2.5 Schachsport und Nutzen für die Wirtschaft
- 2.5.1 Prozesse und Leistung in der Problemlösung von Schachspielern
- 2.5.2 Heuristiken beim Urteilen und Entscheiden der Problemlösung von Schachspielern
- 2.5.3 Psychometrische Erkenntnisse und Daten von Schachspielern im Vergleich mit Nicht-Schachspielern
- 2.5.4 Leistung in der Problemlösung von Schachspielern im Vergleich mit Nicht-Schachspieler
- 3. Theoretische Grundlagen der kognitiven Psychologie des Problemlösens
- 3.1 Einleitung in die Psychologie des Problemlösens
- 3.2 Definition kognitives Problemlösen
- 3.3 Das Verhalten und die Handlung
- 3.4 Definition von Zielen
- 3.5 Zielkonflikte in polytelischen Situationen
- 3.6 Polytelische Situationen in Strategiespielen
- 3.7 Modell der Handlungsphasen nach Heinz Heckhausen 1980
- 3.7.1 Erste Phase des Rubikon-Modells (Abwägen von Realisierbarkeit des Zieles)
- 3.7.2 Zweite Phase des Rubikon-Modells (Planung des Handelns)
- 3.7.3 Dritte Phase des Rubikon-Modells (Realisierung)
- 3.7.4 Vierte Phase des Rubikon-Modells (Evaluation der Zielerreichung)
- 3.8 Phasen des kognitiven Problemlösens
- 3.8.1 Erste Phase des kognitiven Problemlösens (Problemidentifikation)
- 3.8.2 Zweite Phase des kognitiven Problemlösens (Ziel und Situationsanalyse)
- 3.8.3 Dritte Phase des kognitiven Problemlösens (Planerstellung)
- 3.8.4 Vierte Phase des kognitiven Problemlösens (Planausführung)
- 3.8.5 Fünfte Phase des kognitiven Problemlösens (Evaluation)
- 3.9 Zusammenhang zwischen dem Modell der Handlungsphasen und dem Modell des kognitiven Problemlösens
- 3.10 Unterschiedliche Arten von Problemen, Problemlösungen und Problemlösern
- 3.10.1 Verschiedene Arten von Problemen
- 3.10.2 Dimensionen des einfachen und komplexen Problemlösens
- 3.10.3 Unterschiede zwischen Problemsituationen im Alltag und im Schach
- 3.11 Verschiedene Arten von Problemlösern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der Spielstärke im Schach und der kognitiven Problemlösungskompetenz. Ziel der Arbeit ist es, die Hypothese zu überprüfen, dass Schachspieler im Vergleich zu Nicht-Schachspielern über bessere Problemlösungskompetenzen verfügen.
- Korrelation zwischen Schachspielstärke und kognitiver Problemlösungskompetenz
- Einfluss von Schach auf kognitive Prozesse wie Mustererkennung und Entscheidungsfindung
- Analyse von Schachspielern und Nicht-Schachspielern im Hinblick auf Problemlösefähigkeiten
- Relevanz von Schach für die Entwicklung von Problemlösungskompetenzen in der Wirtschaft
- Potenzial von Schach als Trainingstool für kognitive Fähigkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Thesis vorgestellt und die Ausgangslage erläutert. Die Hypothese der Arbeit wird formuliert und erläutert, sowie die Relevanz und der Nutzen der Arbeit für die Praxis aufgezeigt. Die Fragestellung und die Ziele der Arbeit werden definiert und die erwarteten Ergebnisse der Studie beschrieben. Das methodische Vorgehen der Arbeit wird skizziert, die notwendigen Bezüge zu bestehenden Theorien werden hergestellt und das Online-Assessment als Methode vorgestellt.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Brettspiel Schach. Die Geschichte des Schachspiels, seine gesellschaftliche Bedeutung und seine kulturelle Verankerung werden beleuchtet. Es wird auf den Vergleich von Schachspielern mit Computerspielern und die Bedeutung des Schachsports eingegangen. Die Wertungszahl Elo im Schachsport wird erklärt, und die Schachpsychologie sowie die Motivation zum Schachspiel werden behandelt. Die Denkmethoden im Schach werden beschrieben und die Prozesse von Schachspielern in der Problemlösung analysiert.
Das dritte Kapitel behandelt die theoretischen Grundlagen der kognitiven Psychologie des Problemlösens. Die Definition des kognitiven Problemlösens, das Verhalten und die Handlung sowie die Definition von Zielen werden erörtert. Das Rubikon-Modell der Handlungsphasen nach Heinz Heckhausen wird vorgestellt und die Phasen des kognitiven Problemlösens werden beschrieben. Der Zusammenhang zwischen dem Modell der Handlungsphasen und dem Modell des kognitiven Problemlösens wird erläutert. Verschiedene Arten von Problemen, Problemlösungen und Problemlösern werden aufgezeigt, sowie die Unterschiede zwischen Problemsituationen im Alltag und im Schach.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Problemlösen, Schach, Kognitionspsychologie, Psychologie, Online Assessment, Mustererkennung, Heuristiken, Schachpsychologie, Expertensysteme, Expertise, Strategien, Entscheidungsfindung, kognitive Fähigkeiten, kognitive Prozesse, Problemlösungskompetenz, kognitive Leistung, Denkprozesse, Wissensrepräsentation und Wissensverarbeitung.
Häufig gestellte Fragen
Besteht ein Zusammenhang zwischen Schachstärke und Problemlösungskompetenz?
Ja, die Studie zeigt eine schwach positive Korrelation. Stärkere Schachspieler verfügen oft über eine bessere Mustererkennung, die den kognitiven Problemlösungsprozess unterstützt.
Was ist die Elo-Zahl im Schach?
Die Elo-Zahl ist eine Wertungszahl, die die Spielstärke von Schachspielern basierend auf ihren Spielergebnissen statistisch misst und vergleicht.
Wie beeinflusst Schach die Beharrlichkeit bei Aufgaben?
Schachspieler zeigen oft eine höhere Suchtiefe und längere Bearbeitungszeiten bei komplexen Aufgaben, was auf eine gesteigerte Motivation und Beharrlichkeit hindeutet.
Was ist das Rubikon-Modell der Handlungsphasen?
Das Modell nach Heinz Heckhausen unterteilt menschliches Handeln in vier Phasen: Abwägen (prädezisinal), Planen (präaktional), Realisieren (aktional) und Bewerten (postaktional).
Welchen Nutzen hat Schach für Unternehmen?
Schach kann als Personaltraining dienen, um strategisches Denken, Musterspeicherung, Entscheidungsfindung unter Zeitdruck und Persönlichkeitsmerkmale wie Suchtiefe zu fördern.
- Quote paper
- Elvis Mera (Author), 2018, Korrelation der Spielstärke im Schach und kognitiver Problemlösungskompetenz. Nutzen von Schachsport als Personaltraining in Unternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1382297