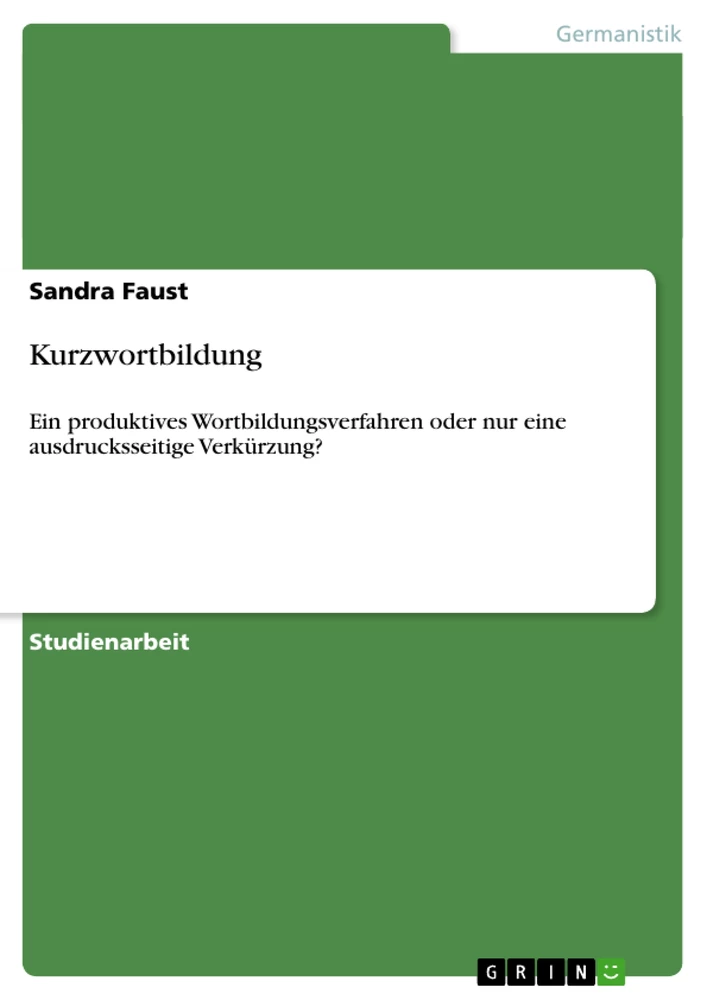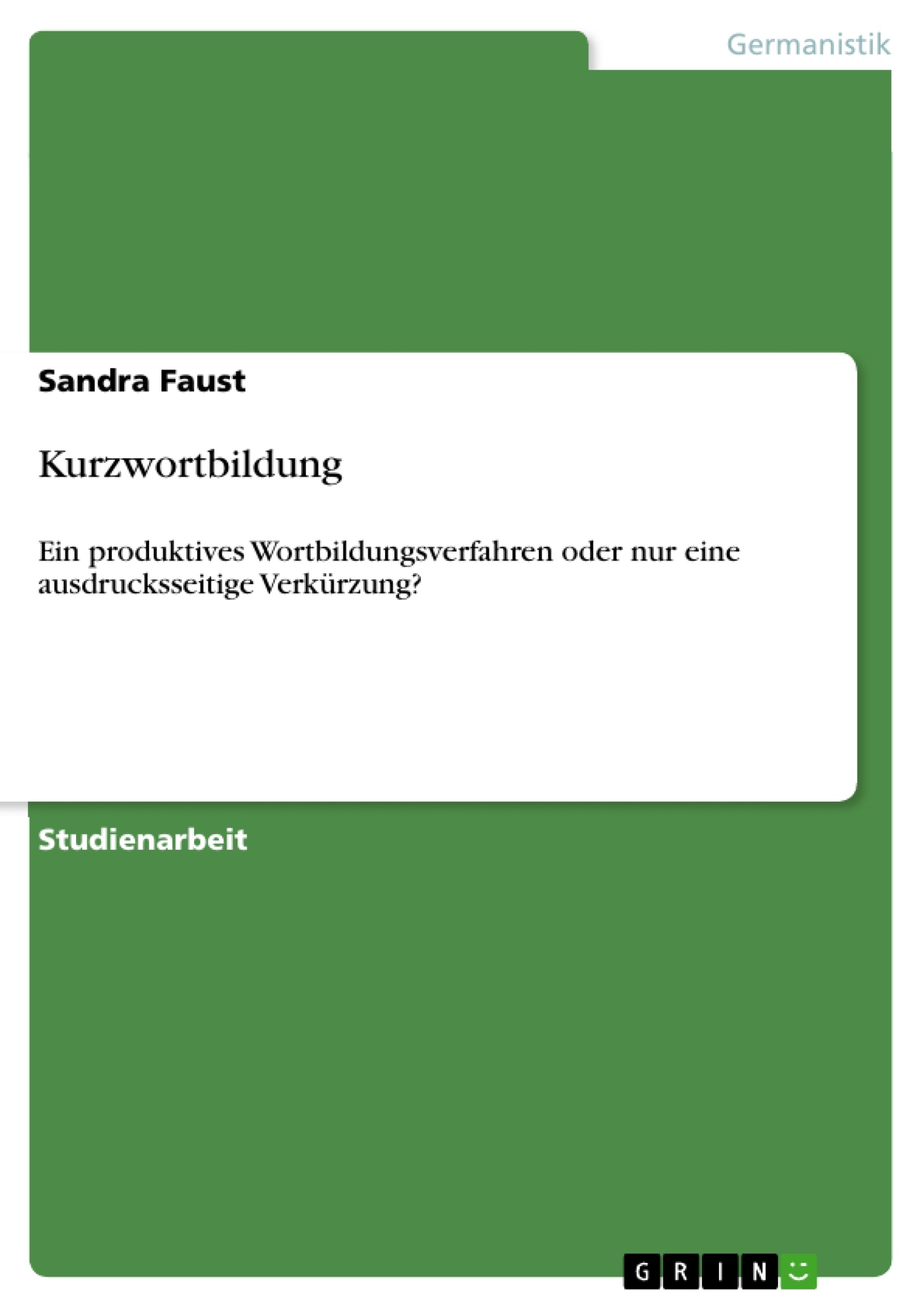Im Bereich der Wortbildungslehre gibt es bis heute keine klare Richtlinie, wie Wortkürzungen einzuordnen sind. Einige Publikationen zählen Kürzungen nicht zur Wortbildung, da ein Kurzwort im Vergleich zu seiner „Vollform[en] nur einen sekundären Status habe“ (Altmann 2005: 40), andere behandeln Kürzungen als Sonderfälle der Wortbildung (vgl. Kobler-Trill 1994, Lohde 2006), oder zählen sie ohne Einschränkungen dazu (vgl. Altmann 2005). Die meisten neigen jedoch dazu die Kurzwortbildung als Wortbildungsverfahren anzuerkennen (Steinhauer 2000: 24f.). Ziel dieser Arbeit ist es nun die verschiedenen Standpunkte der Diskussion über die Rolle von Kurzwörtern in der Wortbildung aufzuzeigen und zum Schluss eine persönliche Stellungnahme zur Problematik zu entwickeln.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Bildung und Funktion von Kurzwörtern
- 3. Diskussion
- 4. Zusammenfassung und Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die kontroverse Frage der Einordnung von Kurzwörtern in die Wortbildungslehre. Ziel ist es, die verschiedenen Standpunkte in der Diskussion darzustellen und eine persönliche Stellungnahme zu formulieren.
- Bildung von Kurzwörtern und deren sprachliche Funktion
- Kontroverse um die Einordnung von Kurzwörtern in die Wortbildung
- Die Rolle von Kurzwörtern in Fachsprachen und Umgangssprache
- Ökonomisierung der Kommunikation durch Kurzwörter
- Potenzielle Missverständnisse durch die Verwendung von Kurzwörtern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Kurzwortbildung ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Einordnung von Kurzwörtern in die Wortbildungslehre vor. Sie hebt die zunehmende Verwendung von Kurzwörtern in der deutschen Sprache hervor, insbesondere in Fachsprachen und Werbung, und erwähnt die kritische Auseinandersetzung mit dieser Entwicklung, die von Sprachverfall bis zu Missverständnissen reicht. Die Einleitung verdeutlicht den bestehenden Mangel an klaren Richtlinien zur Einordnung von Kurzwörtern in der Wortbildungslehre und formuliert das Ziel der Arbeit: die Darstellung verschiedener Standpunkte und die Entwicklung einer persönlichen Stellungnahme.
2. Bildung und Funktion von Kurzwörtern: Dieses Kapitel definiert Kurzwörter als Dubletten zu längeren Wörtern, die durch Reduktion der Vollform entstehen. Es differenziert zwischen Kurzwörtern und Abkürzungen, wobei Kurzwörter sowohl graphisch als auch phonisch realisierbar sind, im Gegensatz zu Abkürzungen, die meist nur schriftlich vorkommen und beim Vorlesen ausgeschrieben werden. Das Kapitel beschreibt die Möglichkeiten der Wortbildung mit Kurzwörtern, vor allem die Bildung von Komposita, und beleuchtet deren Funktion in der Ökonomisierung der Kommunikation, insbesondere in Fachsprachen. Es wird auch auf das Problem der potenziellen Missverständnisse aufgrund der Kürze und Mehrdeutigkeit von Kurzwörtern eingegangen, sowie auf den Aspekt der Konnotationsveränderung durch den Gebrauch von Kurzwörtern.
3. Diskussion: Die Diskussion befasst sich mit der Kernfrage, ob Kurzwörter durch Wortbildung entstehen oder lediglich ausdrucksseitige Verkürzungen darstellen. Sie präsentiert die Argumente beider Standpunkte. Die Argumentation konzentriert sich auf die Frage, ob Kurzwörter als vollwertige Wörter gelten oder nur Varianten ihrer längeren Ausgangsformen sind. Diese Diskussion um die Wortbildungsstatus von Kurzwörtern bildet den Höhepunkt der Auseinandersetzung und vorbereitet die abschließende Stellungnahme.
Schlüsselwörter
Kurzwortbildung, Wortbildung, Abkürzung, Fachsprache, Umgangssprache, Ökonomisierung, Kommunikation, Missverständnis, Synonymie, Wortbildungslehre, Diskussion, Stellungnahme.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Kurzwörter in der Wortbildungslehre
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die kontroverse Frage der Einordnung von Kurzwörtern in die Wortbildungslehre. Sie analysiert die Bildung und Funktion von Kurzwörtern, die Diskussion um ihren Status als eigenständige Wörter und die damit verbundenen sprachlichen und kommunikativen Aspekte.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bildung von Kurzwörtern und deren sprachliche Funktion, die Kontroverse um ihre Einordnung in die Wortbildung, ihre Rolle in Fachsprachen und der Umgangssprache, die Ökonomisierung der Kommunikation durch Kurzwörter und die potenziellen Missverständnisse durch deren Verwendung.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Bildung und Funktion von Kurzwörtern, ein Diskussionskapitel und eine Zusammenfassung mit Stellungnahme. Die Einleitung führt in das Thema ein und formuliert die Forschungsfrage. Kapitel 2 beschreibt die Bildung und Funktion von Kurzwörtern im Detail. Kapitel 3 diskutiert die kontroverse Frage nach dem Wortbildungsstatus von Kurzwörtern. Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und gibt eine persönliche Stellungnahme ab.
Wie werden Kurzwörter in der Arbeit definiert?
Kurzwörter werden als Dubletten zu längeren Wörtern definiert, die durch Reduktion der Vollform entstehen. Ein wichtiger Unterschied zu Abkürzungen wird herausgestellt: Kurzwörter sind sowohl graphisch als auch phonisch realisierbar, im Gegensatz zu Abkürzungen.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie sind Kurzwörter in die Wortbildungslehre einzuordnen? Die Arbeit untersucht, ob Kurzwörter durch Wortbildung entstehen oder lediglich ausdrucksseitige Verkürzungen darstellen und ob sie als vollwertige Wörter gelten oder nur Varianten ihrer längeren Ausgangsformen sind.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Standpunkte zur Einordnung von Kurzwörtern in die Wortbildungslehre und mündet in einer persönlichen Stellungnahme des Autors. Die genaue Schlussfolgerung ist im Kapitel "Zusammenfassung und Stellungnahme" nachzulesen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Seminararbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Kurzwortbildung, Wortbildung, Abkürzung, Fachsprache, Umgangssprache, Ökonomisierung, Kommunikation, Missverständnis, Synonymie, Wortbildungslehre, Diskussion, Stellungnahme.
Für wen ist diese Seminararbeit relevant?
Diese Seminararbeit ist relevant für Studierende der Linguistik, Sprachwissenschaft und Germanistik, die sich mit Wortbildung und der Entwicklung der deutschen Sprache auseinandersetzen. Sie ist auch für alle interessant, die sich für die Funktionsweise und die Herausforderungen der sprachlichen Kommunikation interessieren.
- Citar trabajo
- Sandra Faust (Autor), 2007, Kurzwortbildung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138247