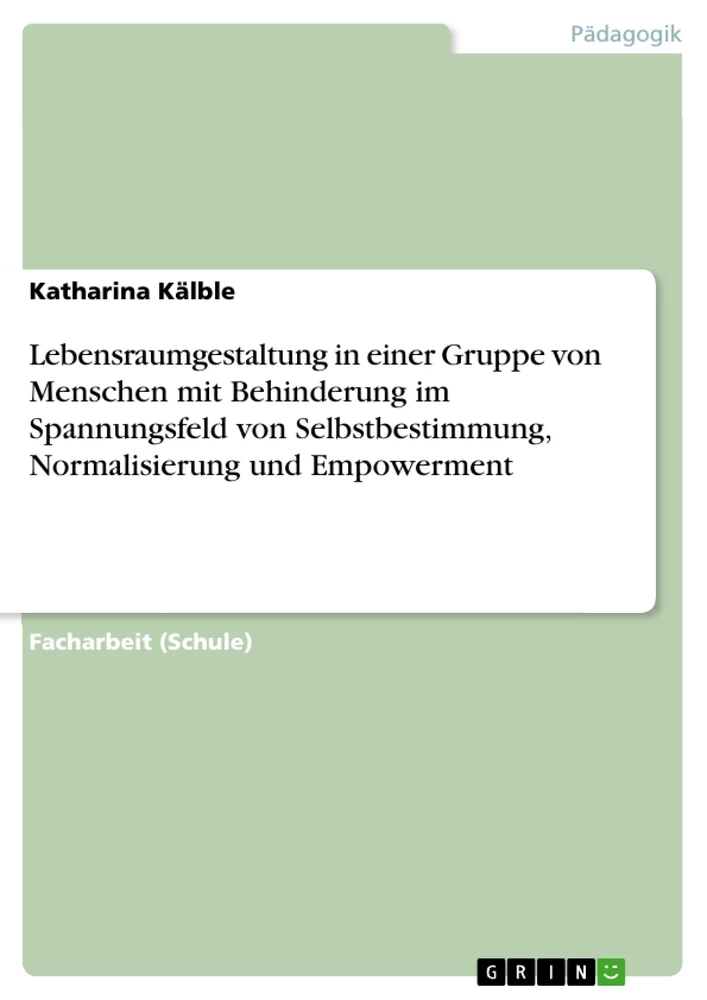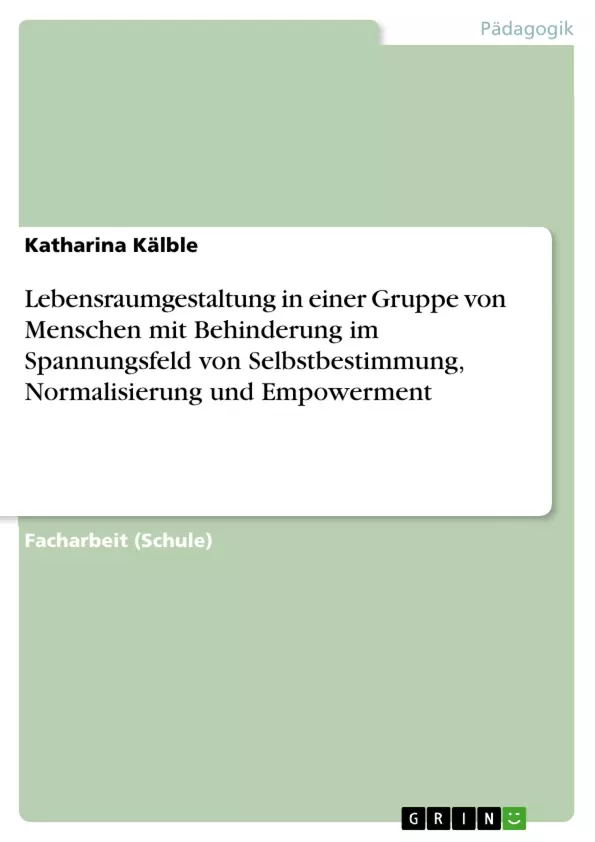Selbstbestimmtes Leben in Wohnheimen für Menschen mit geistiger Behinderung wird leider häufig unterschätzt, bzw. den Menschen mangels Zutrauen nicht zugestanden. Diese Arbeit beschreibt, was man mit ein bißchen Vertrauen erreichen kann und wie die Menschen aufblühen, wenn man ihnen Selbstbestimmung zugesteht. Desweiteren sind Bedeutung und Entstehung der begriffe Empowerment, Normalisierung und Selbstbestimmung ausführlich erklärt.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Definition der geistigen Behinderung
- Fundamentale Prinzipien in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung
- Selbstbestimmung
- Begriffbestimmung
- Umsetzung von selbstbestimmtem Leben in Wohngruppen von geistig behinderten Menschen
- Grenzen von Selbstbestimmung
- Institutionelle Hindernisse
- Gewohnheiten und Einstellungen von Bezugspersonen
- Personalreduzierung
- Die soziale Kategorie von Selbstbestimmung
- Formen der Mitwirkung nach Bliss
- Das Normalisierungsprinzip
- Bereiche
- Praktische Umsetzung des Normalisierungsprinzips
- Empowerment
- Begriffserklärung
- Ebenen
- Selbstbestimmung
- Projekt: Gemeinsame Lebensraumgestaltung
- Teilnehmer
- Vorstellung der Projektidee
- Projektziele
- Auswirkung von Selbstbestimmung auf die Projektziele
- Projektphasen
- Phase 1: Gruppenraum streichen
- Phase 2: Einkauf von Dekorationsartikeln
- Phase 3: Verschiedene Dekorationsarbeiten
- Projektreflexion
- Sozialverhalten
- Kognition
- Motivation / Lern- und Arbeitsverhalten
- Lebensraumgestaltung auf einer Gruppe von Menschen mit geistiger Behinderung im Spannungsfeld von Selbstbestimmung, Normalisierung und Empowerment
- Abgleich von Theorie und Praxis
- Selbstbestimmung
- Überwundene Grenzen
- Umsetzung des Stufenmodells nach Bliss im Projekt
- Normalisierung
- Empowerment
- Selbstbestimmung
- Abgleich von Theorie und Praxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit untersucht die Lebensraumgestaltung in einer Wohngruppe für Menschen mit geistiger Behinderung. Das zentrale Anliegen ist die Analyse des Spannungsfelds zwischen Selbstbestimmung, Normalisierung und Empowerment im Kontext der Gestaltung des gemeinsamen Lebensraums. Die Arbeit basiert auf einem konkreten Projekt, in dem die Autorin gemeinsam mit den Bewohnern deren Wohnraum umgestaltete.
- Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung
- Das Normalisierungsprinzip in der Praxis
- Empowerment als Ansatz zur Stärkung der Bewohner
- Die Umsetzung der Theorie in der Praxis
- Reflexion des Projekts und seiner Auswirkungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einleitung beschreibt ein Projekt zur Umgestaltung eines Gruppenraums in einem Wohnheim für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung. Die Autorin beschreibt ihre anfängliche Beobachtung, dass viele Bewohner die Möglichkeit der Selbstbestimmung nicht kennen und wie sich dies im Laufe des Projekts veränderte. Sie betont die wachsende Bedeutung von Selbstbestimmung in der Behindertenhilfe und die Herausforderungen bei deren Umsetzung.
Definition der geistigen Behinderung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Schwierigkeit, geistige Behinderung eindeutig zu definieren. Es werden verschiedene Definitionen und die Klassifikation nach ICD-10 vorgestellt, die Intelligenzminderung und Einschränkungen in verschiedenen Lebensbereichen (Kommunikation, Selbstversorgung, Wohnen, Sozialverhalten) berücksichtigt. Die Autorin zeigt die Komplexität und die Unmöglichkeit einer einfachen, allgemeingültigen Definition auf.
Fundamentale Prinzipien in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung: Dieses Kapitel analysiert drei fundamentale Prinzipien: Selbstbestimmung, Normalisierung und Empowerment. Es werden die jeweiligen Konzepte erläutert und ihre praktische Umsetzung, insbesondere im Kontext von Wohngruppen für Menschen mit geistiger Behinderung, diskutiert. Die Kapitelteile befassen sich mit den Begriffen, ihren Grenzen (im Falle der Selbstbestimmung etwa institutionelle Hindernisse, Einstellungen von Bezugspersonen oder Personalreduzierung), und verschiedenen Ansätzen zu deren Umsetzung. Die Bedeutung des Normalisierungsprinzips wird im Kontext von praktischem Handeln ebenso thematisiert wie die Ebenen des Empowerment.
Projekt: Gemeinsame Lebensraumgestaltung: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das Projekt der Gruppenraumgestaltung. Es werden die teilnehmenden Personen vorgestellt und die Projektidee, -ziele und -phasen erläutert. Der Fokus liegt auf der konkreten Umsetzung und der Beteiligung der Bewohner an allen Phasen des Projekts, besonders auf die Auswirkung der Selbstbestimmung auf die Projektziele. Eine anschließende Projektreflexion analysiert die Auswirkungen auf das Sozialverhalten, die Kognition und die Motivation der Teilnehmer.
Lebensraumgestaltung auf einer Gruppe von Menschen mit geistiger Behinderung im Spannungsfeld von Selbstbestimmung, Normalisierung und Empowerment: Dieses Kapitel vergleicht die theoretischen Konzepte aus Kapitel 3 mit der praktischen Umsetzung im Projekt. Es analysiert, inwieweit die Selbstbestimmung der Bewohner im Projekt umgesetzt werden konnte, die Grenzen überwunden wurden und wie das Stufenmodell nach Bliss angewendet wurde. Weiterhin wird die Rolle der Normalisierung und des Empowerment im Projekt beleuchtet.
Schlüsselwörter
Geistige Behinderung, Selbstbestimmung, Normalisierung, Empowerment, Lebensraumgestaltung, Inklusion, Partizipation, Wohngruppe, Projekt, Behinderung, ICD-10, Theorie und Praxis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Facharbeit: Lebensraumgestaltung in einer Wohngruppe für Menschen mit geistiger Behinderung
Was ist der Gegenstand dieser Facharbeit?
Die Facharbeit untersucht die Lebensraumgestaltung in einer Wohngruppe für Menschen mit geistiger Behinderung und analysiert das Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung, Normalisierung und Empowerment im Kontext der Gestaltung des gemeinsamen Lebensraums. Die Arbeit basiert auf einem konkreten Projekt, in dem die Autorin gemeinsam mit den Bewohnern deren Wohnraum umgestaltete.
Welche Themen werden in der Facharbeit behandelt?
Die Facharbeit behandelt die Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung, das Normalisierungsprinzip in der Praxis, Empowerment als Ansatz zur Stärkung der Bewohner, die Umsetzung der Theorie in der Praxis und eine Reflexion des Projekts und seiner Auswirkungen. Es werden Definitionen der geistigen Behinderung nach ICD-10 erläutert und die Prinzipien der Selbstbestimmung, Normalisierung und Empowerment detailliert erklärt.
Welche Prinzipien der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf drei fundamentale Prinzipien: Selbstbestimmung, Normalisierung und Empowerment. Für jedes Prinzip wird der Begriff erklärt, die praktische Umsetzung diskutiert und im Fall der Selbstbestimmung auch die Grenzen (institutionelle Hindernisse, Einstellungen von Bezugspersonen, Personalreduzierung etc.) beleuchtet. Das Normalisierungsprinzip wird im Kontext praktischen Handelns erläutert, ebenso die Ebenen des Empowerment.
Wie wird das Thema Selbstbestimmung behandelt?
Die Selbstbestimmung wird als zentrales Thema betrachtet. Die Arbeit analysiert den Begriff, seine Umsetzung in Wohngruppen, die Grenzen der Selbstbestimmung und verschiedene Ansätze zu deren Umsetzung (z.B. das Stufenmodell nach Bliss). Die Auswirkung von Selbstbestimmung auf die Projektziele wird im Projektteil detailliert untersucht.
Wie ist die Facharbeit strukturiert?
Die Facharbeit beinhaltet eine Einführung, ein Kapitel zur Definition geistiger Behinderung, ein Kapitel zu den fundamentalen Prinzipien (Selbstbestimmung, Normalisierung, Empowerment), eine detaillierte Beschreibung des Projekts zur gemeinsamen Lebensraumgestaltung (inkl. Projektphasen und Reflexion) und ein abschließendes Kapitel, das Theorie und Praxis anhand des Projekts vergleicht. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Was ist das Projekt, auf dem die Facharbeit basiert?
Das Projekt besteht in der gemeinsamen Umgestaltung eines Gruppenraums in einem Wohnheim für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung. Die Bewohner waren aktiv an allen Phasen des Projekts beteiligt, von der Planung über den Einkauf bis zur Umsetzung. Der Fokus lag auf der Förderung der Selbstbestimmung der Bewohner.
Welche Ergebnisse liefert die Projektreflexion?
Die Projektreflexion analysiert die Auswirkungen des Projekts auf das Sozialverhalten, die Kognition und die Motivation der Teilnehmer. Es wird untersucht, inwieweit die theoretischen Konzepte (Selbstbestimmung, Normalisierung, Empowerment) in der Praxis umgesetzt werden konnten und welche Grenzen überwunden wurden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Facharbeit?
Schlüsselwörter sind: Geistige Behinderung, Selbstbestimmung, Normalisierung, Empowerment, Lebensraumgestaltung, Inklusion, Partizipation, Wohngruppe, Projekt, Behinderung, ICD-10, Theorie und Praxis.
Welche Definition der geistigen Behinderung wird verwendet?
Die Arbeit diskutiert die Schwierigkeit, geistige Behinderung eindeutig zu definieren und stellt verschiedene Definitionen und die Klassifikation nach ICD-10 vor, die Intelligenzminderung und Einschränkungen in verschiedenen Lebensbereichen berücksichtigt. Die Komplexität und die Unmöglichkeit einer einfachen, allgemeingültigen Definition wird hervorgehoben.
Wie wird das Normalisierungsprinzip in der Facharbeit behandelt?
Das Normalisierungsprinzip wird als ein zentrales Prinzip der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung erläutert und seine praktische Umsetzung, insbesondere im Kontext von Wohngruppen, diskutiert. Die Arbeit zeigt Bereiche auf, in denen das Prinzip angewendet werden kann und wie es im Projekt umgesetzt wurde.
- Quote paper
- Katharina Kälble (Author), 2008, Lebensraumgestaltung in einer Gruppe von Menschen mit Behinderung im Spannungsfeld von Selbstbestimmung, Normalisierung und Empowerment, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138365