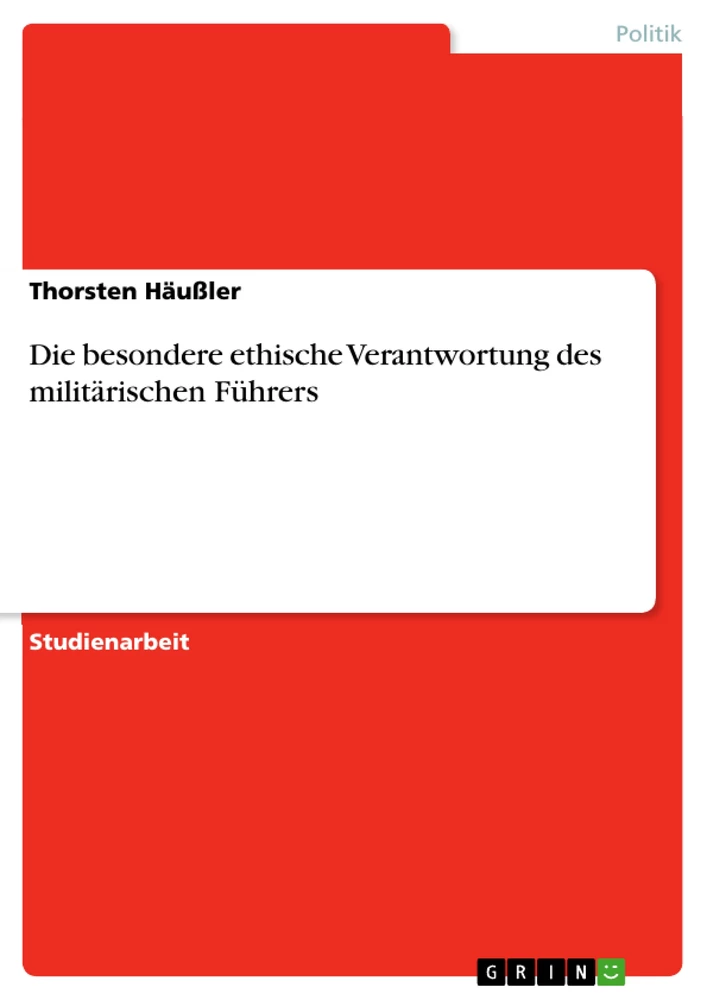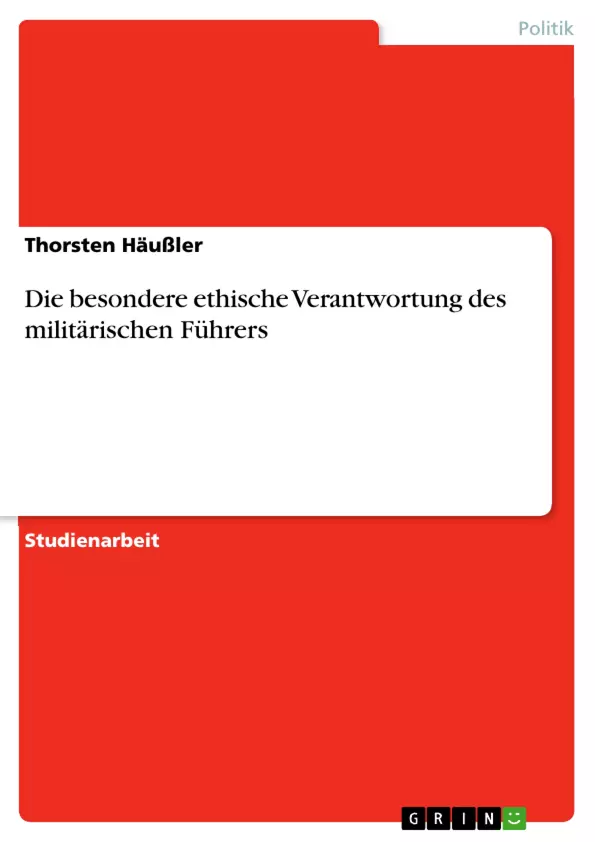Einen ethikfreien Raum gibt es nicht. Wo immer Menschen aufeinander treffen und in Interaktion treten, werden auch die unterschiedlichen Einstellungen und Wertvorstellungen der Menschen zu Tage und in Diskurs treten. So entwickelt jede Gruppe von Menschen einen für sie als verbindlich geltenden Normen- und Wertekanon. So wundert es nicht, dass auch Armeen ihre eigenen Normen entwickelt haben, was denn für den Soldaten als moralisch richtig, als tugendhaft und erstrebenswert, als Richtschnur für sein Handeln gilt. Angesichts der Tatsache, dass Streitkräfte das größte Gewaltpotential innerhalb einer Gesellschaft darstellen und im Atomzeitalter eine Zerstörungskraft entfalten können, die ganze Landstriche nachhaltig vernichten und unbewohnbar machen können, ist eine verantwortungsvolle militärische Berufsethik für die Armee, aber auch für jeden einzelnen Soldaten unabdingbar. Diese ethischen Forderungen und Herausforderungen treffen jeden Soldaten gleichermaßen, doch besonders für die militärischen Vorgesetzten ist ein entwickeltes Ethos und moralische Gefestigtheit und Reflektiertheit von unbedingter Notwendigkeit. Denn immerhin sind sie die Verantwortungsträger in allen militärischen Ebenen, sie befehlen, wer, wann, wo und wie bekämpft werden soll und entscheiden so direkt über den Einsatz verheerender Waffen und Kampfmittel, über Leben und Tod. Gerade wegen dieser Entscheidungsbefugnis über gewaltige Ressourcen, und Menschenleben und die potentiell katastrophalen Folgen seiner Entscheidungen, Taten aber auch seiner Untätigkeit, trägt ein jeder militärische Vorgesetzte eine besondere ethische Verantwortung gegenüber seinen Kameraden, dem Staat und Gesellschaft, der natürlichen Umwelt, seinen Mitmenschen und künftigen Generationen.
Inhalt
1 Einleitung
2 Verantwortung
2.1 Übergeordnete Führung/ Pflicht
2.2 Unterstellter Bereich/ Kameradschaft
2.3 Kriegsvölkerrecht als Kondensat gesellschaftlicher Wertvorstellungen
2.4 Gewissen/ Persönlichkeit
3 Besondere Auflagen in der Bundeswehr: Die Innere Führung
3.1 Grundsätze
3.2 Staatsbürger in Uniform
4 Fazit
5 Literatur:
1 Einleitung
Einen ethikfreien Raum gibt es nicht. Wo immer Menschen aufeinander treffen und in Interaktion treten, werden auch die unterschiedlichen Einstellungen und Wertvorstellungen der Menschen zu Tage und in Diskurs treten. So entwickelt jede Gruppe von Menschen einen für sie als verbindlich geltenden Normen- und Wertekanon. So wundert es nicht, dass auch Armeen ihre eigenen Normen entwickelt haben, was denn für den Soldaten als moralisch richtig, als tugendhaft und erstrebenswert, als Richtschnur für sein Handeln gilt. Angesichts der Tatsache, dass Streitkräfte das größte Gewaltpotential innerhalb einer Gesellschaft darstellen und im Atomzeitalter eine Zerstörungskraft entfalten können, die ganze Landstriche nachhaltig vernichten und unbewohnbar machen können, ist eine verantwortungsvolle militärische Berufsethik für die Armee, aber auch für jeden einzelnen Soldaten unabdingbar. Diese ethischen Forderungen und Herausforderungen treffen jeden Soldaten gleichermaßen, doch besonders für die militärischen Vorgesetzten ist ein entwickeltes Ethos und moralische Gefestigtheit und Reflektiertheit von unbedingter Notwendigkeit. Denn immerhin sind sie die Verantwortungsträger in allen militärischen Ebenen, sie befehlen, wer, wann, wo und wie bekämpft werden soll und entscheiden so direkt über den Einsatz verheerender Waffen und Kampfmittel, über Leben und Tod. Gerade wegen dieser Entscheidungsbefugnis über gewaltige Ressourcen, und Menschenleben und die potentiell katastrophalen Folgen seiner Entscheidungen, Taten aber auch seiner Untätigkeit, trägt ein jeder militärische Vorgesetzte eine besondere ethische Verantwortung gegenüber seinen Kameraden, dem Staat und Gesellschaft, der natürlichen Umwelt, seinen Mitmenschen und künftigen Generationen.
2 Verantwortung
Der militärische Führer ist in jeder seiner Handlungen stets einer Reihe von Instanzen Verantwortung schuldig. Gegenüber dem Auftrag der übergeordneten Führung, gegenüber seinen Untergebenen, gegenüber den Werten und Rechtsnormen der Gesellschaft und zuletzt seinem eigenen Gewissen. Doch da sich bei der Entscheidungsfindung Gegensätze und Konflikte zwischen den Interessen dieser Instanzen ergeben können, ist es nötig, diese in eine Rangordnung zu bringen. In einem Modell für Menschenführung der US-amerikanischen Marine ist diese Rangordnung der Loyalitäten klar festgelegt und wird so den Soldaten als verbindliche Vorgabe gelehrt: „ to the supreme law of the land as defined in the Constitution, then to mission, then to service, then to ship, then to shipmate, then to self.“[1] In anderen Streitkräften herrscht keine so klar definierte Lehrmeinung. In der Bundeswehr beispielsweise gelten zwar ebenfalls die Prinzipien des Grundgesetztes als höchste verbindliche Instanz, jedoch wird sonst keine Rangfolge gebildet. In der Praxis ist eine Lehrmeinung in Fragen moralischer Instanzen ohnehin hinfällig, da das einzelne Individuum für sich selbst eine eigene Schwerpunktbildung vornimmt.
Ich möchte im Folgenden auf die moralischen Verpflichtungen des Vorgesetzten eingehen, die sich aus seiner Verantwortung gegenüber den oben genannten Instanzen ergeben.
2.1 Übergeordnete Führung/ Pflicht
Der wichtigste Anspruch der Übergeordneten Führung an den militärischen Führer, wie an jeden Soldaten, ist die Pflichterfüllung. Doch was bedeutet diese Pflicht? Im klassischen Verständnis griechischer Denker wie beispielsweise Aristoteles bedeutet Pflicht schlicht das, was von einem erwartet wird.[2] Doch ist damit nicht etwa viehischer Gehorsam gegenüber jedwedem Befehl gemeint, sondern vielmehr, den Anforderungen der Stellung, welche man in der Welt inne hat, zu genügen. In der Lehre der Stoa wird dies mit einer Metapher vom Theater beschrieben: Jeder Mensch spielt auf der Bühne des Lebens eine Rolle. Dies mag eine kleine oder eine große Rolle sein, jedoch wird von jedem erwartet, diese Rolle gut zu spielen.[3] Folgt man Aristoteles, so verlangt nun die Pflicht von einem guten Soldaten, bestimmte Charaktermerkmale inne zu haben und auf dem Schlachtfeld zu zeigen: Tapferkeit, Gehorsam, Loyalität, Standhaftigkeit und Einfallsreichtum.[4] Alle diese Eigenschaften werden auch heute, nach mehr als zwei Jahrtausenden, immer noch von Soldaten erwartet. Tapferkeit ist für jeden Soldaten unbedingt nötig, um den militärischen Auftrag erfüllen zu können. Sie bedeutet nicht, ohne Furcht sich leichtfertig und tollkühn jeder Gefahr auszusetzen, sondern vielmehr, trotz der möglichen Gefahr für Bequemlichkeit, Beliebtheit, Laufbahn, Gesundheit oder Leben seine Pflicht zu erfüllen.[5] In Deutschland ist die Pflicht zur Tapferkeit Teil der Grundpflicht eines jeden Soldaten, die zu erfüllen er im Diensteid feierlich schwört. Das Prinzip von Befehl und Gehorsam ist der Grundpfeiler der Ordnung aller Streitkräfte, denn schließlich geht es in deren Auswirkungen in letzter Konsequenz um Leben und Tod. Der Gehorsam ist aber nicht nur Garant der Funktionalität der Armee, er schützt auch den einzelnen in Extremsituationen, denn er garantiert, dass alle an einem Strang ziehen und man sich gegenseitig aufeinander verlassen kann. So hat auch der einzelne Soldat die besten Chancen zu überleben.[6] Gerade auch für Führer ist Gehorsam gegenüber seinen Vorgesetzten unabdingbar. Nur wer gelernt hat zu gehorchen kann auch Befehle erteilen. Gehorsam steht im engen Zusammenhang mit Loyalität und Treue zum Staat, zu Vorgesetzten und Kameraden. Loyal und treu zu sein bedeutet für den Soldaten, zuverlässig auch bis in die Kleinigkeiten zu sein, verlässlich zu sein, auch wenn niemand Aufsicht führt und schließlich gehorsam zu sein, wo Ungehorsam scheinbar keine direkte Gefahr darstellt.[7] Loyalität geht also über den bloßen Gehorsam hinaus. Mehr noch als der Gehorsam beruht Loyalität auf Überzeugung, auf der Gewissheit Teil einer sinnvollen Sache zu sein. Loyalität fußt auf Identität. Weil man sich mit den Streitkräften, mit den Vorgesetzten und Kameraden identifiziert, hält man diesen die Treue.
Standhaftigkeit und Einfallsreichtum sind im besonderen Maße wichtig für den militärischen Vorgesetzten. Einfallsreichtum oder auch Initiative ist die Voraussetzung für jeden militärischen Erfolg. Ferner vermag nur der standhafte Führer körperliche und psychische Belastungen zu ertragen um trotz Härten und Hindernissen auf der Erfüllung seiner Aufträge zu beharren. Schon zu Zeiten von Plato sah man diese Standhaftigkeit als höchste Form der Tapferkeit, wenn man sich im Angesicht der Niederlage gegen alle Widernisse durchzusetzen vermochte.[8] Selbstverständlich gelten diese Aspekte von Pflicht für alle Soldaten, doch besonders die militärischen Führer müssen zur Pflichterfüllung oben genannte Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen an den Tag legen, sind sie es doch, die durch ihr Vorbild und ihre Führung ihre unterstellten Soldaten zu selbigem Verhalten anleiten sollen.
[...]
[1] Vgl. Roush, Paul E.: Admiral James B. Stockdale´s Leadership Model, in: Donovan, Aine u.a. (Hrsg.): Ethics for Military Leaders, Needham Heights, 1998, S.596.
[2] Vgl. Stockdale, James B.: A Vietnam Experience, Duty, in: Donovan, Aine u.a. (Hrsg.): Ethics for Military Leaders, Needham Heights, 1998, S.589.
[3] Vgl. ebd., S.590.
[4] Vgl. ebd., S.589.
[5] Vgl. Schnell, Karl Helmut u.a.(Hrsg.): Deutscher Bundeswehr-Kalender, Regensburg 1999, Abschnitt C01a, S.11.
[6] Vgl. ebd., S.13.
[7] Vgl. ebd., S.11.
[8] Vgl. Stockdale: Duty, S.589.
Häufig gestellte Fragen
Welche besondere Verantwortung trägt ein militärischer Führer?
Er trägt Verantwortung für das Leben seiner Untergebenen, die Erfüllung des Auftrags, die Einhaltung des Völkerrechts und gegenüber seinem eigenen Gewissen.
Was bedeutet "Innere Führung" in der Bundeswehr?
Die Innere Führung ist das Leitbild der Bundeswehr, das den Soldaten als "Staatsbürger in Uniform" definiert und ethische Grundsätze für den Dienst festlegt.
Wie sieht die Rangordnung der Loyalitäten im US-Marine-Modell aus?
Die Loyalität gilt zuerst der Verfassung, dann dem Auftrag, dem Dienst, dem Schiff, den Kameraden und zuletzt sich selbst.
Was versteht man unter der "Pflicht zur Tapferkeit"?
Tapferkeit bedeutet, trotz Gefahr für Gesundheit oder Leben seine Pflicht zu erfüllen, ohne dabei leichtfertig oder tollkühn zu handeln.
Warum ist Gehorsam im Militär ethisch relevant?
Gehorsam garantiert die Funktionalität der Armee und schützt den Einzelnen in Extremsituationen, darf aber nicht in "viehischen Gehorsam" gegenüber verbrecherischen Befehlen ausarten.
- Citar trabajo
- Thorsten Häußler (Autor), 2009, Die besondere ethische Verantwortung des militärischen Führers, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138380