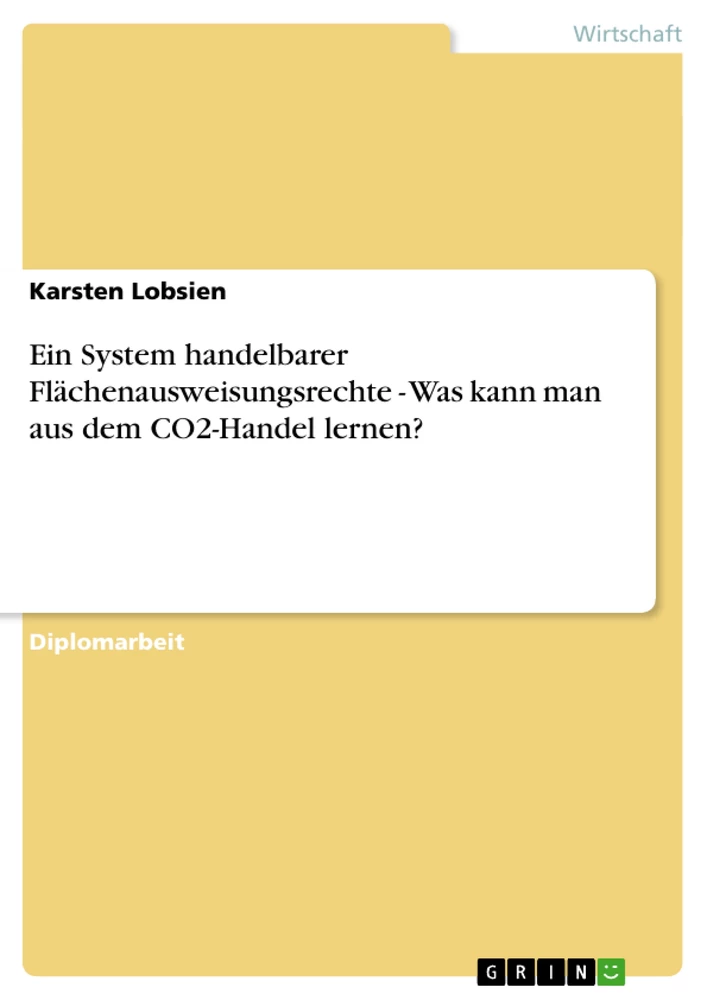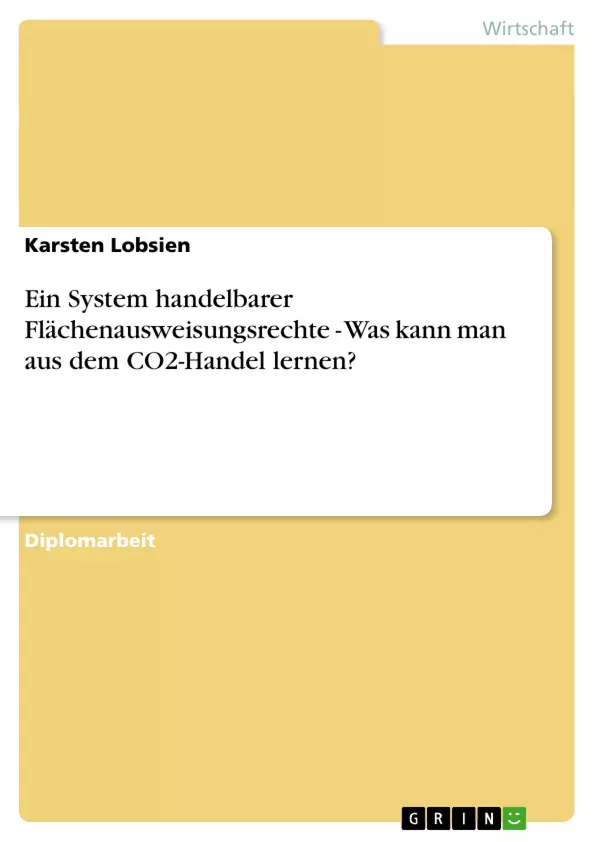Unter Flächenverbrauch versteht man die Umwandlung von bisher landwirtschaftlich genutzter oder als natürlichem Lebensraum dienender Fläche in Siedlungs- und Verkehrsfläche (SuV). Diese Fläche steht von dem Zeitpunkt, ab dem sie für Siedlung und Infrastruktur genutzt wird, nicht mehr als Fläche und damit Lebensraum für Ökosysteme zur Verfügung. Der Vorgang, der zu dieser Umwandlung führt, wird als Flächenausweisung bezeichnet und findet auf kommunaler Ebene statt.
Zertifikate als umweltökonomisches Instrumentarium zur effizienten Minderung der Umweltverschmutzung wurden bereits seit einigen Jahren im Bereich der Schadstoffemissionen, insbesondere in den USA, eingesetzt (Bader 2000, 56 ff.). Als Meilenstein gilt jedoch das Kyoto-Protokoll von 1997 und daraus folgend der EU-Emissionshandel. Ersteres sieht die Einführung eines weltweiten Emissionshandels zwischen Industriestaaten ab 2008 vor, letzteres wurde 2005 auf europäischer Ebene zur Unterstützung der Kyoto-Ziele eingeführt. Somit findet bereits seit zwei Jahren der Emissionshandel zwischen den Treibhausgas emittierenden Unternehmen Europas statt. Beide Systeme sollen ihren Beitrag zur Verminderung des anthropogenen Treibhauseffekts leisten, der durch die Emission verschiedener Treibhausgase – insbesondere CO2 –, die bei der Verbrennung fossiler Energieträger entstehen, zur Erderwärmung und damit zum Klimawandel führt.
Der EU-Emissionshandel gilt als erste große Bewährungsprobe für das System des Zertifikatehandels, weil er erstmals grenzüberschreitend und mit einer derart großen Anzahl von Teilnehmern stattfindet. In der Diskussion um die Einführung des Zertifikatehandels in der Flächenhaushaltspolitik wird zudem gern und oft auf den EU-Emissionshandel zurückgegriffen. Immer wieder liest man von der „Übertragung der Idee des EU-Emissionshandels“ oder der „Tradition des europäischen Emissionshandels“, wenn von einem System handelbarer Flächenausweisungsrechte die Rede ist. Diesen oft angestellten Vergleich nimmt sich der Verfasser dieser Arbeit zum Anlass, die Übertragbarkeit der Erfahrungen aus dem Emissionshandel auf das neue System zu überprüfen. Im Folgenden soll also die Frage beantwortet werden, welche Lehren aus dem EU-Emissionshandel für die Wirksamkeit und Ausgestaltung des Zertifikatesystems zur Minderung des Flächenverbrauchs zu ziehen sind. Diese Betrachtung soll aus institutionenökonomischer, weniger aus juristischer oder politischer Sicht erfolgen.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Problemstellung
1.2. Ziel der Arbeit und Gang der Untersuchung
2. Die Umwelt als politisches Handlungsfeld
2.1. Umweltschäden als externe Effekte
2.1.1. Der Begriff des externen Effektes
2.1.2. Externe Effekte durch CO2- Emissionen und Flächenausweisung
2.1.3. Internalisierung externer Effekte durch staatlichen Eingriff
2.2. Bestehende Instrumente in der Flächen- und Klimapolitik
2.2.1. Umwelt- und Planungsrecht
2.2.2. Auflagen in der Ordnungspolitik
3. Zertifikate als effizientes ökonomisches Mittel
3.1. Wirkungsweise von Zertifikaten
3.1.1. Ökologische Treffsicherheit
3.1.2. Ökonomische Effizienz
3.1.2.1. Kosteneffizienz
3.1.2.2. Innovationseffizienz
3.2. Die Rolle der Marktvollkommenheit
3.3. Die Primärallokation
3.3.1. Auktionierung
3.3.2. Kostenlose Zuteilung
3.4. Die räumliche Dimension
3.4.1. Die „Hot-Spot“- Problematik
3.4.2. Möglichkeiten der räumlichen Differenzierung
3.5. Die zeitliche Dimension
4. Der Emissionshandel auf europäischer Ebene
4.1. Das Kyoto-Protokoll als Meilenstein für den Klimaschutz
4.2. Der EU- Emissionshandel
4.2.1. Hintergrund
4.2.2. Ausgestaltung
4.2.3.Die Umsetzung der EU-Richtlinie in Deutschland
4.3. Kritik an der Ausgestaltung des europäischen Emissionshandels
4.4. Erste Erfahrungen mit dem neuen Instrument
4.5. Fazit und Ausblick
5. Handelbare Flächenausweisungsrechte
5.1. Umweltziele im Bereich des Flächenverbrauchs
5.2. Übertragung der Theorie
5.3. Räumliche und sachliche Differenzierung
5.4. Flächenausweisungsrechte mit oder statt Umwelt- und Planungsrecht?
5.5. Mögliche Ausgestaltung
5.5.1. Gegenstand der Kontingentierung
5.5.2. Marktabgrenzung
5.5.3. Allokation der Kontingente
5.5.4. Handelsregime
5.6. Abgrenzung zu den bisherigen Steuerungsmechanismen
6. CO2 -Handel als Vorbild für die Minderung des Flächenverbrauchs
6.1. Systemimmanente Unterschiede
6.1.1. Akteure und ihre Interessen
6.1.2. Handelsteilnehmer
6.1.3. Die „Hot-Spot“-Problematik
6.1.4. Stellenwert der Mengensteuerung
6.1.5. Das Flächenausweisungsrecht als „Gutschein“
6.2. Lektionen aus den Erfahrungen mit dem Emissionshandel
6.2.1. Die Primärallokation
6.2.1.1. Kostenlose und ungleiche Verteilung
6.2.1.2. Großzügige Verteilung
6.2.2. Lobbyismus
7. Schlussbetrachtung
Anhang
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Optimale Externalität
Abbildung 2: Die Funktionsweise von Emissionszertifikaten
Abbildung 3: Kriterien für nationale Zuteilungspläne
Abbildung 4: Preisentwicklung der CO2-Zertifikate am EEX-Spotmarkt
Abbildung 5: Allokationsergebnisse für das Handelsjahr 2005. Prozentuale Über- bzw. Unterallokation
Abbildung 6: Abweichung von den Kyoto-Zielen 2005
Abbildung 7: Unterschiedliche Grenzvermeidungskosten für verschiedene Nutzungsarten
Abbildung 8: Verhältnis zwischen räumlicher Planung und handelbaren Festsetzungskontingenten
Abbildung 9: Beurteilung unterschiedlicher räumlicher Marktabgrenzungen
Abbildung 10: Möglichkeiten zur Zielaufteilung auf die Länder
Abbildung 11: Ergebnisse der Modellrechnungen zur Zielaufteilung für den NVK
Abbildung 12: Anteile an den in der Primärzuteilung ausgegebenen Flächenkon-tingenten für einzelne Gemeinden des NVK für unterschiedliche Zuteilungsalternativen
Abbildung 13: Handlungsdruck für ausgewählte Gemeinden im NVK, gemessen an der Differenz zwischen Referenzentwicklung und zugeteilten Kontingenten
Abbildung 14: Der Nationale Allokationsplan für Deutschland 2005-2007. V
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
1.1. Problemstellung
Unter Flächenverbrauch versteht man die Umwandlung von bisher landwirtschaftlich genutzter oder als natürlichem Lebensraum dienender Fläche in Siedlungs- und Verkehrsfläche (SuV). Diese Fläche steht von dem Zeitpunkt, ab dem sie für Siedlung und Infrastruktur genutzt wird, nicht mehr als Fläche und damit Lebensraum für Ökosysteme zur Verfügung. Der Vorgang, der zu dieser Umwandlung führt, wird als Flächenausweisung bezeichnet und findet auf kommunaler Ebene statt.
Der Boden ist eine endliche, nicht vermehrbare Ressource, die durch die menschliche Nutzung gefährdet ist (Schmalholz 2006, 6 f., 36), weil seine natürlichen Funktionen eingeschränkt werden. Die gravierendsten ökologischen Folgen sind: Bodenversiegelungen1 mit Auswirkungen auf Flora, Fauna und Wasserhaushalt, Zersiedelung2 und daher höheres Verkehrsaufkommen mit erhöhten Schadstoffemissionen sowie die Zerschneidung und Verinselung von Landschaftsräumen und damit einhergehend der Verlust von Frei- und Lebensräumen, der Artenrückgang sowie die Minderung der Biodiversität (Löhr 2005, 266 f.; Jörissen, Coenen 2004, 11; Schmalholz 2006, 36 ff.).
In Deutschland erlangte dieses umweltpolitische Problemfeld in den letzten Jahren besondere Bedeutung, denn hier erfolgt der Flächenverbrauch seit Jahren auf hohem Niveau. In den Jahren 2003-2005 wurden in Deutschland im Schnitt 114 ha/Tag SuV neu ausgewiesen (Statistisches Bundesamt 2007). Das entspricht einer Fläche, die mehr als 1.000 freistehenden Einfamilienhäusern mit konventionellem Garten Platz bietet (Schröter 2005). Im Vergleich kommt beispielsweise England mit einer Flächeninanspruchnahme aus, die nur ein Drittel der deutschen beträgt. Der hohe Flächenverbrauch der Vergangenheit führt dazu, dass mit etwa 46.000 km2 (Stand: Ende 2004) bereits 12,8% der Gesamtfläche Deutschlands als SuV ausgewiesen sind (Statistisches Bundesamt 2007). Damit gehört die Bundesrepublik weltweit zu den am dichtesten besiedelten Staaten (Schmalholz 2005, 13).
Die Minderung der Flächeninanspruchnahme rückt somit mehr und mehr in den Fokus der Umweltpolitik. Im Jahr 2002 wurde sie als eines der prioritären Handlungsziele in die Nachhaltigkeitsstrategie der rot-grünen Bundesregierung aufgenommen. Hiernach soll das Wachstum der SuV bis zum Jahr 2020 auf 30 ha/Tag zurückgeführt werden. Schon einige Jahre davor begann die Diskussion um effiziente Instrumente, die zu einer nachhaltigen Entwicklung des Flächenverbrauchs führen sollten. Das bestehende Umwelt- und Planungsrecht stellte sich als unfähig heraus, quantitative Ziele erreichbar zu machen. Somit wurde bereits 1996 von Bizer ein „System handelbarer Flächenausweisungsrechte“ vorgeschlagen, das nach Vorbild des Emissionshandels eine Zertifikatelösung darstellen sollte. Diesem ersten Vorstoß in diese Richtung folgte in den darauffolgenden Jahren eine rege Diskussion verschiedener Ökonomen, Politiker und Juristen um die Einführung dieses Instruments, die im allgemeinen das Für und Wider des Systems sowie im speziellen die Ausgestaltungsdetails zum Inhalt hatte.
1.2. Ziel der Arbeit und Gang der Untersuchung
Zertifikate als umweltökonomisches Instrumentarium zur effizienten Minderung der Umweltverschmutzung wurden bereits seit einigen Jahren im Bereich der Schadstoffemissionen, insbesondere in den USA, eingesetzt (Bader 2000, 56 ff.). Als Meilenstein gilt jedoch das Kyoto-Protokoll von 1997 und daraus folgend der EU-Emissionshandel. Ersteres sieht die Einführung eines weltweiten Emissionshandels zwischen Industriestaaten ab 2008 vor, letzteres wurde 2005 auf europäischer Ebene zur Unterstützung der Kyoto-Ziele eingeführt. Somit findet bereits seit zwei Jahren der Emissionshandel zwischen den Treibhausgas emittierenden Unternehmen Europas statt. Beide Systeme sollen ihren Beitrag zur Verminderung des anthropogenen Treibhauseffekts leisten, der durch die Emission verschiedener Treibhausgase – insbesondere CO2 –, die bei der Verbrennung fossiler Energieträger entstehen, zur Erderwärmung und damit zum Klimawandel führt.
Der EU-Emissionshandel gilt als erste große Bewährungsprobe für das System des Zertifikatehandels, weil er erstmals grenzüberschreitend und mit einer derart großen Anzahl von Teilnehmern stattfindet. In der Diskussion um die Einführung des Zertifikatehandels in der Flächenhaushaltspolitik wird zudem gern und oft auf den EU-Emissionshandel zurückgegriffen. Immer wieder liest man von der „Übertragung der Idee des EU-Emissionshandels“ oder der „Tradition des europäischen Emissionshandels“, wenn von einem System handelbarer Flächenausweisungsrechte die Rede ist. Diesen oft angestellten Vergleich nimmt sich der Verfasser dieser Arbeit zum Anlass, die Übertragbarkeit der Erfahrungen aus dem Emissionshandel auf das neue System zu überprüfen. Im Folgenden soll also die Frage beantwortet werden, welche Lehren aus dem EU-Emissionshandel für die Wirksamkeit und Ausgestaltung des Zertifikatesystems zur Minderung des Flächenverbrauchs zu ziehen sind. Diese Betrachtung soll aus institutionenökonomischer, weniger aus juristischer oder politischer Sicht erfolgen.
Zu diesem Zweck werden in Kapitel 2 zunächst die grundlegenden ökonomischen Probleme, die die Umweltpolitik mit sich bringt, dargestellt. Dazu werden ebenso die Schwächen der bisher im Bereich des Flächenhaushalts und der Schadstoffemissionen eingesetzten Instrumente erläutert.
Kapitel 3 widmet sich dem theoretischen Hintergrund von Zertifikaten in Abgrenzung zu den bisherigen Regulierungsmechanismen und stellt ihre Voraussetzungen, Wirkungsweise und Besonderheiten dar.
Der EU-Emissionshandel wird in Kapitel 4 näher betrachtet. Ausgehend vom Kyoto-Protokoll wird zunächst die Ausgestaltung des Handelssystems erläutert, bevor seine Defizite diskutiert und die ersten Erfahrungen mit diesem Instrument betrachtet werden.
In Kapitel 5 werden die theoretischen Erkenntnisse aus Kapitel 3 auf das Problemfeld des Flächenverbrauchs übertragen. Daraufhin wird die mögliche Ausgestaltung eines Zertifikatesystems in diesem Bereich nach dem derzeitigen Stand der Diskussion vorgestellt.
Den Kern der Arbeit stellt Kapitel 6 dar. Hier werden die Erkenntnisse der vorhergehenden zwei Kapitel unter Berücksichtigung der Theorie zusammengebracht, um zu einer Beantwortung der Ausgangsfrage zu gelangen. Die Antwort soll dabei auf zwei Aspekte aufgeteilt werden. In einem ersten Schritt werden die Unterschiede zwischen den beiden Systemen vorgestellt, die den Vergleich schwierig machen. Im zweiten Schritt werden dann die Erfahrungen aus dem EU-Emissionshandel auf das System handelbarer Flächenausweisungsrechte übertragen.
2. Die Umwelt als politisches Handlungsfeld
Diese Arbeit beschäftigt sich mit zwei Problemfeldern der Umweltpolitik: Einerseits dem anthropogenen Treibhauseffekt, andererseits dem Flächenverbrauch, der ebenfalls weitreichende ökologische Folgen hat. Im Folgenden soll zunächst erläutert werden, welche Besonderheiten das Politikfeld „Umweltschutz“ mit sich bringt. Dazu soll zunächst das Phänomen der externen Effekte und die Notwendigkeit des staatlichen Eingriffs erläutert werden. Im Anschluss werden die bisher verwendeten Instrumente des Umweltschutzes kurz dargestellt und ihre Schwächen erläutert.
2.1. Umweltschäden als externe Effekte
2.1.1. Der Begriff des externen Effektes
Aus ökonomischer Sicht spricht man von Umweltverschmutzung, wenn aus einem physikalischen Effekt auf die Umwelt, z.B. Krankheiten oder Lärm, auch eine negative menschliche Reaktion resultiert. Eine solche Reaktion kann sich in Unbehagen, Sorge, Leid o.ä. ausdrücken, also allen menschlichen Reaktionen, die die Lebensqualität beeinträchtigen und zu einem Wohlfahrtsverlust führen (Pearce, Turner 1990, 61).
Somit kann man Umweltverschmutzung als negativen externen Effekt3 ausmachen. Ein negativer externer Effekt kommt immer dann zustande, wenn ein Dritter durch Aktivitäten eines Individuums Schaden nimmt, ohne Einfluss auf seinen Nutzenverlust nehmen zu können und ohne für seinen Schaden entschädigt zu werden (Pearce, Turner 1990, 61; Endres 2000, 15). Man betrachte das Beispiel eines Fischereibetriebs, dessen Nutzen aus der Fischereiaktivität erheblich dadurch beeinträchtigt wird, dass ein Industrieunternehmen flussaufwärts Schadstoffe in den Fluss leitet, die die Wasserqualität und damit die Fischpopulation belasten, ohne entsprechend entschädigt zu werden.
Der ideale Markt ist dadurch gekennzeichnet, dass alle Kosten dem Verursacher angelastet werden (Verursacherprinzip) (Fritsch, Wein, Evers 2003, 90). Somit führt ein negativer externer Effekt zu Marktversagen, denn der Verursacher eines externen Effektes berücksichtigt bei seiner Allokationsentscheidung4 nur seine privaten, nicht die sozialen Kosten. Unter sozialen Kosten versteht man hierbei die Summe aus privaten und externen Kosten. Dadurch kommt es am Markt zu einer Preisbildung, bei der die Gleichgewichtsbedingung für ein nach Gewinnmaximierung strebendes Unternehmen „Preis = Grenzkosten“ nicht mehr erfüllt ist und es infolgedessen zu Fehlallokationen kommt (Endres 2000, 6 ff.).
So schädlich externe Effekte für das Marktgleichgewicht auch sind, sie müssen nicht zwingend beseitigt werden. Vielmehr gibt es für den Verursacher eines negativen externen Effekts den Optimallevel der Externalität, in dem er die Differenz aus Nutzen und Kosten maximiert (Pearce, Turner 1990, 62). In diesem Punkt entsprechen seine (Grenz-)Vermeidungskosten genau dem (Grenz)- Schaden des Geschädigten.5 Abbildung 1 verdeutlicht diesen Zusammenhang. Ausgehend vom ursprünglichen Umweltverschmutzungslevel X* ist der Schaden aus einer Einheit solange größer als der Nutzen (ausgedrückt in Grenzvermeidungskosten), bis der Verschmutzungslevel X** erreicht ist. In diesem Punkt ist also die größtmögliche positive Differenz aus Nutzen und Kosten (grün schraffierter Bereich) erreicht. Somit ist die erreichte Allokation auch gesamtgesellschaftlich optimal (Pareto-Optimalität6).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Optimale Externalität
Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Endres (2000), S.17.
Im Fall der Umweltverschmutzung spielt des Weiteren die assimilierende Kapazität der Umwelt eine Rolle, die bis zu einem bestimmten Grad verschmutzt werden kann, ohne Schaden zu nehmen (Pearce, Turner 1990, 62).
Der Optimallevel des externen Effekts, im Rahmen dieser Ausarbeitung der Umwelt-verschmutzung, unterscheidet sich von dem Grad der Umweltverschmutzung, wie sie sich im Marktgleichgewicht einstellt. Sie liegt darunter, weil der Verursacher in seiner Kosten-Nutzen-Rechnung die externen Kosten, die mit fortschreitender Umweltverschmutzung steigen, mit berücksichtigen muss. Der Begriff der „Internalisierung“ externer Effekte beschreibt genau diesen Vorgang, nämlich das Anlasten der externen Kosten beim Verursacher, um den Optimallevel der Externalität zu erreichen (Endres 2000, 17 f.; Pearce, Turner 1990, 62 ff.).
Nun stellt sich also die Frage, inwieweit diese „Optimal-Umweltverschmutzung“ erreicht werden kann, wenn die Marktmechanismen dazu nicht geeignet sind. Wie kann der Staat eingreifen, um die Internalisierung der Externalität herbeizuführen? Zunächst soll aber geklärt werden, in welcher Form externe Effekte in den für diese Arbeit relevanten Feldern „CO2-Emissionen“ und „Flächenverbrauch“ vorliegen.
2.1.2. Externe Effekte durch CO 2 - Emissionen und Flächenausweisung
Die Umweltbelastungen, die mit den in dieser Arbeit behandelten Problemfeldern einhergehen, wurden in der Einleitung bereits in aller Knappheit erläutert (vgl. Kap. 1.). Der Klimawandel hat negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, die Artenvielfalt in der Tierwelt sowie auch auf den Bestand von Ökosystemen. Daneben wirkt er in Form sog. „market impacts“ negativ auf wirtschaftliche Aktivitäten in Land-und Forstwirtschaft (Bader 2000, 28). Ebenso kommt es im Bereich der Flächenausweisung zu Beeinträchtigungen in der Lebensqualität durch Bodenversiegelung und Landschaftszerschneidung. Somit ergeben sich in beiden Fällen soziale Kosten, die nicht über den Markt abgerechnet werden. Die Verursacher der Umweltverschmutzung ziehen externe Kosten, also Kosten, die durch ihr Tun bei Dritten anfallen, für ihre Allokationsentscheidung nicht mit ins Kalkül. Damit ist das Verursacherprinzip im Umweltschutz verletzt.
Möglich werden die externen Effekte dadurch, dass an öffentlichen Güter keine sog. „Property Rights“ (Verfügungsrechte) zugeteilt sind und somit keine Rechte zur Abwehr von negativen Effekten bestehen (Fritsch et al. 2000, 101). Als öffentliche Güter sind in unserem Fall einerseits die Atmosphäre, die durch den CO2-Ausstoß
Schaden nimmt und andererseits die wohlbehaltene Landschaft zu verstehen.7 Die Verursacher der externen Kosten sind die Nutzer der jeweiligen Umweltressource. Im Falle der Klimapolitik sind das unmittelbar alle Akteure, die die Verbrennung fossiler Energieträger betreiben. Hier seien beispielhaft Industriebetriebe, private Haushalte und Verkehrsteilnehmer genannt. Mittelbar sind auch die Kunden der Energiekonzerne Verursacher, die Strom kaufen, der auf einem umweltbelastenden Weg erzeugt wurde. Im Fall der Flächenausweisung sind unmittelbare Verursacher die Kommunen, die für die Ausweisung und Versiegelung zuständig sind; mittelbar sind Bauträger jeglicher Art, Gewerbebetriebe und Privatpersonen sowie auch Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Fläche verantwortlich. Nutzer können auch die Kommunen selbst sein, wenn es um Flächenverbrauch für öffentliche Einrichtungen geht.
2.1.3. Internalisierung externer Effekte durch staatlichen Eingriff
Unter der Internalisierung externer Effekte versteht man wie bereits erwähnt die Anlastung der externen Kosten beim Verursacher, um die ökonomisch optimale Ressourcenallokation und Externalität zu erreichen. Der Verursacher der Umweltverschmutzung wird dadurch gezwungen, die sozialen Kosten in seine Allokationsentscheidung einzubeziehen (Pearce, Turner 1990, 62).
Zur Internalisierung externer Effekte gibt es verschiedene „first-best“8-Ansätze. Nach dem Coase-Theorem, das auf Ronald Coase zurückgeht, ist sie möglich, indem man Verfügungsrechte an Umweltressourcen festlegt und die Beteiligten in Verhandlungen treten lässt, um Pareto-Optimalität zu erlangen (Endres 2000, 33 ff). Arthur Pigou erlangte Berühmtheit mit seinem Ansatz der Pigou-Steuer. Hiernach sollte der Verursacher einer Externalität mit Steuern genau in der Höhe der externen Kosten belastet werden (Endres 2000, 108 ff.). Beide Ansätze sollten sich aufgrund von Informationsdefiziten und Transaktionskosten als in der Praxis nicht umsetzbar erweisen, dennoch lassen sich ihre Grundansätze heute in standardorientierten ökonomischen Anreizinstrumenten wiederfinden. So sind Umweltabgaben (wie die Ökosteuer in Deutschland) der Pigou-Tradition, Umweltzertifikate dem Coase-Ansatz zuzuordnen (Hansjürgens 1998, 382 f.). Sie stehen für die marktorientierten Instrumente der Umweltpolitik, die erreichen sollen, „ [...] daß ohne direkten staatlichen Eingriff ein monetärer oder sonstiger Anreiz entsteht“ (Wicke 1993, 421). Den weitaus größeren Stellenwert in der Umweltpolitik hat jedoch weiterhin das Ordnungsrecht in Form von Auflagen (auch: „Command-and-Control-Ansatz“, Lübbe-Wolff 2001, 482), das über Ge- und Verbote das Verhalten der Akteure direkt steuert, wenn auch die ökonomischen Instrumente im Begriff sind, an Bedeutung aufzuholen (Lübbe-Wolff 2001, 481 f.; Endres 2000, 246). Im Bereich des Flächenverbrauchs spricht man vom Planungsrecht, das wie das Ordnungsrecht zu den nichtfiskalischen Instrumenten der Umweltpolitik zu zählen ist (Wicke 1993, 195). Welche Vorteile marktorientierte Instrumente (explizit Umweltzertifikate) gegenüber dem Ordnungsrecht haben, soll im Verlauf dieser Arbeit herausgestellt werden (vgl. Kap.2.2.2 und Kap. 3).
2.2. Bestehende Instrumente in der Flächen- und Klimapolitik 2.2.1. Umwelt- und Planungsrecht
Nach Gawel bezeichnet Planung „einen instrumentellen Steuerungsansatz, der künftige Allokationsentscheidungen einerseits durch (mengen- und standortsteuernde) Rahmenvorgaben, andererseits durch die Einräumung eines konstitutiven ´Planungs-ermessens´ anleitet“ (Gawel 2005, 333). Das System der Flächenausweisung in Deutschland beruht traditionell auf dem Selbstverwaltungsrecht der Kommunen. Somit genießen Gemeinden nach Art. 28 Abs. 2 des Grundgesetzes und dem städtebaurechtlichen Baulandausweisungsprivileg des Baugesetzbuches Planungshoheit in diesem Bereich (Einig 2005 a, 48).
Zudem sind für die deutsche Raumordnung planerische Ansätze prägend, die auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Übergeordnet gibt der Bund raumplanerische Vorgaben aus, die auf Ebene der Länder weiter konkretisiert werden - die letztendliche Planungsgewalt obliegt schließlich den Kommunen. Nach dem „Gegenstromprinzip“ werden die Vorgaben auf höheren Ebenen dazu jeweils an den konkreten Bedürfnissen der Kommune ausgerichtet (Bizer 2005 a, 343 f.). Das Bau- und Raumordnungsgesetz (ROG) von 1998 dient dabei der Koordination der verschiedenen Planungsebenen (Heemeyer 2006, 1).
Die Instrumente der Raumplanung in der Bundesrepublik sind also Leitbilder und Handlungsstrategien auf der Ebene des Bundes, Landesentwicklungsprogramm bzw. Landesentwicklungsplan auf der Ebene der Länder, Regionalplan auf der Ebene der Regierungsbezirke und Flächennutzungsplan bzw. Bebauungsplan (Bauleitplan9) auf kommunaler Ebene (ARL 2005). Dem zuständigen Bundesministerium als oberste Planungsinstanz kommt hierbei allerdings eine untergeordnete Rolle zu. Es formuliert lediglich Handlungsempfehlungen für die nachfolgenden Instanzen und übernimmt eine Überwachungsfunktion (Bizer et al. 1998, 23).
Aufbauend auf den Leitbildern auf Bundesebene sind Landes- und Regionalpläne die Instrumente, die den Kommunen verbindliche Festlegungen vorgeben (Einig 2005 a, 50). Diese Vorgaben betreffen in erster Linie den Schutz von Freiräumen und die Entwicklung zentraler und nicht zentraler Orte (Schmalholz 2005, 83 f.) (Zentrale-Orte-Konzept und Steuerungsinstrument der kleinräumigen Siedlungsachsen10). Die Aufgabenträger der Landes- und Regionalplanung haben einerseits die Möglichkeit, über Ziele der Raumordnung Einfluss zu nehmen, die als verbindliche Vorgabe für die Gemeinden strikt einzuhalten sind. Andererseits sind Grundsätze der Raumordnung nur Verhaltensvorgaben für die Gemeinden, die zwar eine Berücksichtigungspflicht auslösen, aber durch den Ermessenspielraum der Gemeinden umgangen werden können (Einig 2005 a, 50).
Letztendlich wirksam im Hinblick auf die Nutzung von Flächen bzw. Umwidmung und Versiegelung sind die Entscheidungen auf kommunaler Ebene. Hierzu wird die Bauleitplanung genutzt, die in Flächennutzungsplänen genaue Festsetzungen trifft, welche Flächen in welcher Form genutzt werden sollen. Diese betreffen auch die Neuausweisung von Siedlungs-, Verkehrs- und Industrieflächen. Basierend auf den Flächennutzungsplänen wird in Bebauungsplänen die genaue bauliche und sonstige Nutzung der Flächen geregelt. Hierbei müssen sich die Gemeinden an den zuvor erläuterten Raumordnungsplänen des Landes und der Region orientieren, haben aber in den meisten Fällen Handlungsfreiheit innerhalb vorgegebener Schwankungsbreiten, um die gemeindespezifischen Ziele in konkrete Bodennutzungsgebote und -verbote umzusetzen (Brandt, Sanden 2003, 90). Das Baugesetzbuch, das auch Flächennutzungs-und Bebauungsplan regelt, gibt den Gemeinden mit der „Bodenschutzklausel“ (§ 1a (1)
BauGB) die Maßgabe, dass „ mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden soll “, insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen und Begrenzung von Bodenversiegelungen.
Die Kritik an der Raumordnungsplanung setzt in erster Linie daran an, dass sie zu stark qualitativ ausgerichtet ist und „[...] immer wieder am Schutzschild der kommunalen Selbstverwaltung abprallt “(Bizer et al. 1998, 39). Durch das Aufstellen von Plänen wird für die Umweltverträglichkeit einzelner Nutzungen oder die ökologische Qualität plädiert. Reine Mengenziele sind hiermit nicht zu erreichen, da über eine Einzelfallbetrachtung versucht wird, die Zielvorgaben einzuhalten (Schmalholz 2005, 135 f.). Landes- und Regionalplanung setzen nur in seltenen Fällen direkte Instrumente ein, um Siedlungsgrenzen vorzugeben. Im Landesplan werden nur unbestimmte Zielformulierungen vorgegeben, wie die Abwendung von der Zersiedlung oder Ziele bezüglich der Behandlung von Innen- und Außenbereich. Regionalpläne beschränken sich in der Regel darauf, standortsteuernd vorzugehen und den Gemeinden Handlungsspielräume zuzubilligen (Bizer et al. 1998, 25; Einig 2005 a, 51). Die Gemeinden wiederum sind dem Wohnbedarf der Bevölkerung verpflichtet und immer darauf ausgerichtet, ausreichend Flächen bereitzustellen (Einig 2005 a, 52). So sind es die lokalen fiskalischen Interessen, die die Kommunen zu erhöhter Flächenausweisung motivieren. Diese Interessen stehen jedoch oftmals übergeordneten Belangen des Umweltschutzes entgegen (von Haaren, Michaelis 2005, 325).
In der Folge wehren sich die Kommunen oftmals gegen die Regionalplanung, die sie als reine Verhinderungsplanung ansehen (Kegel 2006, 90). Und da die Kommunen keine Verpflichtung haben, sich einerseits direkt an die Vorgaben der Regionalplanung zu halten, andererseits flächenschonend zu planen (Schmalholz 2005, 110), gibt es immer wieder die Möglichkeit im Rahmen ihrer Abwägungsmöglichkeiten naturschützende Belange zurückzustellen (Schmalholz 2005, 104 f.). So ist sogar die Bodenschutzklausel durch Abwägungsentscheidungen zu umgehen, wenn entsprechende Gründe vorliegen (Troge 2001, 12; Bizer et al. 1998, 26).
Gleichermaßen fehlt es an staatlichen Kontrollmechanismen, die eine Sanktionierung der Flächennutzungspolitik der Gemeinden ermöglichen würden. Beispielsweise müssen Bebauungspläne seit 1998 nicht mehr durch die höhere Verwaltungsbehörde genehmigt werden. Hieraus lässt sich leicht fehlende Sorgfalt bei der Erstellung unterstellen (Schmalholz 2005, 115 f.). Zudem ist die sogenannte „Eingriffsregelung“, die die Kompensation eines Eingriffs in die Natur an anderer Stelle vorsieht, ebenfalls mit einer unzureichenden Steuerungswirkung ausgestattet (Schmalholz 2005, 126 ff.).
2.2.2. Auflagen in der Ordnungspolitik
Auflagen sind das zum Zwecke der Emissionsminderung bisher meistgenutzte umweltpolitische Instrument.11 Sie werden in Form von Ge- und Verboten eingesetzt. Unter Auflagen versteht man „[...] direkte umweltbezogene Verhaltensvorschriften [...]“ (Wicke 1993, 195). Als Ansatzpunkte für Ge- und Verbote können die Emissionen selbst, der Produktionsprozess oder die Produktion dienen. Somit legt der Staat beispielsweise Grenzwerte für Verunreinigungen fest, reguliert die Technologie der Produktion über Bauart- oder Betriebsnormen oder limitiert sogar die Produktions-mengen bei besonders schadstoffintensiv produzierten Gütern (Wicke 1993, 195 ff.). Als Beispiel für ein Instrument der Auflagenpolitik ist das Bundes-Immissionsschutzgesetz von 1974 zu nennen, dass Immissionen und Emissionen durch anlagen-, gebiets- und produktbezogene Maßnahmen begrenzt (Wicke 1993, 206 ff.).
Das Ordnungsrecht bringt Vorteile mit sich. So schafft es, erwünschte Verhaltensweisen treffsicher und schnell, zu geringen Kosten und leicht kontrollierbar herbeizuführen (Lübbe-Wolff 2001, 483). Aus ökonomischer Sicht hingegen mangelt es den Auflagen an Effizienz, also der Eigenschaft, die gewünschten Umweltschutzziele mit geringstem Ressourceneinsatz und zu geringsten gesamtwirtschaftlichen Kosten zu erreichen (Lübbe-Wolff 2001, 482). Das lässt sich damit begründen, dass ordnungsrechtliche Vorschriften keine Rücksicht auf verschiedene Vermeidungskosten bei den Verursachern nehmen und somit nicht zur Vermeidung an der kostengünstigsten Stelle führen. Daraus folgen ein Verstoß gegen die Verteilungsgerechtigkeit in der Gesellschaft sowie Wettbewerbsverzerrungen (Wicke 1993, 202 ff.). Darüber hinaus geben Auflagen keinen Anreiz, die Vermeidungsanstrengungen über die Vorgabe hinaus auszuweiten und die Verursacher werden immer bis zur erlaubten Menge „verschmutzen“(Shirvani 2005, 162). Wicke spricht im Zusammenhang mit Ordnungsrecht von „erheblichen ökonomisch-ökologischen Bedenken“ (Wicke 1993, 205). In seinen Augen sind die ökologischen Erfolge im Vergleich zum Mitteleinsatz zu gering (Wicke 1993, 205).
3. Zertifikate als effizientes ökonomisches Mittel
Im vorhergehenden Kapitel wurde dargestellt, aus welchen Gründen der staatliche Eingriff in der Umweltpolitik unerlässlich ist, um eine effiziente Allokation der Ressourcen zu gewährleisten. Ebenso wurde erläutert, inwiefern die bisher genutzten Instrumente nicht in der Lage sind, die Internalisierung von Externalitäten herbeizuführen. Damit geht es im Folgenden um das Thema dieser Untersuchung, den handelbaren Umweltnutzungsrechten oder Zertifikaten. Zunächst sollen der theoretische Hintergrund ihrer Wirkungsweise, dann die Besonderheiten und Ausgestaltungs-variablen dargestellt werden, bevor sich der Verfasser den praktischen Anwendungs-fällen zuwendet.
Die theoretische Diskussion zum Thema Umweltzertifikate12 entspringt der Frage nach einem ökonomischen Mittel zur Emissionsvermeidung. So beziehen sich die Autoren bei der Diskussion jeweils auf dieses Umweltproblem. Das liegt insbesondere daran, dass der Klimaschutz in der Literatur als der ideale Anwendungsbereich für ein Zertifikatesystem gilt (Voss 2003, 30). In der Diskussion um die Einführung des Systems handelbarer Flächenausweisungsrechte wird zudem immer wieder auf die „Idee des Emissionshandels“ zurückgegriffen und diese auf das Problem des Flächenverbrauchs übertragen (z.B. Bizer 1996, Schmalholz 2005, Walz, Touissant 2005, Löhr 2006). Aus diesen Gründen wird die Theorie im Folgenden ebenso aus dem Emissionsbereich hergeleitet, da es nur um die grundsätzliche Wirkungsweise des Systems geht. Die Übertragung auf die Reduzierung des Flächenverbrauchs erfolgt an späterer Stelle.
3.1. Wirkungsweise von Zertifikaten
Spricht man von Zertifikaten, so geht es um handelbare Nutzungsrechte der Ressource „Umwelt“ bzw. um handelbare Verschmutzungsrechte. Zertifikate haben den Anspruch, externe Effekte effizient zu internalisieren, indem sie die Umweltnutzung, die die Externalität auslöst, mit einem Preis bewerten. Der Preis, der im Idealfall den externen Kosten entspricht, muss also in der Allokationsentscheidung zu den privaten Kosten addiert werden. Somit hat der Anlagenbetreiber13 als Verschmutzer durch den höheren Preis einen Anreiz, die Verschmutzung einzuschränken (Endres 2000, 143 f.).
Zu diesem Zweck wird von Seiten der regulierenden Behörde ein Immissionsziel festgelegt, dass in ein Emissionsziel umgerechnet wird.14 Dieses Ziel soll einen bestimmten ökologischen Standard erfüllen – der in der Regel zu einer Emissionsvermeidung führt – und gilt als Höchstgrenze für die Verschmutzung in einem bestimmten Gebiet. Die einzelnen Anlagenbetreiber, die für die Emissionen verantwortlich sind, müssen ihre Aktivitäten auf dieses Ziel ausrichten. Zu diesem Zweck erhalten sie Zertifikate, die pro Stück zu einer bestimmten Emissionsmenge berechtigen und in der Summe genau dem angestrebten Standard entsprechen (Cansier 1996, 187 f.; Feess 1998, 119; Binder 1999, 139).
Die ausgegebenen Rechte können und sollen gehandelt werden. Anlagenbetreiber können Zertifikate verkaufen bzw. zukaufen und damit direkt die Verschmutzungs-menge, die ihnen zusteht, beeinflussen. Damit steht ihnen einerseits die Vermeidung der Umweltverschmutzung in der eigenen Anlage zur Auswahl, andererseits können sie die Vermeidung durch den Zukauf von Rechten auf eine andere Emissionsquelle übertragen (Tietenberg 2006, 1). Diese Flexibilität der Verursacher erlaubt, dass die Emissionen „dorthin“ gehandelt werden, wo sie am dringendsten benötigt werden und somit ihre beste Verwendung finden (Endres, Ohl 2004, 22 ff.). Gleichzeitig ist zu beachten, dass Knappheitssignale eine Preiserhöhung implizieren, die auf die Nachfrager der durch die Umweltnutzung entstandenen Produkte überwälzt werden sollten. Somit erreicht man auch eine Wirkung auf den Nachfragedruck und damit eine Nutzung in der ertragsstärksten Verwendung (Bizer 1996, 373).
Die Regulierung über Zertifikate führt nicht zur Pareto-Optimalität. Die dafür notwendigen Informationen über Vermeidungs- und Schadenskosten liegen im Bereich der Umweltpolitik nicht vor. Somit ist der entscheidende Vorteil einer Zertifikatslösung, dass ein politisch festgelegtes Ziel effizient erreicht wird (Bader 2000, 34). Man spricht in diesem Zusammenhang von „ökologischer Treffsicherheit“ bei gleichzeitiger „ökonomischer Effizienz“ in Form von Kosten- und Innovationseffizienz.
3.1.1. Ökologische Treffsicherheit
Die ökologische Treffsicherheit von Zertifikaten rührt aus der Tatsache, dass eine zu erreichende Zielgröße direkt von einer regulierenden Autorität vorgegeben wird. Damit setzt die Steuerung direkt an der Menge eines zu reduzierenden Verhaltens an.15 Mit einer direkten Vorgabe eines Maximums ist das ökologische Ziel demnach maßgebend für das Verhalten der Akteure und wird erreicht. Die Preisbildung für die Verschmutzung, die wie dargestellt der Internalisierung des externen Effektes dient (vgl. Kap. 2.1.3.), und die Emissionsmenge einer einzelnen Anlage wird den Akteuren über die Marktmechanismen selbst überlassen (Feess 1998, 122 f.). Allerdings ist die ökologische Wirksamkeit nur erreichbar, wenn es ein exaktes Mengenziel gibt, dass definierbar ist, d.h. es muss aus einem Immissionsziel ein Emissionsziel herleitbar sein. Diese Zielvorgabe muss stringent verfolgt und politisch durchgesetzt werden (Cansier 1996, 194).
3.1.2. Ökonomische Effizienz
Die ökonomische Effizienz ist der Hauptvorteil, den man dem Zertifikatehandel gegenüber den Auflagen zuweisen kann. Ist die ökologische Treffsicherheit noch die gleiche wie bei Auflagen, da diese auch direkte Mengenvorgaben machen, so ist es bei diesen die Kosteneffizienz, die fehlt (Feess 1998, 122).
3.1.2.1. Kosteneffizienz
Unter Kosteneffizienz versteht man in diesem Kontext die Allokation der Verschmutzungsrechte, die bei geringsten Kosten zum vorgegebenen Ziel führt (Tietenberg 2006, 28).
Die entscheidende Schwäche der Auflagenpolitik besteht darin, dass Emissionsstandards oder andere Beschränkungen zur Nutzung einer Umweltressource von Behörden vorgegeben werden, die keinen Einblick in die Kostenstrukturen (d.h. externe Kosten und Vermeidungskosten) der agierenden Unternehmen haben (vgl. Kap. 2.2.2.). Die Unternehmen oder Anlagenbetreiber selbst hingegen verfügen über diese Informationen oder können sich diese relativ leicht beschaffen. Rational für die Anlagenbetreiber wäre es jedoch, die Kosten höher anzugeben als sie tatsächlich sind, um durch einen niedrigeren zugewiesenen Vermeidungsstandard die Wettbewerbs-position zu verbessern (Tietenberg 2006, 25 f.). Handelbare Umweltnutzungsrechte können dieses Problem lösen, indem sie die Entscheidung über die zu vermeidende Umweltschädigung beim Verursacher selbst ansiedeln, indem sie einen Preis dafür einführen. Dieser Preis ist allerdings flexibel und folgt der Mengenvorgabe (Cansier 1996, 188). Somit ist es von Wichtigkeit, mit der Zertifikatemenge eine Verknappung und somit einen Nachfrageüberhang herbeizuführen. Nur so kommt es zu relevanten Preissignalen, die die im Folgenden beschriebene Lenkungswirkung aufweisen.
Durch die Einführung handelbarer Rechte kommt es zu einem Vergleich der Preise für ein Emissionsrecht mit den Grenzvermeidungskosten. Der Anlagenbetreiber kann also überprüfen, ob es für ihn günstiger ist, für die nächste Einheit Schadstoffausstoß ein Zertifikat zu kaufen oder diese zu vermeiden. Zu gleichen Überlegungen führt die Situation, in der er noch ein Zertifikat besitzt, das zu dieser Emission berechtigt. Auch in diesem Fall kommt es zu einer Abwägung zwischen einem eventuell lukrativen Verkauf der Lizenz mit entsprechender Vermeidung und dem Nutzen der Berechtigung („Opportunitätskostenprinzip“) (Pearce, Turner 1990, 111 f.).
Resultierend findet die Vermeidung immer dort statt, wo sie am günstigsten ist. Andersherum werden die Zertifikate immer dort genutzt, wo sie am dringendsten benötigt werden, weil die Vermeidung im Vergleich teurer ist. Somit bildet sich der markträumende Gleichgewichtspreis für die Zertifikate, der den gesamtwirtschaftlichen Grenzkosten der Schadstoffvermeidung bei dem vorgegebenen Emissionsniveau entspricht und es kommt zur kosteneffizienten Allokation (Koschel et al. 1998, 6, 11).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Die Funktionsweise von Emissionszertifikaten.
Quelle: Binder (1999), S. 145.
Abbildung 2 verdeutlicht die Wirkungsweise von Zertifikaten. Wir gehen in diesem Fall von 2 Emittenten mit den unregulierten Emissionsniveaus E1* und E2* und der Gesamtemission E* aus. Ziel der Regulierungsbehörde ist es nun, die Emissionen zu halbieren, sie gibt also Zertifikate aus, die zur Gesamtemission E*/2 berechtigen. Die
Angebotskurve für die Emissionszertifikate verläuft vertikal, weil die angebotene Menge exogen gegeben und unabhängig vom Preis ist. Die Emittenten vermeiden ihre Emissionen solange, bis ihre Grenzvermeidungskosten dem Preis für die Zertifikate entsprechen. Für die Restemissionen benötigen sie Zertifikate. In diesem Fall haben die Emittenten verschieden steile Grenzvermeidungskurven. Somit stellt sich ein Gleichgewicht ein, bei dem Emittent 1 immer noch mehr als die Hälfte seiner vorherigen Schadstoffe emittiert, Emittent 2 im Gegenzug mehr als die Hälfte vermeidet. Zu dieser Verteilung kommt es durch den Handel mit den Zertifikaten. Für Emittent 2 ist es dabei rational, auch zwischen E2*/2 und E2 noch Emissionen zu vermeiden, weil Emittent 1 bereit ist, für die freiwerdenden Zertifikate einen Preis zu bezahlen, der noch über den Grenzvermeidungskosten von Emittent 2 liegt (rot markierter Bereich). Somit bildet sich der markträumende Gleichgewichtspreis z heraus und die Emissionen sind dort vermieden worden, wo dies am günstigsten ist. Der Preis stimmt somit auch mit den gesamtwirtschaftlichen Grenzvermeidungskosten überein (Binder 1999, 144 f.).
3.1.2.2. Innovationseffizienz
Die Vermeidung von Emissionen erfolgt nicht nur durch die reine Reduktion von Emissionen zu Lasten des Outputs, sondern in der Regel durch die Installation von neuartigen Technologien, die die Produktion bei geringerer Emissionsmenge ermöglichen. Diese Innovationseffizienz (auch: „Dynamische Anreizwirkung“; Endres, Ohl 2004, 26 f.) gilt als weiterer Vorteil von Zertifikaten gegenüber dem Auflagenansatz. Da die Vermeidung von Emissionen zu überschüssigen Zertifikaten führt, die gewinnbringend am Markt verkauft werden können, macht eine größtmögliche Vermeidung Sinn. Dabei sollten die Vermeidungskosten allerdings unter dem Verkaufserlös für die Zertifikate liegen. Somit entsteht für den Unternehmer der Anreiz, durch Nutzung möglichst neuer Vermeidungstechnologien die Grenzvermeidungskosten zu senken (Bader 2000, 38). Die Gefahr besteht darin, dass Innovationen die Nachfrage nach Zertifikaten vermindern und der Preis somit sinkt. Das wiederum führt dazu, dass der Anreiz für technische Neuerungen schwindet. Dieses Problem ist allerdings zu vernachlässigen, geht man davon aus, dass Wirtschaftswachstum und Inflation zu steigenden Zertifikatepreisen führen (Cansier 1996, 196 f.). Wichtig sind in diesem Zusammenhang auch die Verteilungsregeln der Anfangsausstattung (vgl. Kap. 3.3). Werden die Zertifikate zu Beginn kostenlos vergeben, ist der Innovationsanreiz geringer, als wenn Anlagenbetreiber in einer Versteigerung bereits einen Preis für sie bezahlt haben (Tietenberg 2006, 43).
3.2. Die Rolle der Marktvollkommenheit
Entscheidende Voraussetzung für die ökonomische Effizienz eines Systems handelbarer Rechte ist ein funktionierender Zertifikatemarkt, weil sich nur durch den Ausgleich von Angebot und Nachfrage der markträumende effiziente Preis einstellen kann (vgl. Kap. 3.1.2.1.). In der Theorie wird davon ausgegangen, dass es sich beim Zertifikatemarkt um einen vollkommenen Markt handelt16. Dennoch können Marktunvollkommenheiten auftreten. Beispielsweise kann es wie bereits erwähnt zu Marktmacht kommen, wenn ein Unternehmen einen großen Teil von Zertifikaten hält und dadurch den Markt zu seinen Gunsten beeinflussen kann (Bader 2000, 51). Somit ist es wichtig, dass sich auf dem Markt eine große Zahl von Handelspartnern einfindet (Cansier 1996, 195 f.). Eine entsprechende Größe des Handelsraums kann dies gewährleisten (vgl. Kap. 3.3).
Ein weiterer Faktor, der in der bisherigen Betrachtung keine Berücksichtigung gefunden hat, sind Transaktionskosten. „Transaktionskosten sind definiert als Kosten für die Benutzung des Marktes (des Preismechanismus) und beinhalten die Kosten für Abwicklung und Organisation des wirtschaftlichen Austausches zwischen Transaktionspartnern“ (Zenke, Schäfer 2005, 10). Im Falle von handelbaren Rechten entstehen Transaktionskosten insbesondere bei der Suche und Auswahl geeigneter Transaktionspartner, bei Verhandlungen und Abschluss von Kaufverträgen, durch anfallende Gebühren sowie Kosten der Vertragsüberwachung und -durchsetzung (Zenke, Schäfer 2005, 10). Transaktionskosten gehen in das Entscheidungskalkül des Unternehmers mit ein. Sie können letztlich dazu führen, dass ursprünglich effizienzsteigernde Transfers nicht stattfinden. Zu hohe Transaktionskosten, die sich bei geringem Handelsvolumen auf engen Märkten noch erhöhen (Koschel et al. 1998, 12), können die ökonomische Effizienz entscheidend vermindern. Das Gleichgewicht hängt letztlich von der Anfangsausstattung ab (Tietenberg 2006, 69 ff.).
3.3. Die Primärallokation
Um ein System handelbarer Verschmutzungsrechte einzuführen und den Handel zu etablieren, bedarf es zunächst einer Regel, nach der die Rechte zu Beginn auf die Emittenten aufgeteilt werden. Dabei sollte die Ausgestaltung der Primärallokation in der Theorie keinen Einfluss auf die Kosteneffizienz, die sich nach dem Handel ergibt, haben. Die Praxis zeigt jedoch, dass die Art der Erstaustattung entscheidend ist für die ökonomische Effizienz (Tietenberg 2006, 127). Im Folgenden sollen die beiden wichtigsten Arten – die Auktionierung und die Gratisvergabe – erläutert werden.17
3.3.1. Auktionierung
Eine Möglichkeit der Erstzuteilung von Zertifikaten an Anlagenbesitzer ist die Versteigerung der Rechte. Hierbei werden die vom Staat festgelegten Zertifikate zum Höchstpreis versteigert. Die Vorteile dieser Variante werden darin gesehen, dass man direkt ein größeres Handelsvolumen erreicht, weil der gesamte Zertifikatebedarf am Markt wirksam wird. Außerdem wird den Unternehmen von Anfang an ein Preissignal gesetzt, dass sie in ihre Entscheidungen einfließen lassen können (Koschel et al. 1998, 58 f.). Im ökonomisch-allokativen Sinn wird somit das Verursacherprinzip angewendet. Die Auktionierung erreicht insgesamt die größte Effizienz gegenüber anderen Verfahren (Hansjürgens 1998, 381).
Problematisch ist diese Art der Zertifikatezuteilung allerdings im Hinblick auf die entstehenden Kosten bei den Anlagenbetreibern und der damit verbundenen Finanzmittelumverteilung vom privaten zum öffentlichen Sektor. Zudem bringt sie für die Unternehmen Planungsunsicherheit für Produktion und Investition mit sich, da es keine garantierte Zuteilung gibt (Kemper 1989, 44 f.). Somit ist auch die politische Durchsetzbarkeit als gering einzuschätzen (Tietenberg 2006, 138). Studien haben außerdem gezeigt, dass die gesamte finanzielle Belastung aller Anlagenbetreiber durch eine Auktionierung zu insgesamt höheren Regulierungskosten als die Auflagenlösung führt (Tietenberg 2006, 132 ff.). Gleichzeitig kann ein Verdrängungsmechanismus zu Lasten kleiner oder finanzschwacher Unternehmen einsetzen, die nicht in der Lage sind, die Preise für die Lizenzen zu zahlen (Koschel et al. 1998, 59; Tietenberg 2006, 134 ff.).
[...]
1 Unter Bodenversiegelung versteht man die Verdichtung, Abdichtung oder Auffüllung des Bodens sowie Aufschüttungen durch menschliche Einwirkungen (z.B. Bebauung). Dadurch ist das Einsickern von Regenwasser nicht mehr möglich.
2 Zersiedelung beschreibt die Entwicklung des unkontrollierten Wachstums von Siedlungsbereichen in die unbebaute Landschaft, außerhalb von Städten, hinein (Hesse, Kaltenbrunner 2005).
3 Im Folgenden werden die Begriffe Externer Effekt und Externalität synonym verwendet.
4 Der Begriff Allokation bezeichnet in der Wirtschaftswissenschaft die Aufteilung knapper Ressourcen (in erster Linie Arbeit, Kapital, Umwelt und Boden als Produktionsfaktoren) auf verschiedene Verwendungsarten, die über Marktpreise zu Effizienz derart führen soll, dass Ressourcen dort Ver-
5 Für ausführliche Erläuterungen der mikroökonomischen Zusammenhänge vgl. Pearce/Turner 1990, 61 ff. und Endres 2000, 13 ff.
6 Pareto-Optimalität liegt vor, wenn keiner der Beteiligten bessergestellt werden kann, ohne einen anderen schlechter zu stellen (Endres 2000, 10).
7 An dieser Stelle ist wichtig zu erwähnen, dass es nicht die z.B. für Bebauung genutzte Fläche an sich ist, die als öffentliches Gut zu verstehen ist. Böden beinhalten sehr wohl individuelle Rechtspositionen (Schmalholz 2005, 7), doch stellt sich der externe Effekt nicht durch Beeinträchtigung der einzelnen Fläche an sich ein, sondern indem der Flächenverbrauch die Landschaft und die Natur mit all seinen ökologischen Funktionen, die allen (z.B. zu Naherholungszwecken) zugänglich ist, in Mitleidenschaft gezogen wird.
8 „First-Best“ und „Second-Best“ sind Begriffe aus der „Theory of the second-best“ von Lipsey und Lancaster von 1956, nach der das beste Marktgleichgewicht aufgrund von Marktversagen nicht erreichbar ist. In diesem Fall ist es das „zweitbeste“ Marktgleichgewicht, das zu einem weniger effizienten Optimum führt. Diese „second-best“- Politik muss immer dann verfolgt werden, wenn nicht alle Gleichgewichtsbedingungen gleichzeitig erfüllt werden können (Suranovic 2007).
9 Von Bauleitplänen spricht man als Oberbegriff von Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) und Bebauungsplan (verbindlicher Bauleitplan) (ARL 2005, 75 ff.).
10 Zur Ausgestaltung dieser Konzepte vgl. z.B. Bizer, Ewringmann et al. 1998, 24.
11 Mittlerweile sind auch im Bereich des Klimaschutzes vermehrt ökonomische Instrumente zum Einsatz gekommen. In Deutschland ist die Öko-Steuer als Beispiel zu nennen. Im Rahmen dieser Ausarbeitung soll dieser Aspekt jedoch vernachlässigt werden.
12 Die Begriffe „(Umwelt-)Zertifikat“ und „handelbares Recht“ werden im Folgenden synonym gebraucht.
13 Der Begriff „Anlage“ bezeichnet in diesem Zusammenhang eine Industrieanlage, die für Emission von Schadstoffen verantwortlich ist.
14 Unter Emissionen versteht man allgemein die Aussendung von Teilchen, Strahlung oder Kräften in die Umwelt, Immissionen bezeichnen den Eintrag von Schadstoffen in ein Umweltmedium (ARL 2005).
15 Ganz im Gegensatz zur sogenannten Preissteuerung, bspw. bei einem Ansatz über eine Emissionssteuer, bei dem ein Preis für die Nutzung einer Ressource vorgegeben wird und sich die Menge hieran anpassen soll.
16 Zum Begriff des vollkommenen Marktes vgl. z.B. Schumann, Meyer, Ströbele 1999, 207 ff.
17 Die Literatur verweist auch noch auf die Verlosung, das Windhundverfahren (Tietenberg 2006, 128) und den Verkauf zum staatlichen Festpreis (Kemper 1989, 45 f.).
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Flächenverbrauch?
Es ist die Umwandlung von landwirtschaftlicher oder natürlicher Fläche in Siedlungs- und Verkehrsfläche (SuV), wodurch Lebensraum für Ökosysteme verloren geht.
Wie funktioniert ein System handelbarer Flächenausweisungsrechte?
Nach Vorbild des CO2-Handels erhalten Kommunen Zertifikate für die Flächenausweisung, die sie bei Nichtbedarf an andere Kommunen verkaufen können.
Was kann die Flächenpolitik vom EU-Emissionshandel lernen?
Die Arbeit untersucht Erfahrungen mit der Primärallokation (Zuteilung), der ökologischen Treffsicherheit und dem Umgang mit Lobbyismus im Zertifikatehandel.
Was ist das Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung?
Das Ziel ist es, den täglichen Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsfläche bis zum Jahr 2020 auf 30 Hektar pro Tag zu reduzieren.
Was ist die „Hot-Spot“-Problematik im Flächenhandel?
Es beschreibt das Risiko, dass sich Flächenausweisungen in bestimmten attraktiven Regionen konzentrieren, während andere Gebiete leer ausgehen.
- Quote paper
- Karsten Lobsien (Author), 2007, Ein System handelbarer Flächenausweisungsrechte - Was kann man aus dem CO2-Handel lernen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138657