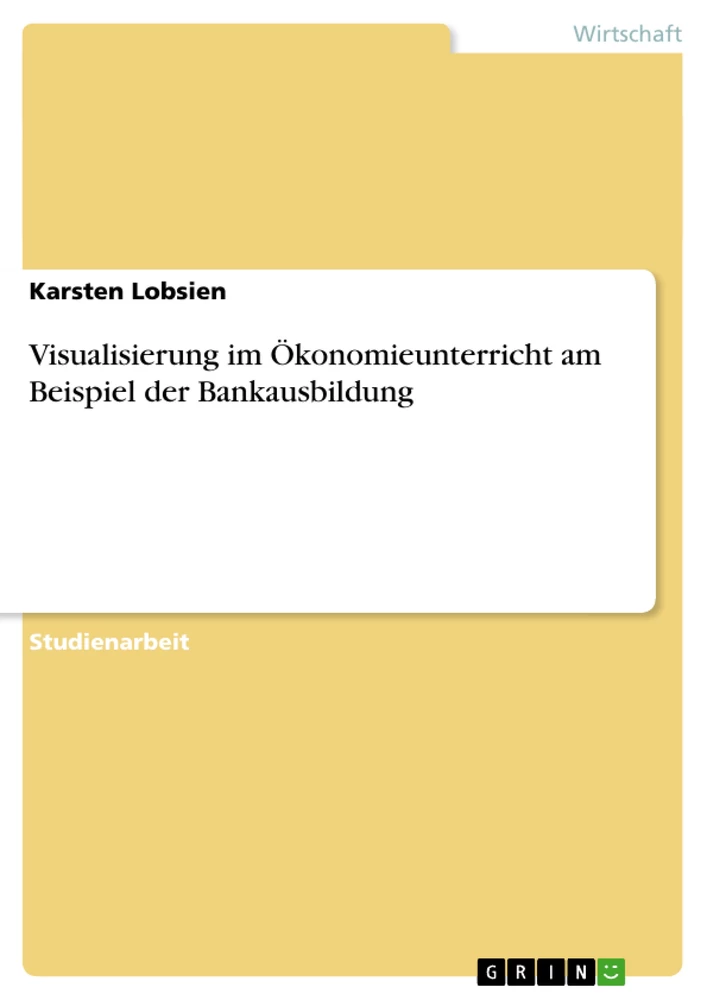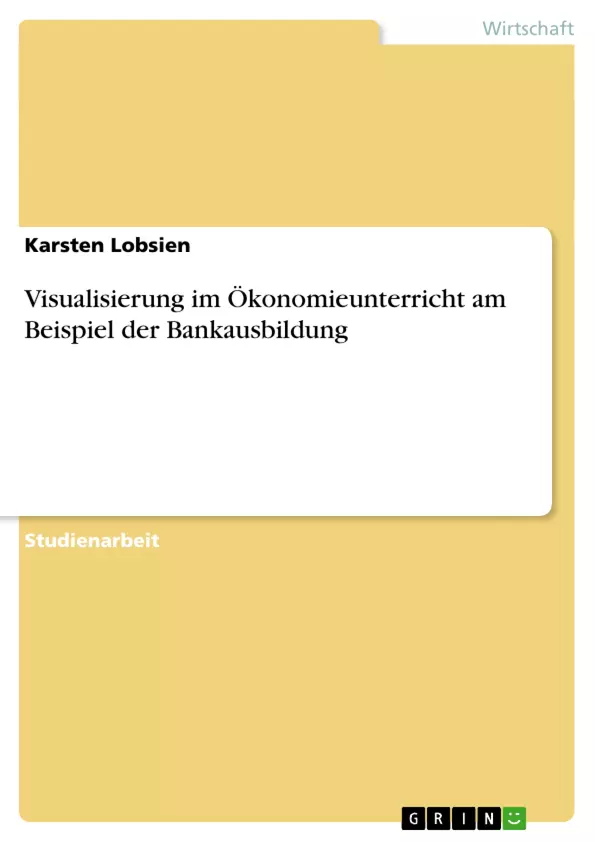In der heutigen Berufsausbildung müssen komplexe Wissensbestände an die Auszubildenden vermittelt werden, die allerdings nicht allein durch Kommunikation mit Experten erlernt werden können. Unweigerlich ist der Umgang mit Texten und Abbildungen vonnöten, um entsprechende Lernerfolge zu erzielen. Den Visualisierungen fällt hierbei eine besondere Rolle zu, da sie einerseits eine wichtige Ergänzung zu Texten darstellen, um die drei Aspekte der Lernwirksamkeit Verstehen, Behalten und Handeln zu fördern, auf der anderen Seite aber in der Schule vernachlässigt werden, was die Vermittlung von Strategien zur Auswertung angeht. Somit ist es besonders wichtig, das bereits von Seiten der Schulbuchautoren Visualisierungen in einer Weise eingebunden werden, dass sie den Lerner unterstützen und fördern, nicht etwa verunsichern oder gar behindern.
Die vorliegende Seminararbeit setzt sich zum Ziel, nach einigen theoretischen und wissenschaftlichen Vorüberlegungen zum Einsatz von Abbildungen im Rahmen des Multimedia-Lernens das Standard-Lehrbuch in der Ausbildung zur/zum Bankkauffrau/-mann, „Wirtschaftslehre des Kreditwesens“ (1998) von Wolfgang Grill und Hans Perczynski auf die entsprechende Umsetzung zu untersuchen und etwaige Verbesserungsmöglichkeiten zu erläutern.
Der Verfasser der Arbeit hat hieran besonderes Interesse, da er selbst mal die Ausbildung zum Bankkaufmann durchlaufen hat und als Student der Wirtschaftspädagogik den Beruf des Berufsschullehrers anstrebt und hier auch konkretes Interesse an Bankauszubildenden hat.
Zunächst wird er die Kognitive Theorie des Multimedia-Lernens streifen, anschließend auf das didaktische Design und die Richtlinien zur Gestaltung von Charts, Tabellen und Abbildern eingehen, um abschließend die Umsetzung dieser Richtlinien im oben genannten Lehrbuch zu erörtern.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Kognitive Theorie des Multimedia-Lernens
3. Didaktisches Design
3.1. Charts
3.2. Tabellen
3.3. Abbilder
4. Das Lehrbuch „Wirtschaftslehre des Kreditwesens“ (1998)
5. Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang
1. Einleitung
In der heutigen Berufsausbildung müssen komplexe Wissensbestände an die Auszubildenden vermittelt werden, die allerdings nicht allein durch Kommunikation mit Experten erlernt werden können. Unweigerlich ist der Umgang mit Texten und Abbildungen vonnöten, um entsprechende Lernerfolge zu erzielen. Den Visualisierungen fällt hierbei eine besondere Rolle zu, da sie einerseits eine wichtige Ergänzung zu Texten darstellen, um die drei Aspekte der Lernwirksamkeit Verstehen, Behalten und Handeln zu fördern, auf der anderen Seite aber in der Schule vernachlässigt werden, was die Vermittlung von Strategien zur Auswertung angeht. Somit ist es besonders wichtig, das bereits von Seiten der Schulbuchautoren Visualisierungen in einer Weise eingebunden werden, dass sie den Lerner unterstützen und fördern, nicht etwa verunsichern oder gar behindern.
Die vorliegende Seminararbeit setzt sich zum Ziel, nach einigen theoretischen und wissenschaftlichen Vorüberlegungen zum Einsatz von Abbildungen im Rahmen des Multimedia-Lernens das Standard-Lehrbuch in der Ausbildung zur/zum Bankkauffrau/-mann, „Wirtschaftslehre des Kreditwesens“ (1998) von Wolfgang Grill und Hans Perczynski auf die entsprechende Umsetzung zu untersuchen und etwaige Verbesserungsmöglichkeiten zu erläutern.
Der Verfasser der Arbeit hat hieran besonderes Interesse, da er selbst mal die Ausbildung zum Bankkaufmann durchlaufen hat und als Student der Wirtschaftspädagogik den Beruf des Berufsschullehrers anstrebt und hier auch konkretes Interesse an Bankauszubildenden hat.
Zunächst wird er die Kognitive Theorie des Multimedia-Lernens streifen, anschließend auf das didaktische Design und die Richtlinien zur Gestaltung von Charts, Tabellen und Abbildern eingehen, um abschließend die Umsetzung dieser Richtlinien im oben genannten Lehrbuch zu erörtern.
2. Kognitive Theorie des Multimedia-Lernens
Der Begriff Multimedia wird unterschiedlich verwendet, im Zusammenhang dieser Arbeit soll er als das Lernen durch Worte und Bilder, speziell die Förderung des Lernens durch das Zusammenspiel von Text und Abbildung verstanden werden.
Um die Bedeutung von Visualisierungen im Lehrbuch zu verstehen, muss zunächst erläutert werden, wie der Mensch lernt, d.h. wie er verschieden geartete Informationen aufnimmt, verarbeitet und speichert.
Dazu hat Richard E.Mayer drei Hypothesen aufgestellt.
Zunächst geht er davon aus, dass der Mensch für die Informationsverarbeitung zwei Kanäle zur Verfügung hat, den auditiven/verbalen Kanal und den visuellen/bildhaften Kanal, wobei der erstgenannte für die Aufnahme von gehörten Informationen, der zweite für die Aufnahme visueller Informationen zuständig ist.
Zum zweiten sind beide Kanäle in ihrer Kapazität begrenzt, so dass nur ein bestimmter Umfang an kognitiver Verarbeitung in jedem dieser Kanäle stattfinden kann.
Drittens kann sinnvolles Lernen nur durch einen erheblichen Umfang an kognitiver Verarbeitung in den verbalen und visuellen Kanälen, d.h. Konzentration auf das vorgelegte Material, geistiges Anordnen der Informationen in einer schlüssigen Struktur und schließlich Verknüpfung mit bereits bestehendem Wissen, erreicht werden.[1]
Beim Multimedia-Lernen ist von drei Datenspeichern im menschlichen Gehirn auszugehen, man unterscheidet den Sinnesspeicher, den Arbeitsspeicher und das Langzeitgedächtnis. Eingehende Bilder und Wörter gelangen über das Auge in den Sinnesspeicher, in welchem sie nur eine sehr kurze Zeit verbleiben können, genauso gelangt das gesprochene Wort über das Ohr in diesen Sinnesspeicher. Im Arbeitsspeicher werden die aufgenommenen Informationen dann bei aktivem Bewusstsein gehalten und bearbeitet. Hierbei werden aufgenommene Bilder, Zeichen und Töne untereinander umgewandelt (z.B. das gesprochene Wort “Auto“ in das Bild eines Autos oder umgekehrt) und dabei in Wissen umgestaltet, bildliche sowie verbale Modelle sowie Verknüpfungen zwischen ihnen. Das letztgenannte, das Langzeitgedächtnis, kann große Datenmengen aufnehmen und über lange Zeit speichern, um diese Daten allerdings nutzen zu können, müssen sie in den Arbeitsspeicher übertragen werden.
Zum Sinnvollen Lernen in einer Multimedia-Umgebung bedarf es demnach 5 Prozessen, die sich im Arbeitsspeicher abspielen, wobei die Reihenfolge dieser Prozesse nicht vorgegeben ist:
1. Auswahl relevanter Wörter: Der Lerner muss aus den Wörtern, die er entweder als verbale Vorlage oder auch als gedruckten Text aufnimmt, die relevanten herausfiltern. Die Notwendigkeit besteht aufgrund der limitierten Aufnahmekapazität in den Kanälen des kognitiven Systems.
2. Auswahl relevanter Bilder: Analog zum vorgenannten Punkt geht es darum, aus der Vielzahl der aufgenommenen Bilder und Grafiken bzw. der vielfältigen Bestandteile eines Schaubildes die für den Lerner relevanten herauszusuchen, um die Kapazität des Aufnahmekanals nicht zu überlasten.
3. Organisation der ausgewählten Wörter: In diesem Schritt geht es darum, dass der Lerner aus den gewählten Wörtern eine stimmige Darstellung zusammenstellt, indem er Verbindungen zwischen den einzelnen Teilen herstellt. Auch hier stößt er an Kapazitätsgrenzen, daher muss das zu erstellende Modell möglichst simpel ausfallen.
4. Organisation der ausgewählten Bilder: Vergleichbar mit dem zuvor beschriebenen Schritt bildet der Lerner aus der zusammengestellten Auswahl an Bildern eine sinnvolle Struktur, indem er Verknüpfungen erstellt und somit eine strukturierte Darstellung im Gehirn zur Verfügung hat.
5. Zusammenfassen der wortbasierten und bildbasierten Darstellung: Der entscheidende Schritt besteht darin, dass aus den in den vorhergehenden Schritten erstellten Darstellungen sowie bereits vorhandenem Wissen aus dem Langzeitgedächtnis ein Gesamtbild erstellt wird. Hierzu wird sowohl das visuelle als auch das verbale Arbeitsmedium angesprochen.[2]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.1 : Aufarbeitung von Bildern und gedruckten Wörtern
Quelle: Mayer (2005), S.43
3. Didaktisches Design
Aus den vorhergehenden theoretischen Überlegungen wird deutlich, inwiefern die sorgfältige Aufbereitung der unterstützenden Visualisierung in einem Lehrbuch zur Unterstützung des Lernerfolges beiträgt. Die Darstellung von Zusammenhängen sollte bereits von Seiten der Autoren derart gestaltet sein, dass sie auf die begrenzten Kapazitäten der bei der Aufnahme der Inhalte beteiligten Sinnesorgane und ihrer Speicher zugeschnitten ist.
„Didaktisches Design ist die planmäßige und lernwirksame Entwicklung von Lernumgebungen (von der Bedarfsanalyse bis zu Evaluation) auf wissenschaftlicher Grundlage.“[3]
[...]
[1] Vgl. Mayer/Moreno (2003) S.44
[2] vgl. Mayer (2005) S.37 ff.
[3] Ballstaedt (1997) S.12
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Visualisierung beim Lernen so wichtig?
Bilder ergänzen Texte und fördern das Verstehen, Behalten und Handeln, indem sie komplexe Informationen anschaulicher und leichter verarbeitbar machen.
Was besagt die Kognitive Theorie des Multimedia-Lernens?
Nach Richard E. Mayer lernt der Mensch besser durch eine Kombination aus Worten und Bildern, da Informationen über zwei separate Kanäle (visuell und auditiv) verarbeitet werden.
Welche 5 Prozesse spielen sich beim Multimedia-Lernen ab?
Die Prozesse umfassen: Auswahl relevanter Wörter, Auswahl relevanter Bilder, Organisation der Wörter, Organisation der Bilder und die Integration beider Modelle mit Vorwissen.
Was ist "Didaktisches Design" bei Schulbüchern?
Es ist die planmäßige Gestaltung von Lernumgebungen, die darauf abzielt, Inhalte so aufzubereiten, dass sie die begrenzte Kapazität des menschlichen Arbeitsspeichers nicht überlasten.
Wie sollten Tabellen und Charts gestaltet sein?
Sie sollten übersichtlich sein, auf unnötige Dekoration verzichten und den Fokus direkt auf die relevanten Daten lenken, um den Lernprozess zu unterstützen.
- Arbeit zitieren
- Karsten Lobsien (Autor:in), 2005, Visualisierung im Ökonomieunterricht am Beispiel der Bankausbildung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138662