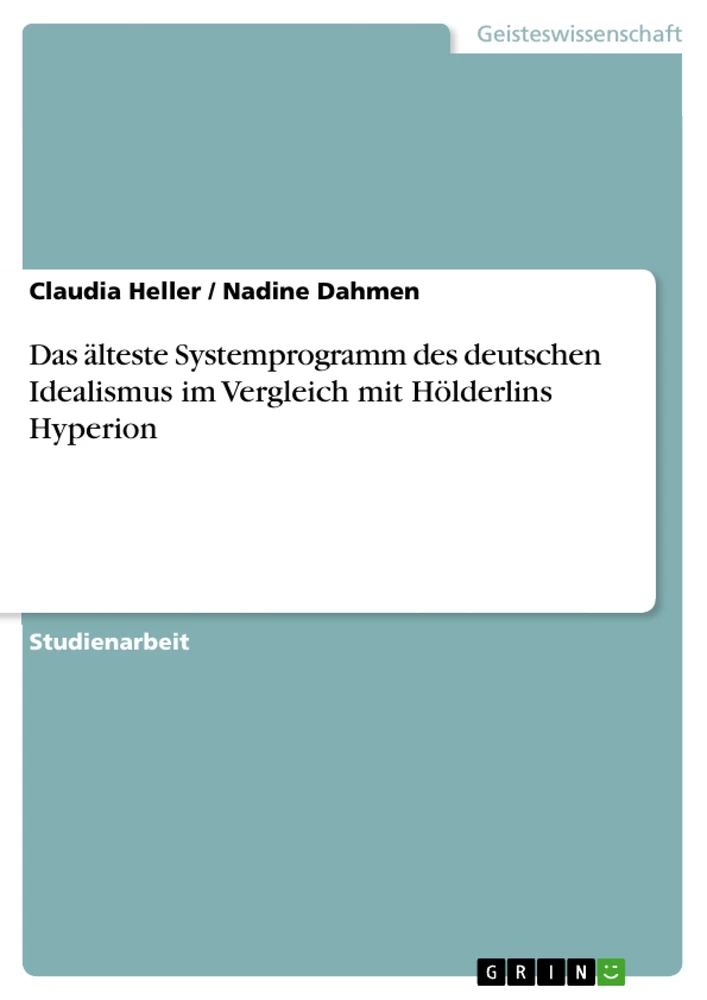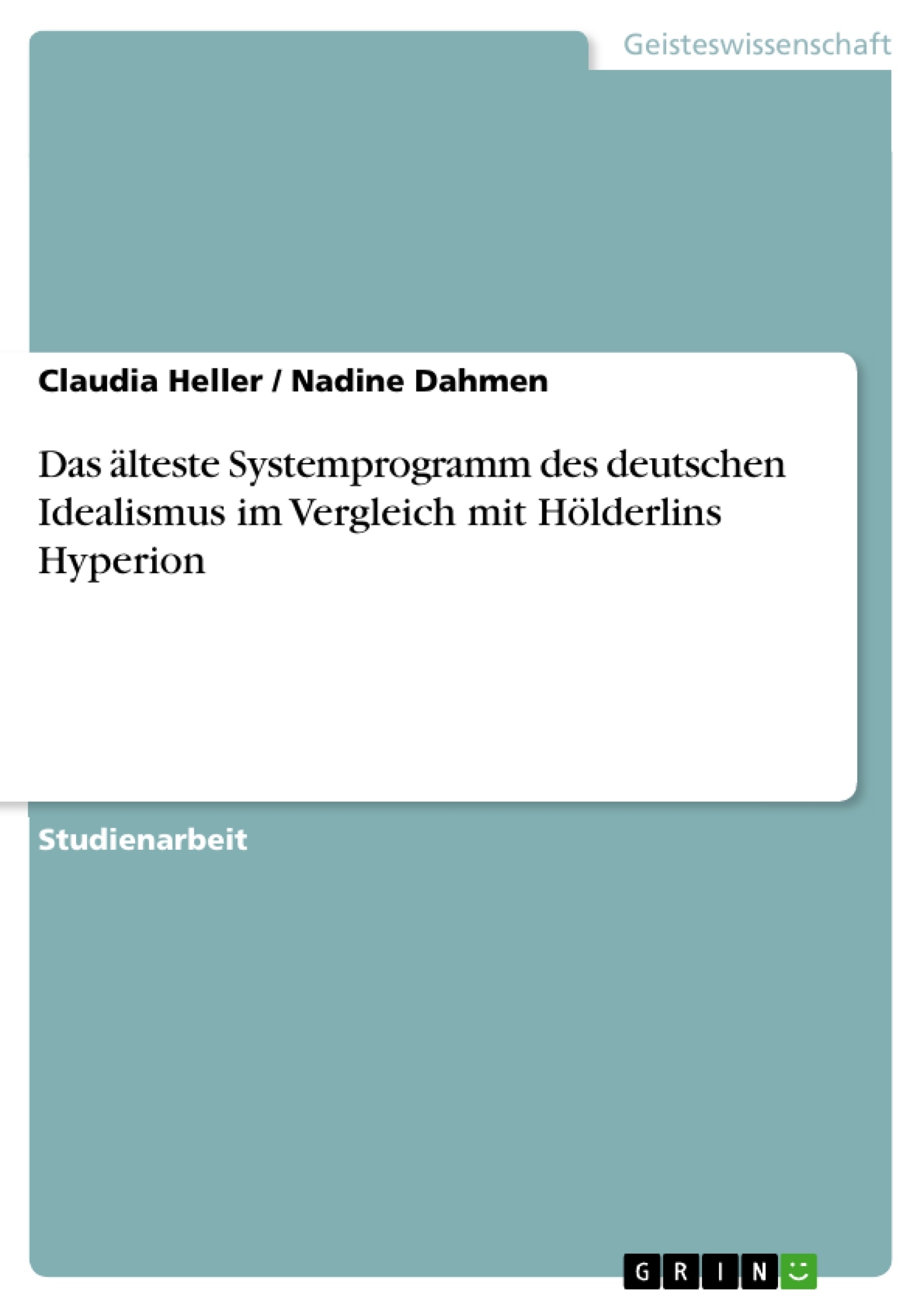Im Rahmen unserer Exkursion in die Dichter- und Denkerstadt Tübingen, bietet sich natürlich der Text „Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus“ mit seiner zweifelhaften Verfasserschaft an, um gleich einen groben Einblick in mehrere Denkweisen des 18. Jahrhunderts wie z.B. Hegel, Kant, Sinclair und einige andere, zu bekommen. Zu Beginn wollen wir uns zunächst mit der Verfasserfrage und der Überlieferung dieses Textes beschäftigen. Den inhaltlichen Aufbau werden wir nur grob ansprechen und dann im 6. Kapitel einen besonderen Bezug zu Hölderlin herstellen. Vorab wollen wir herausfinden ob Hölderlin Dichter oder Philosoph war. Im Zusammenhang mit seinem Roman „Hyperion“ werden wir sowohl seine Philosophie darstellen als auch einen Vergleich zu einem Teil aus dem Systemprogramm anstellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus
- 2.1 Die Überlieferung des Manuskripts
- 2.2 Inhaltlicher Aufbau des Systemprogramms – ein kurzer Überblick
- 2.3 Die Verfasserfrage
- 3. Hölderlin-Dichter oder Philosoph
- 4. Hegel und Hölderlin
- 5. Hölderlins Ideen aus den letzten beiden Briefen des Hyperion 2. Band
- 5.1 Erster Brief, 2. Band
- 5.2 Zweiter Brief, 2. Band
- 6. Der Mittelteil des ältesten Systemprogramms im Bezug auf Hölderlin
- 7. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das „Älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus“ im Kontext von Hölderlins Hyperion. Ziel ist es, einen Vergleich zwischen den philosophischen Ansätzen des anonymen Systemprogramms und Hölderlins Werk vorzunehmen und die Beziehung zwischen beiden zu beleuchten. Die Verfasserfrage des Systemprogramms wird ebenfalls thematisiert.
- Vergleichende Analyse des „Ältesten Systemprogramms“ und Hölderlins Hyperion
- Untersuchung der philosophischen Ansätze im Systemprogramm
- Die Verfasserfrage des „Ältesten Systemprogramms“
- Hölderlins Rolle als Dichter und Philosoph
- Einfluss der Französischen Revolution auf die philosophischen Strömungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Kontext der Arbeit: die Exkursion nach Tübingen und die Analyse des „Ältesten Systemprogramms des deutschen Idealismus“ im Vergleich zu Hölderlins Werk. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und kündigt die Auseinandersetzung mit der Verfasserfrage und dem inhaltlichen Aufbau des Systemprogramms an. Der Fokus liegt auf dem Vergleich mit Hölderlins Philosophie, insbesondere im Kontext seines Romans Hyperion.
2. Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über das viel diskutierte Hegelsche Manuskript. Es betont die Bedeutung des Textes für die Hegel-, Hölderlin- und Schelling-Forschung. Der Abschnitt skizziert den Text als relevant für ein Seminar über Hegel und Hölderlin.
2.1 Die Überlieferung des Manuskripts: Dieser Abschnitt beschreibt die Geschichte des Manuskripts, beginnend mit seinem Erwerb durch die königliche Bibliothek in Berlin im Jahr 1913. Die anfängliche Bezeichnung als „Abhandlung über Ethik“, die Bestimmung der Handschrift als Hegels und die spätere Publikation durch Franz Rosenzweig werden erläutert. Die Bedeutung von Dieter Henrichs Forschung und die Wiederentdeckung des Originals in der Jagellonischen Bibliothek in Krakau nach dem Zweiten Weltkrieg werden hervorgehoben. Die Bedeutung der Überlieferungsgeschichte für die Interpretation wird klar.
2.2 Inhaltlicher Aufbau des Systemprogramms – ein kurzer Überblick: Dieser Abschnitt gibt einen kurzen Überblick über den inhaltlichen Aufbau des Systemprogramms. Aufgrund des Umfangs wird sich auf den Mittelteil konzentriert, welcher die Ästhetik und Poesie behandelt. Dieser Abschnitt wird später mit Hölderlins Werk verglichen. Es wird kurz auf den Einfluss von Kant und die Thematik der Freiheit eingegangen. Der Begriff „System“ wird im Kontext der Entstehungszeit erklärt und als ein Aggregat von Einzelheiten verstanden, das über Kant hinausgeht.
3. Hölderlin-Dichter oder Philosoph: Dieses Kapitel (dessen Inhalt nicht im Ausgangstext vorhanden ist) würde eine Analyse von Hölderlins Rolle als Dichter und Philosoph beinhalten, seine philosophischen Einflüsse und wie diese sich in seinem Werk widerspiegeln. Es würde die Grundlage für den Vergleich mit dem Systemprogramm legen.
4. Hegel und Hölderlin: Dieses Kapitel (dessen Inhalt nicht im Ausgangstext vorhanden ist) würde die Beziehung zwischen Hegel und Hölderlin untersuchen. Es würde auf gemeinsame Einflüsse, philosophische Übereinstimmungen und Unterschiede eingehen und den Rahmen für den folgenden Vergleich bilden.
5. Hölderlins Ideen aus den letzten beiden Briefen des Hyperion 2. Band: Diese Kapitel würde sich mit den philosophischen Ideen in den letzten beiden Briefen des zweiten Bands von Hölderlins Hyperion befassen. Eine detaillierte Analyse der Briefe, deren Kernaussagen und deren Bedeutung im Kontext von Hölderlins Gesamtwerk wäre notwendig.
6. Der Mittelteil des ältesten Systemprogramms im Bezug auf Hölderlin: Dieser Abschnitt würde einen detaillierten Vergleich zwischen dem Mittelteil des Systemprogramms und Hölderlins Werk vornehmen. Es würde untersucht werden, wie sich die philosophischen Ansätze in beiden Texten ähneln und unterscheiden. Der Fokus läge auf der Ästhetik und Poesie.
Schlüsselwörter
Deutscher Idealismus, Ältestes Systemprogramm, Hegel, Hölderlin, Hyperion, Philosophie, Ästhetik, Poesie, Freiheit, Kant, Französische Revolution, Verfasserfrage, Manuskriptüberlieferung.
Häufig gestellte Fragen zum "Ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus" im Kontext von Hölderlins Hyperion
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das "Älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus" und vergleicht es mit Hölderlins Werk, insbesondere mit seinem Roman Hyperion. Der Fokus liegt auf der vergleichenden Analyse der philosophischen Ansätze beider Texte und der Klärung der Beziehung zwischen ihnen. Die Verfasserfrage des Systemprogramms spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: eine vergleichende Analyse des Systemprogramms und Hyperions, die Untersuchung der philosophischen Ansätze im Systemprogramm, die Verfasserfrage des Systemprogramms, Hölderlins Rolle als Dichter und Philosoph und den Einfluss der Französischen Revolution auf die behandelten philosophischen Strömungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus (inkl. Unterkapitel zur Überlieferung des Manuskripts und zum inhaltlichen Aufbau), Hölderlin – Dichter oder Philosoph, Hegel und Hölderlin, Hölderlins Ideen aus den letzten beiden Briefen des Hyperion (2. Band), Der Mittelteil des ältesten Systemprogramms im Bezug auf Hölderlin und Schlusswort.
Was wird im Kapitel "Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus" behandelt?
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über das umstrittene Hegelsche Manuskript und seine Bedeutung für die Hegel-, Hölderlin- und Schelling-Forschung. Es beleuchtet die Überlieferung des Manuskripts, beginnend mit seinem Erwerb durch die Berliner Bibliothek bis hin zur Wiederentdeckung in Krakau. Der inhaltliche Aufbau wird kurz skizziert, wobei der Schwerpunkt auf dem Mittelteil liegt, der Ästhetik und Poesie behandelt.
Was ist der Inhalt des Kapitels zur Manuskriptüberlieferung?
Dieses Unterkapitel beschreibt die Geschichte des Manuskripts, von seinem Erwerb durch die königliche Bibliothek in Berlin 1913 über die anfängliche Bezeichnung als "Abhandlung über Ethik" und die Zuschreibung an Hegel bis hin zur Publikation durch Franz Rosenzweig. Es hebt die Bedeutung von Dieter Henrichs Forschung und die Wiederentdeckung des Originals nach dem Zweiten Weltkrieg hervor und betont die Bedeutung der Überlieferungsgeschichte für die Interpretation.
Wie wird Hölderlin in dieser Arbeit betrachtet?
Die Arbeit untersucht Hölderlin sowohl als Dichter als auch als Philosoph. Seine philosophischen Einflüsse und deren Spiegelung in seinem Werk bilden die Grundlage für den Vergleich mit dem Systemprogramm. Die philosophischen Ideen in den letzten beiden Briefen des zweiten Bandes von Hyperion werden detailliert analysiert.
Welcher Vergleich steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Der zentrale Vergleich liegt zwischen dem Mittelteil des "Ältesten Systemprogramms" und Hölderlins Werk, insbesondere hinsichtlich der Ästhetik und Poesie. Es wird untersucht, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den philosophischen Ansätzen beider Texte bestehen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Deutscher Idealismus, Ältestes Systemprogramm, Hegel, Hölderlin, Hyperion, Philosophie, Ästhetik, Poesie, Freiheit, Kant, Französische Revolution, Verfasserfrage, Manuskriptüberlieferung.
- Citation du texte
- Claudia Heller (Auteur), Nadine Dahmen (Auteur), 2009, Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus im Vergleich mit Hölderlins Hyperion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138665