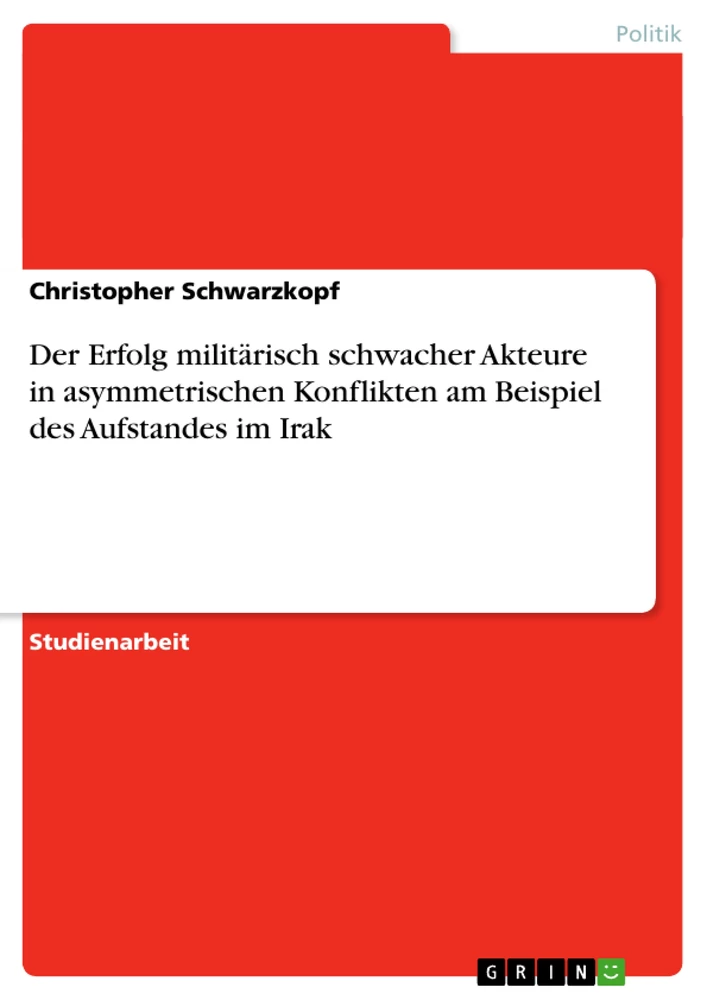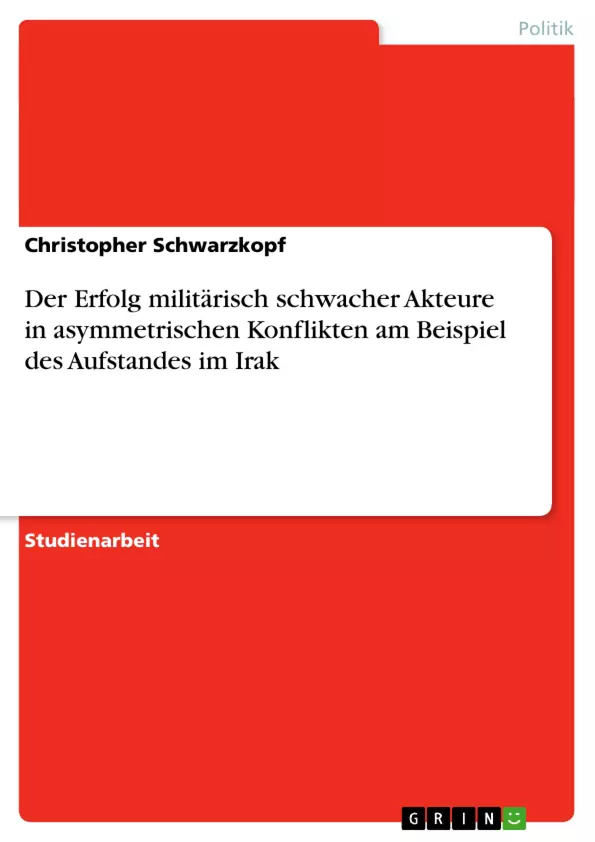Am 1. Mai 2003 verkündete der damalige US-Präsident George W.Bush das offizielle Ende der Kampfhandlungen im Irak. Zuvor waren die Streitkräfte der USA und ihrer Verbündeten in nur zwei Monaten bis Bagdad vorgedrungen und hatten dabei die irakischen Streitkräfte ohne nennenswerte Gegenwehr vernichtend geschlagen und den ehemaligen Machthaber Saddam Hussein gestürzt. Doch bereits kurze Zeit später begann ein bewaffneter Aufstand, der seit nunmehr 6 Jahren andauert. Der Konflikt hat allein zwischen dem Beginn des Aufstandes im Sommer 2003 und Juni 2006 etwa 2.000 Opfer unter den amerikanischen Soldaten gefordert, rund 16-mal so viele wie der eigentliche Krieg. Trotz intensiver Bemühungen ist es den militärisch deutlich überlegenen US-Streitkräften bis zum heutigen Tag nicht gelungen, ihren vermeintlich schwachen und leicht zu besiegenden Gegner zu bezwingen. An dieser Stelle kommt die Frage auf, wie sich der Erfolg der irakischen Aufstandsbewegung in ihrem Kampf gegen die US-Truppen erklären lassen könnte. Der Konflikt im Irak ist nicht der erste Fall, in dem eine militärische Supermacht wie die Vereinigten Staaten in einem so genannten „asymmetrischen Konflikt“ massive Probleme
hat, einen vermeintlich schwachen und leicht zu besiegenden Gegner zu bezwingen. So hat es beispielsweise in Vietnam (1946-1975), in Algerien (1954-1962) oder in Afghanistan
(1979-1989) jeweils ein militärisch schwacher Akteur geschafft, sich gegen seinen überlegenen Gegner durchzusetzen und den Konflikt für sich zu entscheiden. Verschiedene Autoren haben sich vor diesem Hintergrund bereits mit dem Erfolg schwacher Akteure in
asymmetrischen Konflikten beschäftigt und dabei mehrere Faktoren identifiziert, die diesen zu begünstigen scheinen. Im Hauptteil dieser Arbeit soll dementsprechend untersucht werden, welche dies sind und ob sie sich auch dafür eignen, den Erfolg der irakischen
Aufstandsbewegung zu erklären. Zuvor soll jedoch zum besseren Verständnis in einem ersten Schritt ein knapper Überblick
über den Konflikt selber gegeben werden, um zu klären, wer die Aufständischen überhaupt sind und aus welchem Grund sie den bewaffneten Kampf gegen die US-Streitkräfte aufgenommen haben. Anschließend soll geklärt werden, ob es sich hier überhaupt um einen asymmetrischen Konflikt handelt und wenn ja, warum. Dazu wird untersucht, was einen solchen eigentlich ausmacht und inwiefern sich die zentralen Merkmale einer derartigen
Auseinandersetzung auch im Falle des Irak erkennen lassen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Der Aufstand im Irak – Akteure, Motive, Verlauf
3. Warum es sich um einen asymmetrischen Konflikt handelt
4. Erfolgsfaktoren des Aufstandes
4.1. Stärkerer Wille
4.2. Überlegene Strategie
4.3. Externe Unterstützung
5. Fazit
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Am 1. Mai 2003 verkündete der damalige US-Präsident George W. Bush das offizielle Ende der Kampfhandlungen im Irak. Zuvor waren die Streitkräfte der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten in nur zwei Monaten bis Bagdad vorgedrungen und hatten dabei die irakischen Streitkräfte ohne nennenswerte Gegenwehr vernichtend geschlagen und den ehemaligen Machthaber Saddam Hussein gestürzt. Doch bereits kurze Zeit später, im Sommer desselben Jahres, begann ein bewaffneter Aufstand, der seit nunmehr sechs Jahren andauert. Der Konflikt hat allein zwischen dem Beginn des Aufstandes im Sommer 2003 und Juni 2006 etwa 2.000 Opfer unter den amerikanischen Soldaten gefordert und damit rund 16-mal so viele wie der eigentliche Krieg (vgl. Record 2007: 97). Trotz intensiver Bemühungen ist es den militärisch deutlich überlegenen US-Streitkräften bis zum heutigen Tag nicht gelungen, ihren vermeintlich schwachen und leicht zu besiegenden Gegner zu bezwingen. An dieser Stelle kommt die Frage auf, wie sich der Erfolg der irakischen Aufstandsbewegung in ihrem Kampf gegen die US-Truppen erklären lassen könnte. Der Konflikt im Irak ist nicht der erste Fall, in dem eine militärische Supermacht wie die Vereinigten Staaten in einem so genannten „asymmetrischen Konflikt“ massive Probleme hat, einen vermeintlich schwachen und leicht zu besiegenden Gegner zu bezwingen. So hat es beispielsweise in Vietnam (1946-1975), in Algerien (1954-1962) oder in Afghanistan (1979-1989) jeweils ein militärisch schwacher Akteur geschafft, sich gegen seinen überlegenen Gegner durchzusetzen und den Konflikt für sich zu entscheiden. Verschiedene Autoren haben sich vor diesem Hintergrund bereits mit dem Erfolg schwacher Akteure in asymmetrischen Konflikten beschäftigt und dabei mehrere Faktoren identifiziert, die diesen zu begünstigen scheinen. Im Hauptteil dieser Arbeit soll dementsprechend untersucht werden, welche dies sind und ob sie sich auch dafür eignen, den Erfolg der irakischen Aufstandsbewegung zu erklären.
Zuvor soll jedoch zum besseren Verständnis in einem ersten Schritt ein knapper Überblick über den Konflikt selber gegeben werden, um zu klären, wer die Aufständischen überhaupt sind und aus welchem Grund sie den bewaffneten Kampf gegen die US-Streitkräfte aufgenommen haben. Anschließend soll geklärt werden, ob es sich hier überhaupt um einen asymmetrischen Konflikt handelt und wenn ja, warum. Dazu wird untersucht, was einen solchen eigentlich ausmacht und inwiefern sich die zentralen Merkmale einer derartigen Auseinandersetzung auch im Falle des Irak erkennen lassen.
2. Der Aufstand im Irak – Akteure, Motive, Verlauf
Wie bereits angesprochen begann der bewaffnete Aufstand gegen die amerikanischen Truppen im Irak bereits kurze Zeit nachdem der ehemalige irakische Machthaber Saddam Hussein von einer multinationalen Streitmacht unter der Führung der Vereinigten Staaten gestürzt worden war. Zwar bestand in der irakischen Bevölkerung einerseits Erleichterung über den Sturz des Regimes, andererseits zweifelten viele Iraker am uneigennützigen Charakter der Intervention und unterstellten den Amerikanern ein hervorgehobenes Interesse an den irakischen Ölvorkommen. Nachdem die Vereinigten Staaten nach der Intervention aufgrund mangelnder Planung des Wiederaufbaus nicht, wie eingangs versprochen, dafür sorgten, die Sicherheitslage und die wirtschaftliche Situation im Land zu verbessern und Plünderungen zu verhindern, nahm die Ablehnung gegenüber den ausländischen Truppen, die zunehmend als „Besatzer“ und nicht als „Befreier“ wahrgenommen wurden, weiter zu (vgl. Hippler 2008: 258f). Hinzu kam die Tatsache, dass die von den USA eingesetzte Zivilverwaltung im Irak kurz nach Kriegsende den irakischen Sicherheitsapparat auflöste, sodass in der Folge hunderttausende ehemalige Soldaten und Polizeibeamte von einem auf den anderen Tag ohne sichere Einkommensquelle und damit ohne soziale Absicherung dastanden (vgl. Becker 2008: 23).
Viele von ihnen gehörten der Volksgruppe der Sunniten an, die, obwohl ihr Gesamtanteil an der irakischen Bevölkerung lediglich 20 Prozent beträgt, zur Zeit der Herrschaft Saddam Husseins die Machtbasis im Land gebildet hatten (vgl. Kramer 2008: 403). Diese befürchteten nun, in einem neuen, von der schiitischen Bevölkerungsmehrheit dominierten, Irak keinen Fuß mehr fassen zu können und viele sahen daher keinen Ausweg, als zu den Waffen zu greifen (vgl. Steinberg 2006: 26). Dementsprechend stellen ehemalige irakische Soldaten und andere Sicherheitskräfte das Gros der Aufständischen. Daneben sind aber auch andere Iraker, die sich aus „nationalistischen“ Motiven gegen die Präsenz der Amerikaner zur Wehr setzen, sowie etwa 5 bis 10 Prozent ausländische Kämpfer, die vorwiegend aus Syrien und Saudi-Arabien kommen und vorwiegend von religiösen Motiven geleitet werden, am Aufstand beteiligt. Der Widerstand ist dabei keinesfalls homogen organisiert, sondern es lässt sich vielmehr eine Vielzahl einzelner Gruppierungen (bis zu 35 verschiedene) ausmachen, die man wiederum unter zwei dominanten Strömungen unterordnen kann: Die National-Islamisten und die Jihadisten. Die bekanntesten und größten Gruppierungen sind Islamische Armee im Irak und die Bataillone der 1920er Revolution auf der Seite der National-Islamisten und die Ansar as-Sunna (oder Ansar al-Islam) und die al-Quaida im Irak auf der Seite der Jihadisten (vgl. Steinberg 2006: 8-13). Hinzu kommt die Tatsache, dass der Aufstand durch eine dezentrale, netzwerkartige Struktur gekennzeichnet ist. So sind die großen Gruppen nicht wirklich homogen, sondern bestehen aus kleinen, lokal agierenden Zellen, die teilweise nur wenige Personen umfassen und die nach den strategischen Vorgaben der Gruppe mehr oder weniger autonom handeln (vgl. Steinberg 2006: 20).
Die Ziele der einzelnen Gruppierungen weichen zudem durchaus voneinander ab. So haben die National-Islamisten in erster Linie die Vertreibung der ausländischen Interventionstruppen zum Ziel und wollen zudem die Entstehung eines irakischen Staates, in dem die Schiiten und säkulare Kurden die Macht innehaben, verhindern. Die Jihadisten hingegen versuchen darüber hinaus auch, einen konfessionellen Bürgerkrieg zwischen den verschiedenen Volksgruppen des Irak zu provozieren (vgl. Steinberg 2006: 7). Vor allem die al-Quaida im Irak bekämpft neben den amerikanischen Truppen im Prinzip jeden, der ihr radikales Verständnis des Islam nicht teilt, insbesondere die Schiiten, die von ihnen als Ketzer angesehen werden (vgl. Becker 2008: 28). Der Konflikt nahm dementsprechend seit 2005 zunehmend bürgerkriegsähnliche Züge an, da es nun auch vermehrt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Aufstandsgruppierungen kommt (vgl. Steinberg 2006: 7).
Obwohl diese Entwicklung sicherlich sehr wichtig ist, soll darauf im weiteren Verlauf nicht weiter eingegangen werden, da dies schlicht den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Der Fokus soll sich hier ausschließlich auf den bewaffneten Konflikt zwischen den US-Truppen und der Aufstandsbewegung richten. Diese kann man, auch wenn zwischen den einzelnen Gruppierungen zum Teil massive Differenzen bestehen, zumindest insofern als homogenen Akteur betrachten, als dass zumindest bei allen Beteiligten Einigkeit darüber herrscht, dass man der Präsenz amerikanischer Truppen im Irak ein Ende setzen will.
3. Warum es sich um einen asymmetrischen Konflikt handelt
Der Ausgangspunkt für die Analyse des Erfolges der irakischen Aufstandsbewegung bildet die Erkenntnis, dass es sich hierbei um einen so genannten „asymmetrischen Konflikt“ handelt. Bevor jedoch aufgezeigt werden kann, warum dies so ist, sollte zunächst einmal untersucht werden, was einen solchen überhaupt ausmacht.
Gerade in den letzten Jahren hat der Ausdruck des „asymmetrischen“ Krieges oder Konfliktes eine starke Prominenz in den Medien erfahren, ohne dass dem Adressaten immer konkret klar wird, was denn überhaupt darunter zu verstehen ist. In der Literatur finden sich, oft mit verschiedener Schwerpunktsetzung, zahlreiche Versuche, das Phänomen des asymmetrischen Konfliktes auf eine knappe Definition zu reduzieren. Obwohl sich diese durchaus deutlich voneinander unterscheiden, ist ihnen gemein, dass sich im Wesentlichen überall drei Kernkriterien asymmetrischer Konflikte erkennen lassen, die eng miteinander verknüpft sind.
Das erste besteht darin, dass zwischen den Akteuren eine Ungleichheit hinsichtlich ihrer militärischen Kapazitäten besteht. Vor allem in den Medien wird sich dabei häufig lediglich darauf bezogen, dass der eine Akteur seinem Gegner zahlenmäßig überlegen ist oder über modernere Waffensysteme verfügt – kurzum: stärker ist. Diese quantitative Ungleichheit taugt jedoch insofern nicht als alleiniges Definitionskriterium asymmetrischer Konflikte, als dass sich im Grunde genommen niemals Gegner gegenüberstehen, die über genau die gleichen militärischen Kapazitäten, also beispielsweise gleich viele oder gleich gute Panzer, verfügen. Viel entscheidender ist daher, dass die Ungleichheit zwischen den Akteuren qualitativer Natur ist. Qualität meint hier die Rekrutierung, Ausbildung und Ausrüstung der Soldaten, bezieht sich dabei jedoch nicht das Niveau, sondern allein auf die Art (vgl. Münkler 2004: 85). Das erste Definitionskriterium eines asymmetrischen Konfliktes ist also, um beim oben angeführten Beispiel zu bleiben, erst dann erfüllt, wenn eine der Konfliktparteien überhaupt keine Panzer hat. In den meisten Fällen ist ein Gegner dem anderen sowohl quantitativ als auch qualitativ überlegen, weshalb im Folgenden von einem militärisch starken und einem militärisch schwachen Akteur gesprochen werden soll, die sich in einem asymmetrischen Konflikt gegenüberstehen.
Das zweite Merkmal besteht in dem Einsatz asymmetrischer Mittel der Kriegsführung durch eine oder beide Konfliktparteien. Dies folgt unmittelbar aus der militärischen Ungleichheit der Akteure. So versucht eine Konfliktpartei, Mittel und Strategien der Kriegsführung einzusetzen, die der Gegner entweder nicht einsetzen kann oder nicht einsetzen will. In der Literatur wird sich dabei in der Regel ausschließlich auf die militärisch und waffentechnologisch unterlegene Seite bezogen, Herfried Münkler weist jedoch richtigerweise darauf hin, dass man zwischen Asymmetrien der Stärke und Asymmetrien der Schwäche unterscheiden muss (vgl. Münkler 2006: 140).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was macht den Irak-Konflikt zu einem asymmetrischen Konflikt?
Ein asymmetrischer Konflikt zeichnet sich durch qualitative und quantitative Ungleichheit der militärischen Kapazitäten sowie unterschiedliche Kampfweisen zwischen einer Supermacht und irregulären Kräften aus.
Wer sind die Hauptakteure des irakischen Aufstandes?
Der Widerstand besteht aus National-Islamisten (z. B. Islamische Armee im Irak) und Jihadisten (z. B. al-Qaida im Irak), ergänzt durch ehemalige Soldaten des Saddam-Regimes.
Welche Motive treiben die Aufständischen an?
Motive umfassen die Ablehnung der US-Besatzung, den Wunsch nach nationaler Souveränität, religiöse Ziele sowie die Angst der sunnitischen Minderheit vor politischer Marginalisierung.
Was sind die Erfolgsfaktoren für militärisch schwache Akteure?
Die Arbeit identifiziert den stärkeren Willen (Leidensfähigkeit), eine überlegene (oft dezentrale) Strategie und teilweise externe Unterstützung als zentrale Faktoren.
Wie ist die Struktur der Aufstandsbewegung organisiert?
Die Bewegung ist dezentral und netzwerkartig aufgebaut, bestehend aus vielen kleinen, autonom handelnden Zellen, was die Bekämpfung für konventionelle Truppen erschwert.
- Quote paper
- Christopher Schwarzkopf (Author), 2009, Der Erfolg militärisch schwacher Akteure in asymmetrischen Konflikten am Beispiel des Aufstandes im Irak, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138673