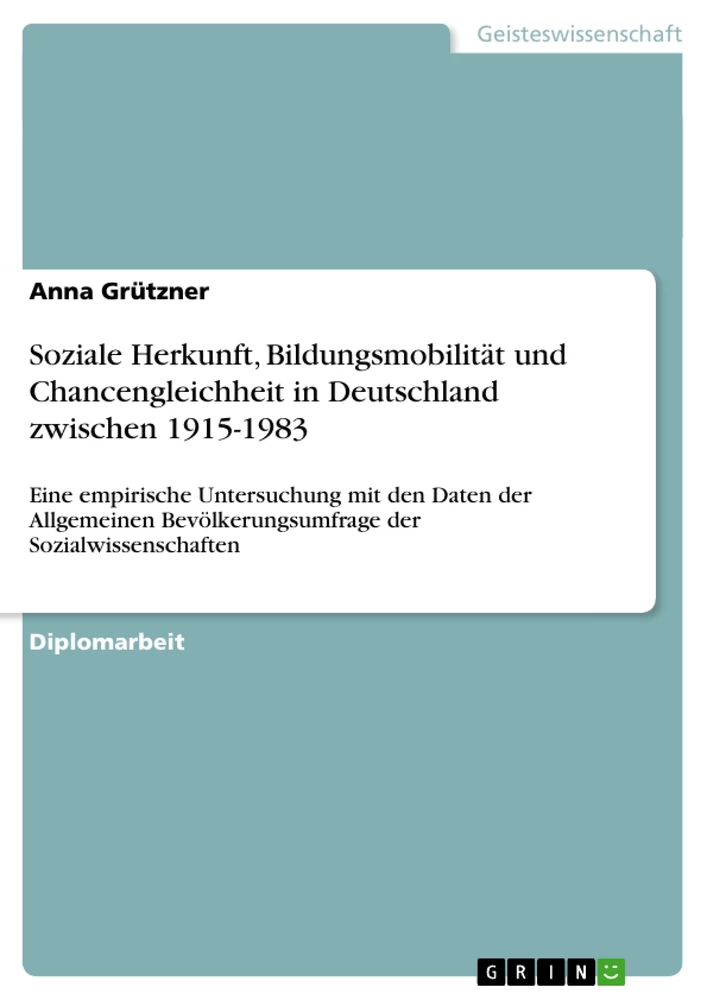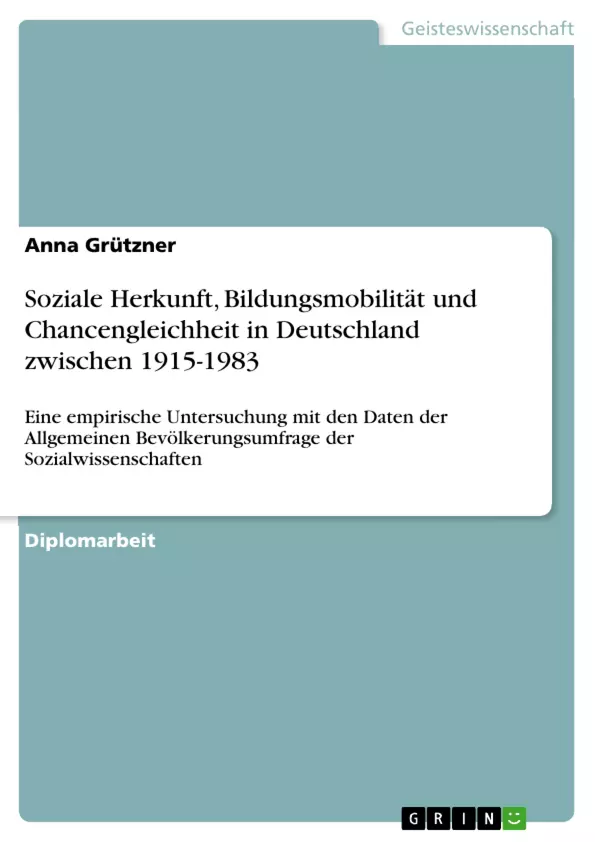Die Diplomarbeit untersucht mit den Daten der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften die Entwicklung der Bildungsmobilität in Deutschland über eine Abfolge von vier Geburtskohorten. Augenmerk liegt auf dem Ausmaß der Auf- und Abstiege bzw. der Statusreproduktion zwischen Eltern und Kindern im allgemeinbildenden Schulsystem. Ziel ist somit, Prozesse intergenerationaler Bildungsmobilität über einen längeren Zeitraum zu beschreiben und aufzuzeigen, wie sich Bildungs- und Aufstiegschancen der verschiedenen Bildungsgruppen entwickelt haben.
Bezug nehmend auf die theoretischen Vorüberlegungen zur Bildungsvererbung innerhalb familiärer Strukturen und den sich veränderten strukturellen Rahmenbedingungen (Bildungsexpansion, sozialstrukturelle und demographische Veränderungen) werden zwei Thesen abgeleitet, die sich auf die Gesamtperspektive und auf einzelne definierte Bildungsgruppen beziehen. Die Hypothesen werden anhand der sekundäranalytischen Daten überprüft.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Fragestellung
- 1.1 Fragestellung und Zielsetzung
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2 Empirischer Forschungsstand zur Bildungsungleichheit und Bildungsmobilität
- 3 Theoretischer Hintergrund und Hypothesen
- 3.1 Die Bedeutung kultureller Kapitalien
- 3.1.1 Zum Zusammenhang von Elternhaus und Schulerfolg: Ursächliche Mechanismen der Bildungsvererbung
- 3.1.2 Schichtspezifische Sozialisation in der Familie
- 3.1.3 Bildungsverläufe als Ergebnis rationaler Entscheidungsprozesse
- 3.1.4 Leistungsunabhängige Selektion durch die Schule
- 3.1.5 Geschlechtsspezifische Unterschiede der Bildungsvererbung
- 3.2 Entwicklungen und Rahmenbedingungen auf der Makroebene
- 3.2.1 Struktur und institutioneller Wandel des deutschen Bildungssystems
- 3.2.2 Die Expansion der Bildungsbeteiligung
- 3.2.3 Wirtschafts- und sozialstruktureller Wandel
- 3.2.4 Demographische Entwicklung und Schulangebot
- 3.3 Hypothesen zur Entwicklung der Bildungsmobilität und Chancengleichheit
- 4 Daten und Untersuchungsansatz
- 4.1 Datengrundlage
- 4.2 Gewichtung der Datensätze
- 4.3 Der Kohortenansatz
- 4.4 Population, Variablen und Stichprobenumfang
- 4.5 Methoden und Maßzahlen
- 5 Analyse und Ergebnisse
- 5.1 Verteilung der Schulabschlüsse
- 5.1.1 Schulbildungsstand der Befragten
- 5.1.2 Schulbildungsstand der Eltern
- 5.2 Intergenerationale Bildungsmobilität in (West-)Deutschland zwischen 1915 und 1983
- 5.2.1 Veränderung in den Bildungsabständen zwischen Eltern und Kindern
- 5.2.2 Darstellung der Gesamtmobilität
- 5.2.3 Mobilitätschancen, Durchlässigkeit und Zugangsbarrieren
- 5.2.4 Analyse der Offenheit der westdeutschen Gesellschaft: Wie entwickeln sich die relativen Chancen zum Bildungsaufstieg?
- 6 Diskussion
- 6.1 Zusammenfassung
- 6.2 Interpretation der Ergebnisse
- 6.3 Weitere Forschungsfragen
- 6.4 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die soziale Herkunft, Bildungsmobilität und Chancengleichheit in Deutschland zwischen 1915 und 1983. Ziel ist es, die Entwicklung der Bildungsmobilität über verschiedene Kohorten hinweg zu analysieren und Einflussfaktoren zu identifizieren. Die Untersuchung basiert auf Daten der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften.
- Intergenerationale Bildungsmobilität in Deutschland
- Einflussfaktoren der Bildungsvererbung (kulturelles Kapital, Sozialisation, etc.)
- Wandel des deutschen Bildungssystems und seine Auswirkungen auf die Bildungsmobilität
- Chancengleichheit im Bildungssystem
- Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Bildungsmobilität
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung und Fragestellung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der sozialen Herkunft, Bildungsmobilität und Chancengleichheit in Deutschland ein und formuliert die Forschungsfrage der Arbeit. Es beschreibt den Aufbau der Arbeit und die methodische Vorgehensweise.
2 Empirischer Forschungsstand zur Bildungsungleichheit und Bildungsmobilität: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den bestehenden Forschungsstand zur Bildungsungleichheit und Bildungsmobilität. Es werden relevante Studien und Theorien vorgestellt, die den theoretischen Rahmen der Arbeit bilden.
3 Theoretischer Hintergrund und Hypothesen: In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Arbeit dargelegt. Es werden zentrale Konzepte wie kulturelles Kapital, Sozialisation und rationale Entscheidungsprozesse im Kontext von Bildungsverläufen diskutiert und Hypothesen für die empirische Untersuchung formuliert. Der Einfluss von Makrofaktoren wie dem Wandel des Bildungssystems und der Wirtschaftsstruktur wird ebenfalls betrachtet.
4 Daten und Untersuchungsansatz: Dieses Kapitel beschreibt die verwendeten Daten der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften, ihre Gewichtung und den Kohortenansatz. Es erläutert die Auswahl der Variablen, den Stichprobenumfang und die angewendeten Methoden der Datenanalyse.
5 Analyse und Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Analyse. Es werden die Verteilung der Schulabschlüsse, die intergenerationale Bildungsmobilität und die Entwicklung der Mobilitätschancen in Westdeutschland zwischen 1915 und 1983 untersucht. Geschlechtsspezifische Unterschiede werden ebenfalls berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Soziale Herkunft, Bildungsmobilität, Chancengleichheit, Bildungsungleichheit, Deutschland, Intergenerationale Mobilität, Kulturelles Kapital, Sozialisation, Bildungssystem, Kohortenanalyse, Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Soziale Herkunft, Bildungsmobilität und Chancengleichheit in Deutschland (1915-1983)
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Die Studie untersucht die Entwicklung der sozialen Herkunft, Bildungsmobilität und Chancengleichheit in Deutschland zwischen 1915 und 1983. Im Fokus steht die Analyse der intergenerationellen Bildungsmobilität über verschiedene Kohorten hinweg und die Identifizierung relevanter Einflussfaktoren.
Welche Daten werden verwendet?
Die Analyse basiert auf Daten der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften. Die Daten werden gewichtet und mittels eines Kohortenansatzes ausgewertet.
Welche methodischen Ansätze werden angewendet?
Die Studie verwendet einen Kohortenansatz und analysiert die Daten mit geeigneten Methoden und Maßzahlen, die im Kapitel 4 detailliert beschrieben werden. Die Analyse umfasst die Verteilung von Schulabschlüssen, die intergenerationale Bildungsmobilität und die Entwicklung von Mobilitätschancen.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Studie behandelt folgende zentrale Themen: Intergenerationale Bildungsmobilität in Deutschland, Einflussfaktoren der Bildungsvererbung (kulturelles Kapital, Sozialisation etc.), Wandel des deutschen Bildungssystems und dessen Auswirkungen auf die Bildungsmobilität, Chancengleichheit im Bildungssystem und geschlechtsspezifische Unterschiede in der Bildungsmobilität.
Welche Einflussfaktoren auf die Bildungsmobilität werden untersucht?
Die Studie untersucht den Einfluss verschiedener Faktoren auf die Bildungsmobilität, darunter kulturelles Kapital, schichtspezifische Sozialisation in der Familie, rationale Entscheidungsprozesse bei der Bildungsauswahl, leistungsunabhängige Selektion durch die Schule und geschlechtsspezifische Unterschiede. Zusätzlich werden makro-soziale Faktoren wie der Wandel des Bildungssystems und die Wirtschafts- und Sozialstruktur berücksichtigt.
Welche Zeiträume werden untersucht?
Die Studie analysiert die Entwicklung der Bildungsmobilität in Deutschland zwischen den Jahren 1915 und 1983.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse umfassen die Verteilung von Schulabschlüssen bei den Befragten und ihren Eltern, die Analyse der intergenerationellen Bildungsmobilität, die Entwicklung der Mobilitätschancen in Westdeutschland im Untersuchungszeitraum und die Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Unterschiede.
Wie ist die Studie aufgebaut?
Die Studie ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung und Fragestellung, Empirischer Forschungsstand, Theoretischer Hintergrund und Hypothesen, Daten und Untersuchungsansatz, Analyse und Ergebnisse sowie Diskussion. Die Kapitelzusammenfassungen finden sich im bereitgestellten Dokument.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Soziale Herkunft, Bildungsmobilität, Chancengleichheit, Bildungsungleichheit, Deutschland, Intergenerationale Mobilität, Kulturelles Kapital, Sozialisation, Bildungssystem, Kohortenanalyse, Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften.
Wo finde ich weitere Informationen?
Detaillierte Informationen finden Sie im vollständigen Studienbericht, der das Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung, die Kapitelzusammenfassungen und die Schlüsselwörter enthält.
- Quote paper
- Diplom- Sozialwissenschaftlerin Anna Grützner (Author), 2008, Soziale Herkunft, Bildungsmobilität und Chancengleichheit in Deutschland zwischen 1915-1983, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138733