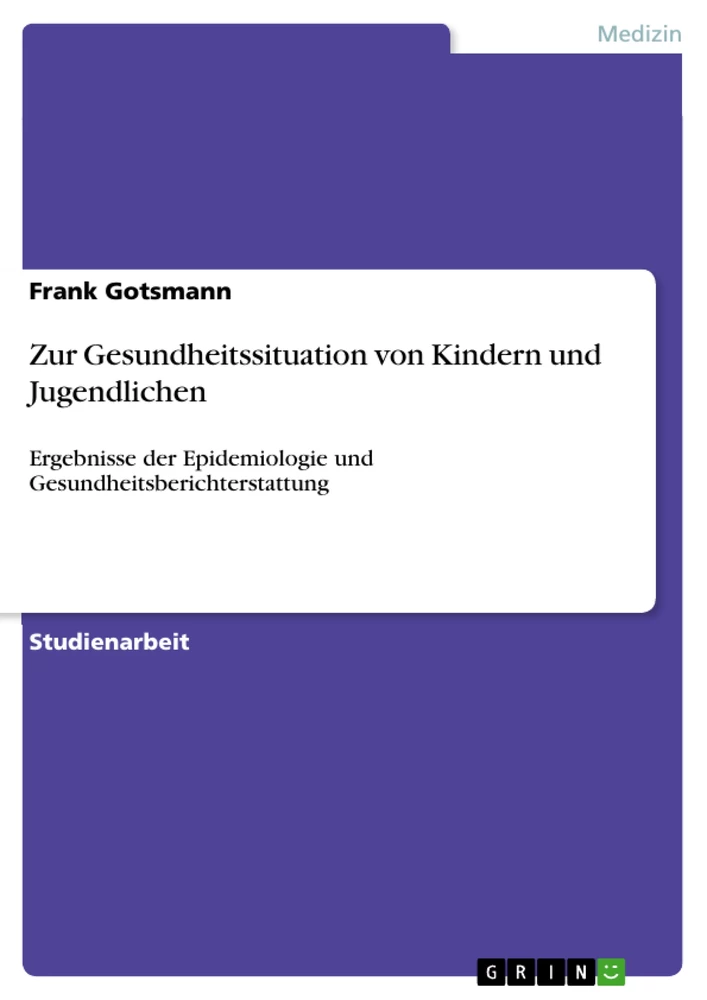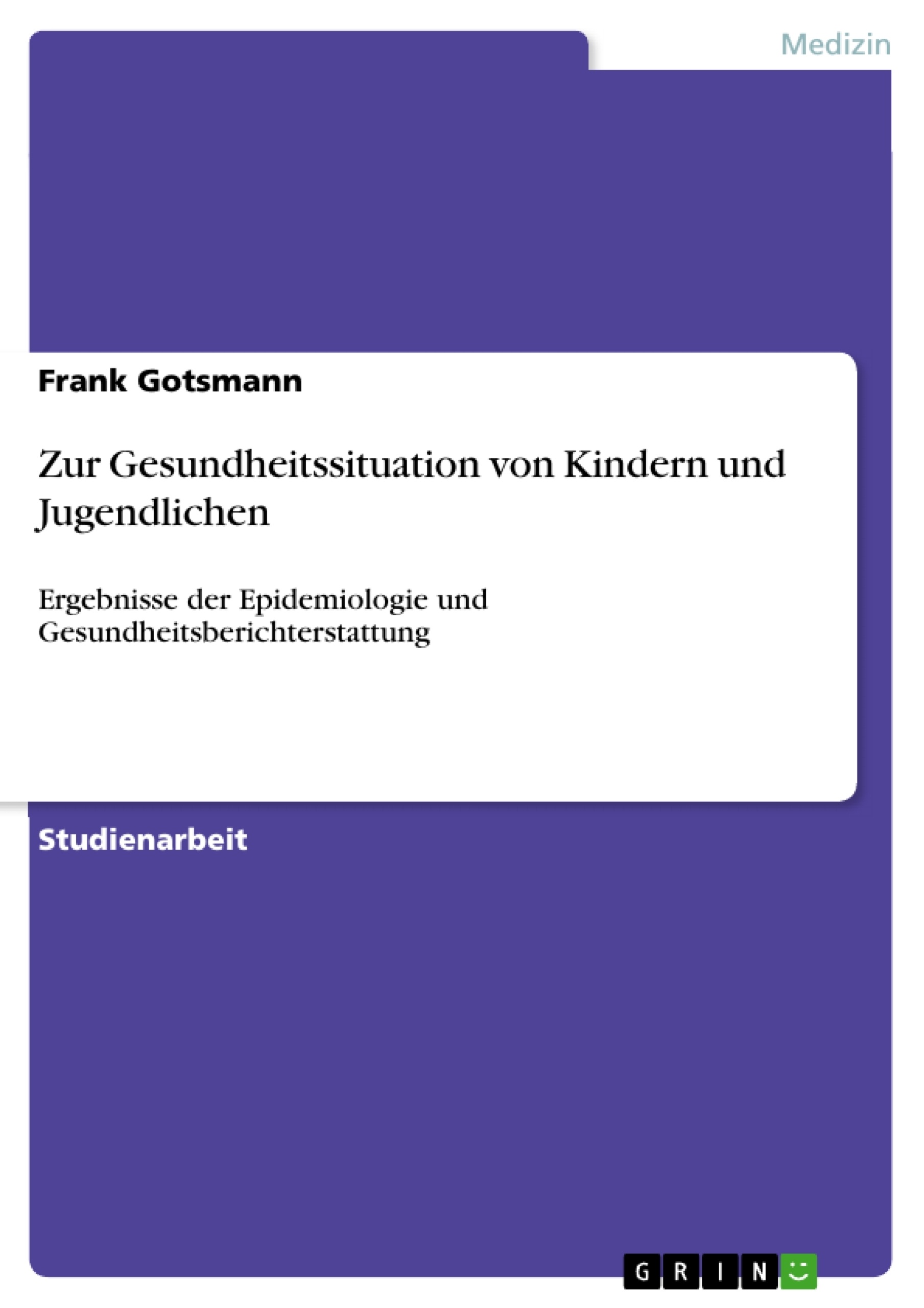In der Bundesrepublik Deutschland gehört das Sozialstaatsprinzip zur Grundlage der Verfassungsordnung. Im Grundgesetz heißt es: "Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat" (Art. 20 Absatz 1 GG). Folglich ist Deutschland ein Sozialstaat.
Aber was genau bedeutet Sozialstaat eigentlich? Das Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland beschreibt den Sozialstaat wie folgt: "Sozialstaat bezeichnet zugleich die Ausrichtung staatlichen Handelns auf die Herstellung sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit, auf die Sicherung eines sozialen Existenzminimums für alle sowie die Milderung der ökonomischen Ungleichverteilung und der sozialen (Klassen-, Schichten-, Gruppen-) Gegensätze" (Nullmeier 2003: 568-569).
Dieses Ziel hat Deutschland bislang nicht erreicht. Ganz im Gegenteil, die Schere zwischen Reichen und Armen geht immer weiter auseinander.
Die ökonomische Ungleichverteilung macht sich in Deutschland vor allem bei den Kindern und Jugendlichen bemerkbar. „Kinder und Jugendliche stellen in Deutschland mittlerweile diejenige Altersgruppe dar, die am häufigsten von Armut bedroht ist“ (Klocke/ Lampert 2005: Abstract).
Wie Tabelle 1 zeigt, leben Kinder und Jugendliche überproportional häufig in Haushalten, die einem Armutsrisiko ausgesetzt sind. (vgl. Klocke/ Lampert 2005: 9). Inwieweit diese soziale Ungleichheit Einfluss auf den Gesundheitszustand der Kinder und Jugendlichen hat, soll die vorliegende Arbeit näher beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
1 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
2 Abgrenzung der Themenstellung
3 Epidemiologie
3.1 Definition der Epidemiologie
3.2 Abgrenzung und Aufgaben der Sozial -Epidemiologie
3.3 Anwendungsgebiete der Epidemiologie
3.3.1 Deskriptive Epidemiologie
3.3.2 Analytische Epidemiologie
4 Gesundheitsberichterstattung (GBE)
4.1 Aufgaben der GBE
4.2 Bedeutung der Epidemiologie für die GBE
5 Soziale und gesundheitliche Ungleichheit
5.1 Gesundheitliche Ungleichheit
5.2 Soziale Ungleichheit
5.3 Zusammenhang zwischen sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit
6 Armut von Kindern und Jugendlichen in Deutschland
6.1 Mortalität
6.2 Morbidität
6.2.1 Zahn- und Mundhygiene
6.2.2 Subjektive Gesundheit und Beschwerden
6.2.3 Umwelt und Unfallgefahren
6.3 Gesundheitsverhalten
6.3.1 Bildung
6.3.2 Alkohol und Zigaretten
6.3.3 Ernährung
7 Fazit
8 Quellenverzeichnis
1 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2 Abgrenzung der Themenstellung
In der Bundesrepublik Deutschland gehört das Sozialstaatsprinzip zur Grundlage der Verfassungsordnung. Im Grundgesetz heißt es: "Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundes-staat" (Art. 20 Absatz 1 GG). Folglich ist Deutschland ein Sozialstaat. Aber was genau bedeutet Sozialstaat eigentlich? Das Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland beschreibt den Sozialstaat wie folgt: "Sozialstaat bezeichnet zugleich die Ausrichtung staatlichen Handelns auf die Herstellung sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit, auf die Sicherung eines sozialen Existenzminimums für alle sowie die Milderung der ökonomischen Ungleichverteilung und der sozialen (Klassen-, Schichten-, Gruppen-) Gegensätze" (Nullmeier 2003: 568-569).
[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] a Berechnet nach den Regelsatzproportionen der neuen OECD-Skala b Schwellenwert zur Abgrenzung des Armutsrisikos bei 60% des mittleren
Nettoäquivalenzeinkommen (Median)
Tabelle 1: Armutsrisiko nach Altersgruppen 1992 - 2002. Quelle: (Sozio-oekonomisches Panel (SOEP) zitiert nach Klocke/ Lampert 2005: 9).
Dieses Ziel hat Deutschland bislang nicht erreicht. Ganz im Gegenteil, die Schere zwischen Reichen und Armen geht immer weiter auseinander. Die ökonomische Ungleichverteilung macht sich in Deutschland vor allem bei den Kindern und Jugendlichen bemerkbar. „Kinder und Jugendliche stellen in Deutschland mittlerweile diejenige Altersgruppe dar, die am häufigsten von Armut bedroht ist“ (Klocke/ Lampert 2005: Abstract). Wie Tabelle 1 zeigt, leben Kinder und Jugendliche überproportional häufig in Haushalten, die einem Armutsrisiko ausgesetzt sind. (vgl. Klocke/ Lampert 2005: 9). Inwieweit diese soziale Ungleichheit Einfluss auf den Gesundheitszustand der Kinder und Jugendlichen hat, soll die vorliegende Arbeit näher beleuchten.
3 Epidemiologie
Im folgendem wird die Epidemiologie als „eines der wichtigsten ´Handwerkszeuge´ der Gesundheitswissenschaften .. „ näher erklärt (Brand et al. 2006: 256). Außerdem wird die Bedeutung der Epidemiologie für die Gesundheitsberichterstattung aufgezeigt.
3.1 Definition der Epidemiologie
Wörtlich übersetzt bedeutet Epidemiologie: „... die Lehre davon, ´was auf dem Volk liegt´“ (Kuhn 2004: 4). Die klassische internationale Definition von Epidemiologie, die sich in den meisten Lehrbüchern findet lautet: „The study of the occurrence and distribution of health-related states or events in specified populations, including the study of the determinants influencing such states, and the application of this knowledge to control health problems“ (Porta 2008: 81). Diese klassische Definition entspricht nicht mehr den modernen Anforderungen an epidemiologische Forschung, weil sie sich zu stark auf die medizinische Profession fokussiert. Mittlerweile bedienen sich auch andere wissenschaftliche Disziplinen epidemiologischer Forschung. Eine moderne Formulierung kann wie folgt lauten: „Epidemiologie ist die Bearbeitung von Fragen aus dem Bereich der Medizin, der Gesundheitssystemforschung und der Gesundheits-wissenschaften mit Methoden der empirischen Sozialforschung und der Statistik“ (Brand et al. 2006: 257). „Die moderne Sozial-Epidemiologie ist in steigendem Maße auf die Verwendung sozialwissenschaftlicher Methoden und Instrumente angewiesen“ (Atteslander 2001: 264).
3.2 Abgrenzung und Aufgaben der Sozial-Epidemiologie
Für die klassische Epidemiologie „... lassen sich die wichtigsten Ziele und Inhalte epidemiologischer Forschung [wie folgt] formulieren:
− Identifikation von Risikofaktoren und Ursachen von Krankheiten (Krankheitsätiologie) bzw. Identifikation von gesundheitsförderlichen (salutogenen) Faktoren
− Erklärung von geographischen/ regionalen Unterschieden und von zeit-lichen Veränderungen in der Häufigkeit bestimmter Erkrankungen
− Beschreibung des natürlichen Verlaufs (Spontanverlaufes) von Erkrankungen
− Beurteilung der Wirksamkeit und der Effizienz von medikamentöser Therapie, Präventionsmaßnahmen und medizinischen, rehabilitativen und psychosozialen Versorgungsmaßnahmen.“ (Stark/ Guggenmoos-Holzmann (†) 2003: 394)
„Die Sozialepidemiologie verbindet Fragestellungen und Methoden der medizinischen Forschung (insbesondere der Epidemiologie) mit sozialen Aspekten von Krankheit und Gesundheit“ (Schneider 2009).
„Die moderne Sozial-Epidemiologie unterscheidet sich grundsätzlich von der klassischen Seuchenlehre“ (Atteslander 2001: 264). Wie bereits erwähnt, hat sich in der modernen Sozial-Epidemiologie ein Paradigmenwechsel vollzogen und salutogenetische Fragestellungen treten in den Vordergrund.
[...]
- Citar trabajo
- Frank Gotsmann (Autor), 2009, Zur Gesundheitssituation von Kindern und Jugendlichen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138851