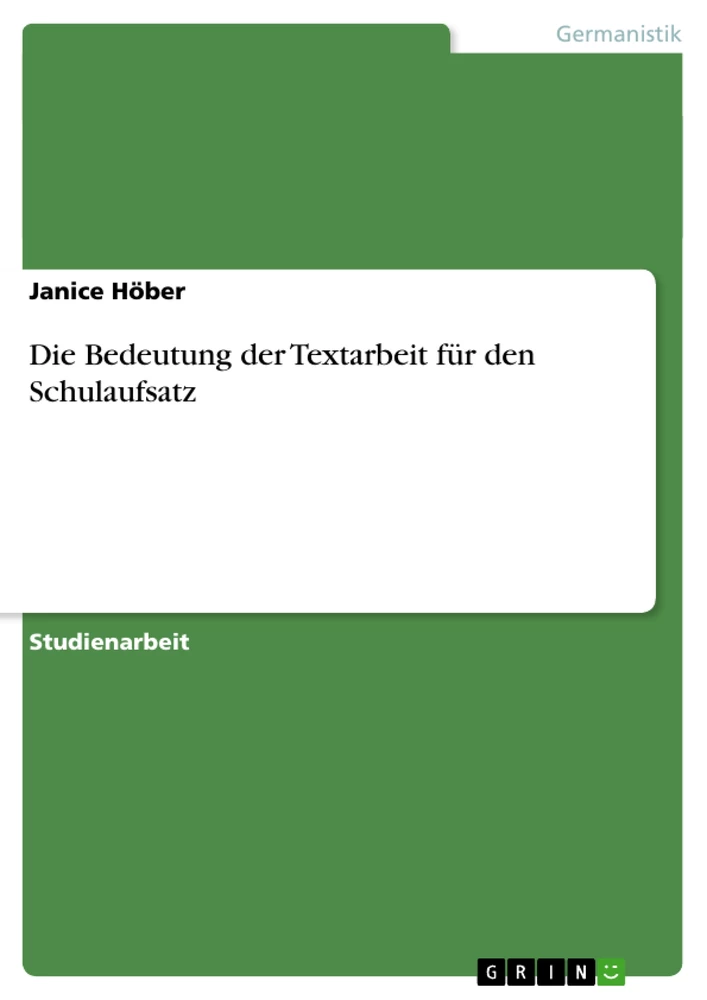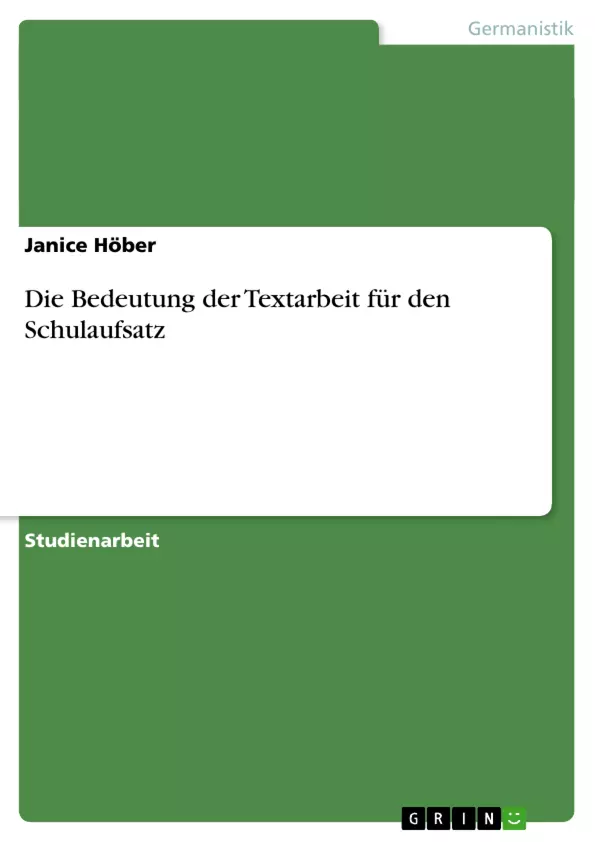„Lesefähigkeit und Textverstehen (Lesekompetenz) sowie präzises Ausdrucksvermögen sind grundlegend für alle Fächer. Alle Fächer arbeiten mit Texten, alle Fächer arbeiten im Medium der Sprache.“ (EPA 2002, 4) Doch kein Fach rückt die Auseinandersetzung so sehr in den Mittelpunkt wie das Fach Deutsch, so dass ihm eine elementare Aufgabe zugesprochen wird.
Die grundlegenden Anforderungen, die an das Fach Deutsch gestellt werden, bestehen darin, die sprachliche Ausdrucksfähigkeit und hier vor allem die schriftliche Darlegung eines Gedankenganges zu fördern. Darüber hinaus sollen die Schülerinnen und Schüler dazu befähigt werden, „sich strukturiert, zielgerichtet und sprachlich korrekt schriftlich zu artikulieren und die erforderlichen Schreibformen und -techniken zu beherrschen“. (EPA 2002, 3) Dazu gehört auch der angemessene Umgang mit literarischen und pragmatischen Texten sowie die Fähigkeit, diese zu verstehen und für sich zu erschließen, um komplexe Zusammenhänge sowohl mündlich als auch schriftlich darlegen zu können. (vgl. EPA 2002, 3)
Die Ergebnisse der PISA-Studie 2000 haben jedoch gezeigt, dass die deutschen Schülerinnen und Schüler im Bereich Lesen erhebliche Defizite haben, so dass die formulierten Anforderungen der EPA unrealistisch erscheinen.
Für so manche Lehrer sind die PISA-Ergebnisse keine Überraschung, sondern lediglich eine Bestätigung ihrer Beobachtungen, wonach ein großer Teil der deutschen Schülerinnen und Schüler nicht einmal mehr in der Lage ist, einen Text zu lesen und die Grundgedanken mit eigenen Worten zusammenzufassen, geschweige denn, grundlegende Methoden des Textverstehens und entsprechende Arbeitstechniken zu beherrschen und anzuwenden. Letzteres wird von der vorliegenden Arbeit jedoch als Grundvoraussetzung für das effektive und erfolgreiche Lernen angesehen, was es im analytischen Teil zu bestätigen bzw. zu entkräften gilt. Mit Hilfe von Schüleraufsätzen soll herausgearbeitet werden, welche Auswirkungen die Textarbeit auf den sich anschließenden Schreibprozess hat.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Hinführung zum Thema
1.2 Abgrenzung des Themas
1.3 Gang der Untersuchung
2. Der Begriff Lesekompetenz
2.1 Der Begriff Lesekompetenz bei PISA
2.1.1 Der internationale Lesekompetenztest
2.2 Der Begriff Lesekompetenz bei Groeben & Hurrelmann
2.2.1 Deskriptive Merkmale von Lesekompetenz
2.2.1.1 Kognitionen
2.2.1.2 Motivationen und Emotionen
2.2.1.3 Reflexionen und Anschlusskommunikationen
2.2.2 Einflussfaktoren und Bedingungen der Lesekompetenz
2.2.2.1 Personale Einflussfaktoren
2.2.2.2 Soziale Bedingungen
2.2.2.3 Text- und medienseitige Einflussfaktoren
2.2.3 Historisch-normative Rahmenbedingungen der Lesekompetenz
3. Lesestrategien und Arbeitstechniken
3.1 Die SQ3R-Technik nach F. P. Robinson
3.2 Methoden der Zusammenfassung von Texten
3.2.1 Das Unterstreichen
3.2.2 Das Formulieren von Randbemerkungen
3.2.3 Das Exzerpieren
4. Die Bedeutung der Textarbeit für den Schulaufsatz
4.1 Die Textarbeit in Abhängigkeit vom Geschlecht
4.2 Der Umgang mit der Textvorlage
4.3 Die Bedeutung der Textarbeit für den Schulaufsatz
4.4 Das Erlernen von Textarbeit
5. Schlussbetrachtung
6. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Hinführung zum Thema
„Lesefähigkeit und Textverstehen (Lesekompetenz) sowie präzises Ausdrucksvermögen sind grundlegend für alle Fächer. Alle Fächer arbeiten mit Texten, alle Fächer arbeiten im Medium der Sprache.“ (EPA 2002, 4) Doch kein Fach rückt die Auseinandersetzung so sehr in den Mittelpunkt wie das Fach Deutsch, so dass ihm eine elementare Aufgabe zugesprochen wird.
„Durch die Vermittlung fachlicher Inhalte und Methoden sowie durch den Bezug zur Lebenswelt leistet das Fach einen wesentlichen Beitrag zum Erwerb von Grundfertigkeiten für Studium und Beruf. Das Fach soll zugleich Schülerinnen und Schüler zur aktiven Teilnahme am kulturellen Leben befähigen und zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung beitragen.“ (EPA 2002, 3)
Die grundlegenden Anforderungen, die an das Fach Deutsch gestellt werden, bestehen darin, die sprachliche Ausdrucksfähigkeit und hier vor allem die schriftliche Darlegung eines Gedankenganges zu fördern. Darüber hinaus sollen die Schülerinnen und Schüler dazu befähigt werden, „sich strukturiert, zielgerichtet und sprachlich korrekt schriftlich zu artikulieren und die erforderlichen Schreibformen und -techniken zu beherrschen“. (EPA 2002, 3) Dazu gehört auch der angemessene Umgang mit literarischen und pragmatischen Texten sowie die Fähigkeit, diese zu verstehen und für sich zu erschließen, um komplexe Zusammenhänge sowohl mündlich als auch schriftlich darlegen zu können. (vgl. EPA 2002, 3)
Die Ergebnisse der PISA-Studie 2000 haben jedoch gezeigt, dass die deutschen Schülerinnen und Schüler im Bereich Lesen erhebliche Defizite haben, so dass die formulierten Anforderungen der EPA unrealistisch erscheinen. Gemessen an den Mittelwerten liegen die erbrachten Leistungen im unteren Bereich des Feldes der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Die besten Ergebnisse der deutschen Jugendlichen entsprechen den Leistungen der durchschnittlichen Spitzengruppe der Mitgliedsstaaten der OECD. Die leistungsschwächsten 15-Jährigen haben noch größere Schwierigkeiten im Lesen als die entsprechende Vergleichsgruppe in vielen anderen Ländern und auch die Anzahl derjenigen, die sehr schlechte Leistungen erbringen, ist erheblich hoch.
Für so manche Lehrer sind die PISA-Ergebnisse keine Überraschung, sondern lediglich eine Bestätigung ihrer Beobachtungen, wonach ein großer Teil der deutschen Schülerinnen und Schüler nicht einmal mehr in der Lage ist, einen Text zu lesen und die Grundgedanken mit eigenen Worten zusammenzufassen, geschweige denn, grundlegende Methoden des Textverstehens und entsprechende Arbeitstechniken zu beherrschen und anzuwenden. Letzteres wird von der vorliegenden Arbeit jedoch als Grundvoraussetzung für das effektive und erfolgreiche Lernen angesehen, was es im analytischen Teil zu bestätigen bzw. zu entkräften gilt. Mit Hilfe von Schüleraufsätzen soll herausgearbeitet werden, welche Auswirkungen die Textarbeit auf den sich anschließenden Schreibprozess hat.
1.2 Abgrenzung des Themas
Die vorliegende Arbeit lässt sich in zwei Schwerpunkte gliedern. Der theoretische Teil setzt sich unter Punkt 2 zunächst mit dem Begriff der Lesekompetenz auseinander, wobei die Definition nach PISA 2000 dem umfassenden Konzept von Groeben und Hurrelmann gegenübersteht. Im Anschluss daran wird Punkt 3.1 kurz auf eine der bekanntesten Lesestrategien eingehen, ehe Punkt 3.2 die drei wesentlichsten Methoden der Textzusammenfassung erläutert.
Der analytische Teil stellt die Auswertung der Schüleraufsätze der Klassenstufe 11 und 13 in den Mittelpunkt, anhand derer die Bedeutung der Textarbeit für das Schreiben eines Aufsatzes untersucht werden soll. In diesem Zusammenhang wird sich Punkt 4.1 zunächst mit der Frage beschäftigen, inwieweit die Auseinandersetzung mit dem schriftlichen Material vom Geschlecht abhängt, ehe der folgende Abschnitt den Umgang mit der Textvorlage beschreibt. Unter Berücksichtigung dessen untersucht Punkt 4.3 die zentralen Klausuren, unter Abiturbedingungen geschrieben, um am Ende die Annahme über einen bestehenden Zusammenhang zwischen Textarbeit und Schreibprozess bestärken oder entkräften zu können. Unter diesem Gesichtspunkt wird sich der letzte Abschnitt den Klausuren zuwenden, die die selben Schüler in Klasse 11 geschrieben haben. Dabei dient die Untersuchung in erster Linie der Feststellung, ob und inwieweit es eine Veränderung im Umgang mit der Textvorlage gegeben hat.
1.3 Gang der Untersuchung
Um im analytischen Teil im Hinblick auf den Themenschwerpunkt Aussagen treffen zu können, wurden Aufsätze der Klassenstufen 11 und 13 herangezogen und in Abhängigkeit der jeweiligen Fragestellung entsprechend untersucht. Für die Bearbeitung des Gliederungspunktes 4.1 standen insgesamt 212 Klausuren von 13-Klässlern zur Verfügung. 131 Aufsätze wurden von Schülerinnen und folglich 81 von Schülern verfasst. Zur Beantwortung der in den Punkten 4.3 und 4.4 formulierten Fragen wurden sieben Klausuren von Schülern ausgewählt, die seit der 11. Klasse durchgängig bei ein und derselben Lehrerin Unterrichtet hatten. Da für die vorliegende Arbeit nur begrenzt archiviertes Material zur Verfügung stand, konnte kein Einfluss auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Schülern ausgeübt werden.
2. Der Begriff Lesekompetenz
2.1 Der Begriff Lesekompetenz bei PISA
Im ersten Zyklus der PISA-Studie stand die Erfassung sowie der Vergleich der Lesekompetenz (Reading Literacy) 15-jähriger Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt. Die Fähigkeit, Texte lesen und decodieren zu können, wird von dieser Altersgruppe erwartet, doch der internationalen Rahmenkonzeption zufolge, bedeutet Lesekompetenz nicht nur, Informationen aus Texten entnehmen zu können. Die OECD definiert den zu klärenden Begriff vielmehr als die Fähigkeit, „geschriebene Texte zu verstehen, zu nutzen und über sie zu reflektieren, um eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen und Potenzial weiterzuentwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.“ (zit. n. Artelt u.a. 2001, 80)
Zur Erfassung der Lesekompetenz wurden zwei Testkonzeptionen entwickelt. Während sich der nationale Teil auf den Untersuchungsschwerpunkt ‘Lernen aus Texten’ konzentriert, rückt der internationale Test den verstehenden Umgang in den Mittelpunkt. Im ersten Fall stand den Mädchen und Jungen der Text, auf denen sich die zu bearbeitenden Aufgaben bezogen, nicht zur Verfügung, wohingegen sie im zweiten Fall ständig Einsicht in das schriftliche Material nehmen konnten. (vgl. Artelt u.a. 2001, 79) Im Folgenden soll lediglich auf den internationalen Lesekompetenztest eingegangen werden, da dieser im Hinblick auf den Themenschwerpunkt der vorliegenden Arbeit bedeutsamer erscheint.
2.1.1 Der internationale Lesekompetenztest
Das Ziel der Testkonstruktion bestand darin, die verschiedensten Anlässe für Leseaktivitäten zu berücksichtigen. Aufgrund dessen wurde zunächst eine Vielzahl an unterschiedlichen Textsorten und Lesesituationen ausgewählt. Während sich bisherige Studien lediglich auf fortlaufend geschriebene, so genannte kontinuierliche Texte, wie zum Beispiel Erzählungen, Sachbeschreibungen, Kommentare oder Argumentationen, beschränkt haben, bezog PISA auch nicht fortlaufende bzw. diskontinuierliche Texte, wie Diagramme, Bilder, Karten, Tabellen oder Graphiken, in den Test mit ein. Dies lässt sich damit begründen, dass Jugendliche und Erwachsene in ihrem privaten oder beruflichen Alltag sowie im öffentlichen Leben mit unterschiedlichen Textsorten konfrontiert werden. Dementsprechend wurden Texte ausgewählt, die im Hinblick auf die Vielzahl an Lesesituationen konzipiert wurden, denn es gilt zu unterscheiden, „ob das Lesen eines bestimmten Textes [...] dem privaten (z.B. Auszüge aus Erzählungen) oder öffentlichen Zweck (z.B. amtliche Dokumente), der beruflichen Weiterqualifikation (z.B. Lehrbücher) oder dem allgemeinen Bildungsinteresse (z.B. Sachbücher) dient.“ (Artelt u.a. 2001, 81)
Des Weiteren wurden genaue Antwortformate und Auswertungsrichtlinien definiert. Während die Antwortformate vorgeben, in welcher Form die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen zu der jeweiligen Aufgabe nachweisen sollen, legen die Auswertungsrichtlinien fest, wie die Antworten zu bewerten sind. Testaufgaben, die von den 15-Jährigen verlangen, aus den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten die richtige auszuwählen, lassen sich schnell auswerten, wohingegen offene Antwortformate detaillierte Bewertungskriterien erforderlich machen. (vgl. Artelt u.a. 2001, 81)
Den eigentlichen Kern der internationalen Rahmenkonzeption bilden jedoch die theoretischen Annahmen zur Struktur der Lesekompetenz, wonach textimmanente und wissensbasierte Verstehensleistungen voneinander abgegrenzt und jeweils noch einmal genauer differenziert werden (vgl. Abb. 1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Theoretische Struktur der Lesekompetenz in PISA
(aus: Deutsches PISA-Konsortium 2001, 82)
Im ersten Fall reichen die im Text enthaltenen Informationen aus, um die jeweilige Frage zu beantworten. Bei diesem Aufgabentyp, der anteilsmäßig etwa 70 Prozent ausmacht, geht es darum, ein allgemeines Textverständnis zu entwickeln, Informationen aus dem gegebenen Text herauszufiltern oder eine Textinterpretation vorzunehmen. Die restlichen 30 Prozent der Aufgaben, die zur Messung der wissensbasierten Verstehensleistung dienen, machen es erforderlich, dass die Schülerinnen und Schüler auf bereits vorhandenes Vorwissen zurückgreifen, um die Inhalte oder die Struktur bzw. Form des Textes reflektieren und bewerten zu können. (Vgl. Artelt u.a. 2001, 82.)
Summa summarum ergeben sich daraus fünf Aspekte der Lesekompetenz, die sich wiederum zu drei Subskalen zusammenfassen lassen. Aufgaben der Subskala ‘Informationen ermitteln’ verlangen vom Rezipienten, dass er aus dem schriftlichen Material eine oder mehrere (Einzel-)Informationen herausfiltert. In Abhängigkeit der Aufgabenstellung wird erwartet, dass einzelne Passagen oder größere Textteile verstanden und vorhandene Angaben miteinander verglichen werden. Es ist auch möglich, dass die gesuchten Informationen nicht im Text enthalten sind und dementsprechend hergeleitet werden müssen.
Um Aufgaben der Subskala ‘Textbezogenes Interpretieren’ lösen zu können, muss der Leser Bedeutungen herstellen und Schlussfolgerungen ziehen können. Dazu gehört auch das Gegenüberstellen von Testpassagen. Des Weiteren gibt es Aufgaben, die vom Rezipienten erwarten, dass er Rückschlüsse über die Intention des Autors zieht.
Aufgaben der Subskala ‘Reflektieren und Bewerten’ verlangen vom Leser das In-Beziehung-Setzen von Ideen, bereits vorhandenem Wissen und eigenen Erfahrungen. Manche Aufgabenstellungen erfordern das Bestimmen der Validität zentraler Textaussagen mit Hilfe von Allgemeinwissen, das Bewerten von Informationen unter Einbeziehung konträrer Meinungen oder die Beurteilung eines Textes im Hinblick auf seine Struktur und Zweckmäßigkeit. Dies setzt jedoch voraus, dass der Rezipient in der Lage ist, die folgerichtige Gliederung eines Textes und die Verwendung von sprachlichen Mitteln wie Ironie zu erkennen, kritisch zu hinterfragen und entsprechend zu bewerten. (Vgl. Artelt u.a. 2001, 83 f.)
Bei allen drei Subskalen hängt die Schwierigkeit der zu bearbeitenden Aufgabe sowohl von dem Grad der Komplexität des Textes als auch von der Vertrautheit des jeweiligen Themas ab. Die Aufgaben aus den Bereichen ‘Informationen ermitteln’ und ‘Textbezogenes Interpretieren’ werden darüber hinaus durch die Evidenz, mit der auf wichtige Informationen hingewiesen wird, und durch das Auftreten interessanter, für die Bearbeitung jedoch unwichtiger Informationen erschwert. Aufgaben, die der Subskala ‘Informationen ermitteln’ zuzuordnen sind, gewinnen an Anspruch, wenn die Anzahl der herauszusuchenden Einzelinformationen und die Kriterien, die diese zu erfüllen haben, steigen. (Vgl. Artelt u.a. 2001, 88 ff.)
[...]
- Quote paper
- Janice Höber (Author), 2006, Die Bedeutung der Textarbeit für den Schulaufsatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138886