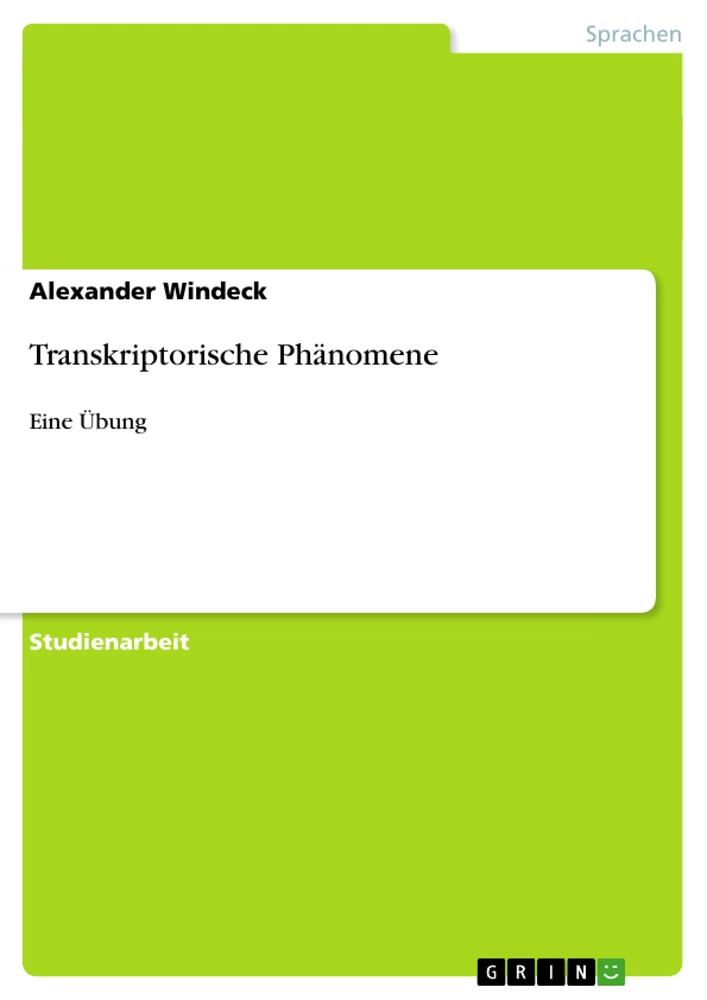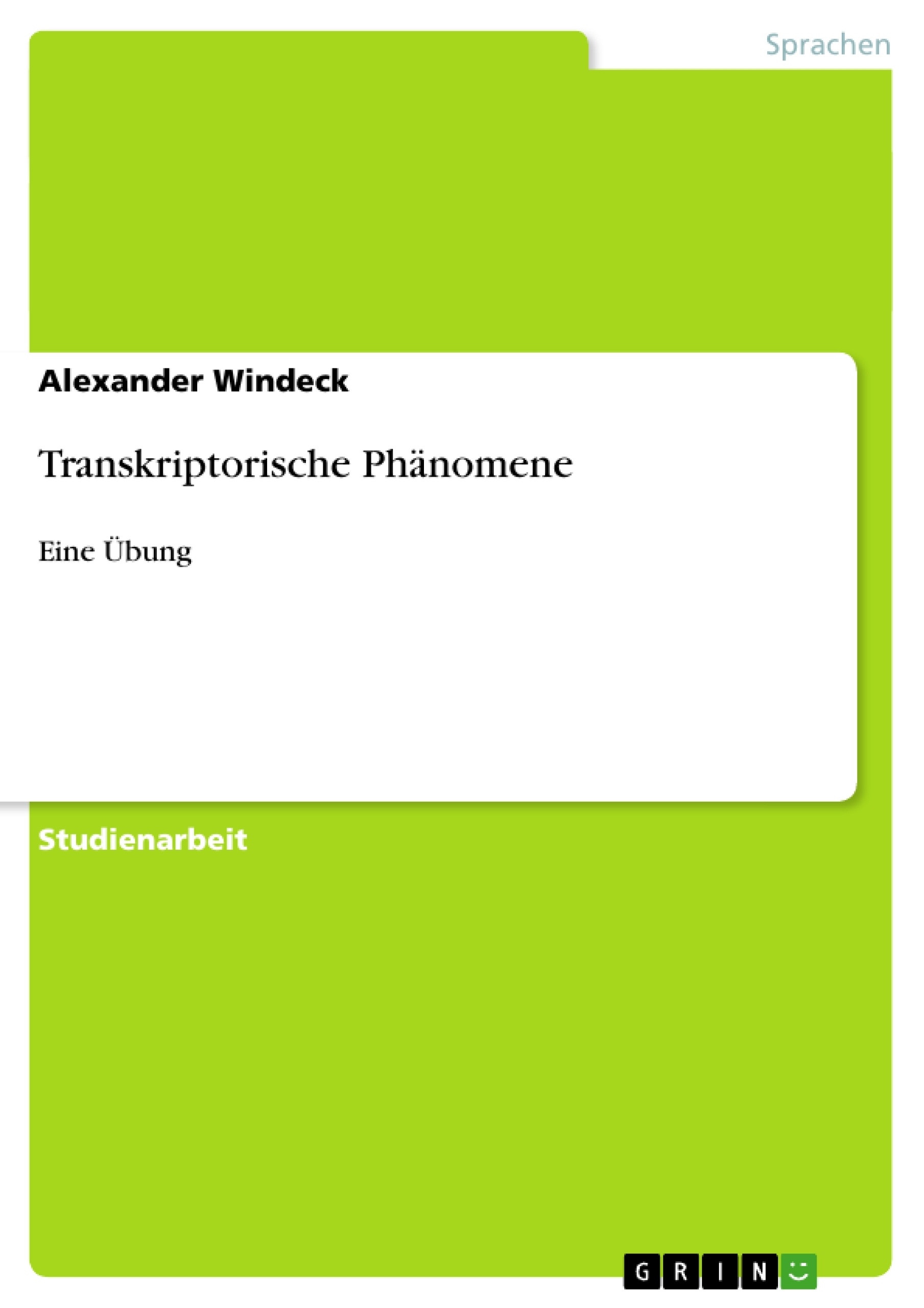Die engere Transkribierung von Alltagssprache weist eine Reihe besonderer Merkmale auf, die im Rahmen einer phonetischen Übung verdeutlicht werden sollten. Diese Hausarbeit enthält die genauen Transkriptionen eines längeren Liedtextes sowie einiger spezieller Problemfälle, an denen sich die wichtigsten Phänomene der Artikulation des Deutschen und ihre korrekte Transkription veranschaulichen lassen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aufgabe 2)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Auffallend ist, dass fast alle stimm haften Plosive aufgrund vorangehender stimm loser Laute selbst entstimmt produziert wurden. In Satz 1 ging dabei gleichzeitig an zwei Stellen die Aspiration eines stimm losen Plosivs verl oren, so dass diese keine wahrnehm baren Verschlusslösungen aufweisen und nach eine r kurzen Lücke im Signal sofort in den nachfolgenden, dann entstimmten Plosiv übergehen.
Andererseits wurde in Satz 2 an zw ei Stelle n der stimm lose glottale F rikativ aufgrund des Einflusses von ihn umgebenden stimmhaften Lauten selber stimmhaft realisiert.
Aufgabe 3)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zu beobachten ist, dass bei beiden S ätzen die Artikulation des stimmlosen uvularen Frikativs mit der des stimm haften uvularen Frikativs zusamm enfällt und insgesam t ohne Stimmbeteiligung realisiert wird.
Im Signal erkennt m an, dass der zusamm engezogene stim mlose uvulare Frikativ in Satz 3 wesentlich energiereicher auftritt als dies in Satz 4 der Fall ist. Außerdem wird die Variante in Satz 3 etwas weiter hinten gebildet.
Der Grund dafür liegt im günstigen koartikulat orischen E influss des vorangehenden [u:], welches anders als das [a] in Satz 4 ein Hi nterzungenvokal und som it der Artikulationsstelle des uvularen Frikativs näher ist.
Aufgabe 4)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Beide Versionen sind stark verschliffen und we isen größtenteils die gleichen segmentale m Merkmale auf, was vor allem auf die hohe Spre chgeschwindigkeit des Sprechers in beiden Aufnahmen zurückzuführen ist.
In beiden Sätzen f ehlt der finale stimmlose Plosiv [t] des Wortes <sind>. Außerdem wurde der velare Frikativ in <frei> stimmlos realisiert und zwar so energiereich, dass ich die direkte Notation als stimmlosen velaren Frikativ de r des entstimmten (eigentlich stimmhaften) velaren Frikativs vorgezogen habe.
Satz 2 ist insgesamt noch stärker zusammengezogen als Satz 1 und so verschwindet zwischen den Worten <frei> und <und> der glottale Plosiv.
Beide Male gibt es am Auslaut des W ortes <und> keine erkennbare Aspiration, wobei der nachfolgende velare Plosiv [g] dennoch entstimmt ist.
Durch die starke Vers chmelzung der W orte <gleich > und <an> entfällt im zweiten Satz wieder der glottale Plosiv.
Auffällig in der ersten Version ist, dass der velare Frikativ in <Rechten> stimmhaft artikuliert wurde, obwohl er einem stimmhaften Plosiv fo lgt und daher eigentlich se lbst entstimmt sein müsste. Die s z.B. is t a n selbe r Stelle in der zweiten Version d er F all, wo es ebenf alls merkwürdig ist, da hier der vorhergehende stimmlose Plosiv am Ende des W ortes <und> elidiert wurde.
In der zweiten Aufnahm e gibt es außerdem einen starken glottalen P losiv vor dem [ o] in <geboren>, obwohl an dieser Stelle keine neue Silbe beginnt.
Aufgabe 5)
I. Die Sprechgeschwindigkeit der ersten Aufnahme beträgt ca. 6,1 Silben/Sekunde. Die Sprechgeschwindigkeit der zweiten Aufnahme beträgt ca. 7,4 Silben/Sekunde.
Damit liegt die Sprechgeschwindigkeit insgesamt im schnellen bis sehr schnellen Bereich, der z.B. bei Neppert mit 5,6 bis 6,0 Silben/Sekunde angegeben wird (vgl. Neppert 1999, S. 250), und sogar noch darüber. Andere Autoren st ufen den Bereich der durchschnittlichen Geschwindigkeit grob von 5 bis 8 S ilben/Sekunde ein (vgl. Pom pino-Marshall 1995, S.238) womit die vorliegenden Beispiele wiederum beide als schnell gesprochen angesehen werden.
Dadurch lässt sich der hohe Grad an Verschleifungen bei beiden Aufnahm en erklären und dass zwischen den beiden Versionen keine großen Unterschiede in der Q ualität der
Artikulation auftauchen.
II. Der durchschnittliche F0 der ersten Version liegt bei 150Hz, das Minimum bei 112Hz und das Maximum bei 212Hz.
Bei der zweiten Version liegt der durchschni ttliche F0 bei 149Hz, das Minim um bei 109Hz und das Maximum bei 185Hz.
Der durchschnittliche Grundfrequenzbereich eines typischen männlichen Sprechers wird in der Literatur mit 100 bis 150 Hz angegeben, der Bereich aller beim Sprechen vorkommenden Frequenzen mit 90 bis 220 Hz (vgl. Neppert 1999, S. 125). Somit erkennt man, dass sich die Werte des Sprechers der vorliegenden Beispiele wie zu erwarten innerhalb dieser Grenzen bewegen. Der sprecherspezifische Schwerpunkt liegt allerdings in den höheren Tonlagen. Dies erkennt man daran, dass sich bei beiden Versionen der durchschnittliche Frequenzwert mit ca. 150 Hz schon auf der obersten Grenze befindet, der für einen typischen männlichen Sprecher angegeben wird. Die vereinzelten Maxima bei 212 Hz bzw. 185 Hz liegen sogar nahe der Obergrenze, die für alle vorkommenden Frequenzen gegeben wurde.
Insgesamt bestätigen die gemessenen Werte den Eindruck einer ungewöhnlich hohen Stimme des Sprechers.
Bibliographie:
Neppert, J. (1999): Elemente einer akustischen Phonetik. Hamburg: Buske Pompino-Marschall, B. (1995): Einführung in die Phonetik. Berlin: deGruyter
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was sind typische Merkmale bei der Transkription von Alltagssprache?
Typisch sind Verschleifungen, die Entstimmung von Plosiven durch benachbarte Laute und die Elision (Wegfall) von Endlauten wie dem [t] in "sind".
Wie beeinflusst die Sprechgeschwindigkeit die Artikulation?
Eine hohe Sprechgeschwindigkeit (über 6 Silben/Sekunde) führt zu starken Verschleifungen und Zusammenziehungen von Wörtern, da die Artikulationsorgane weniger Zeit für die präzise Bildung der Laute haben.
Was ist Koartikulation?
Koartikulation bezeichnet die gegenseitige Beeinflussung von Lauten. Beispielsweise wird ein uvularer Frikativ weiter hinten gebildet, wenn ein Hinterzungenvokal wie [u:] vorausgeht.
Wie hoch ist die durchschnittliche Grundfrequenz (F0) bei Männern?
In der Literatur wird der Bereich für männliche Sprecher meist mit 100 bis 150 Hz angegeben. Werte um 150 Hz deuten auf eine eher hohe Männerstimme hin.
Was versteht man unter einem glottalen Plosiv?
Der glottale Plosiv ist der "Knacklaut" vor Vokalen am Silbenanfang. Bei sehr schnellem Sprechen kann dieser Laut zwischen Wörtern wie "frei" und "und" komplett entfallen.
- Citation du texte
- Alexander Windeck (Auteur), 2007, Transkriptorische Phänomene, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138925