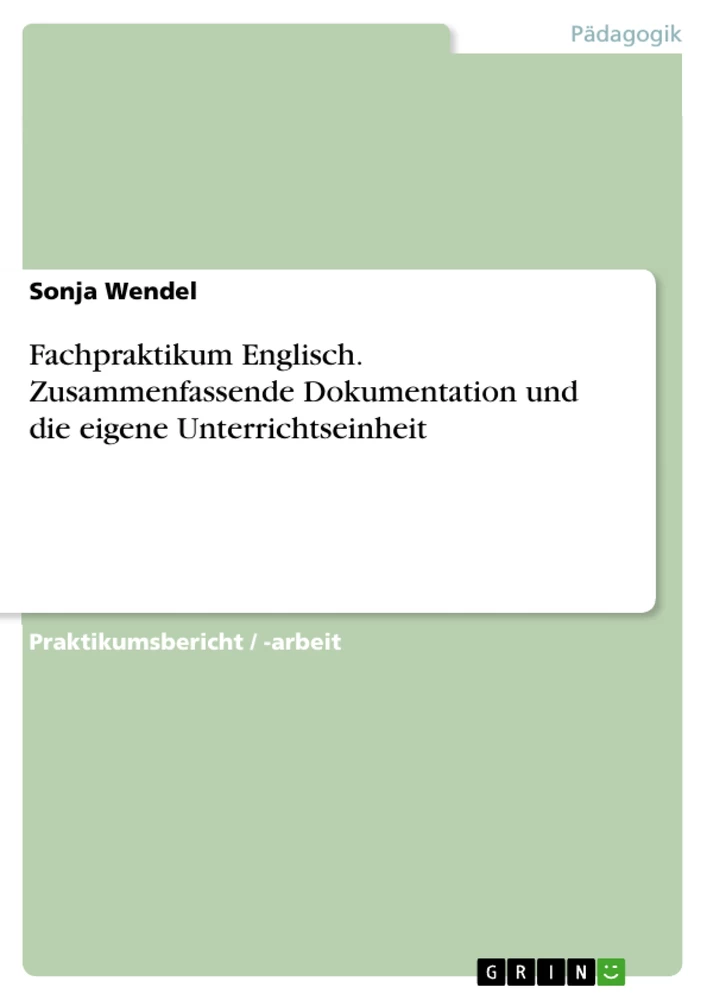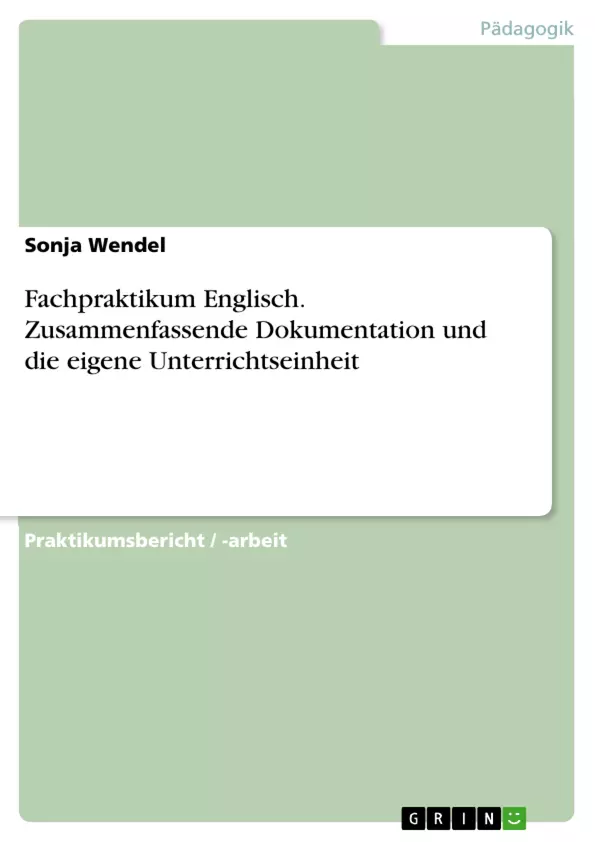In diesem sogenannten Fachpraktikum stand ein Fach im Vordergrund der Analyse von Schule, Unterricht & Handeln: Englisch. Entgegen der zuvor durchgeführten Praktika sah ich dem fachwissenschaftlichen Praktikum ein wenig ängstlich-abwartend und nicht nur gespannt entgegen. Die Erfahrung, in einer Klasse bzw. einem Kurs und im Unterricht zu sitzen war für mich ja prinzipiell nichts Neues und Lehrerfahrungen hatte ich durch eigenen Unterricht schon vorher sammeln dürfen. Auch ist seit meinem erziehungswissenschaftlichen Praktikum gerade erst ein Semester verstrichen. Allerdings habe ich bisher nicht das Gefühl bekommen, von anderen Lehrkräften in meiner Leistung bewertet und begutachtet zu werden, wie es jetzt der Fall sein sollte. ...
6. Eigene Einschätzung des Praktikums und Zusammenfassung
...Insgesamt würde ich mir heute wünschen, dass ich doch intuitiv selbst den Mentor gewählt hätte, statt den von der Schule zugewiesenen Mentor kommentarlos anzunehmen, aber ich kannte meinen Mentor zuvor nicht und konnte somit auch nicht begründet gegen diese Auswahl argumentieren. Die Erfahrung hat meinen Blick für den zukünftigen Lehralltag geschärft, selbst wenn ich mir für das nächste Praktikum einen Mentor erhoffe, den ich nicht derart distanziert und destruktiv erleben muss. Trotz allem hat mich das Praktikum nicht von meinem Ziel zukünftiger Lehre abgebracht und ich habe wichtige Rückschlüsse auf meine vorhandenen und noch auszubauenden Fähigkeiten ziehen können, um nach der Ausbildung eine engagierte, motivierende und kompetente Lehrerin zu sein.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Schulzentrum XY und der Fachbereich Englisch
2.1 Fakten zum Schulzentrum XY (SZL)
2.2 Der Fachbereich Englisch am SZL
3. Zusammenfassende Dokumentation der Hospitationen im Praktikum
4. Die eigene Unterrichtseinheit
4.1 Bedingungsanalyse des Unterrichts
4.1.1 Sozial – Kulturelle Aspekte
4.1.2 Einstellung zum Fach und zum Thema
4.1.3 Relevante Arbeitstechniken
4.1.4 Differenzierungsmaßnahmen
4.1.5 Eigene Stärken, Besonderheiten im Umgang mit den Schülern
4.2 Einordnung des Themas in die Gesamtplanung
4.2.1 Bedeutung des Themas der Stunde
4.2.2 Einordnung in den Lehrgang und Lehrplanbezug
4.2.3 Schwierigkeitsanalyse
4.3 Auswahl des Stoffes und Schwerpunktsetzung
4.4 Lernziele
4.5 Didaktische Überlegungen
4.5.1 Abriss der Phasenfolgen
4.5.2 Anmerkungen zu den Phasen und mögliche Alternativen
4.6 Stundenverlaufsplan (Skizze)
4.7 Stundenanalyse
4.7.1 Sachanalyse
4.7.1 Personenbezogene Analyse
5. Schwerpunkt Unterrichtssprache
5.1 Sprachliche und nichtsprachliche Kommunikation
5.2 Einsprachigkeit
6. Resümee
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
In diesem sogenannten Fachpraktikum stand ein Fach im Vordergrund der Analyse von Schule, Unterricht & Handeln: Englisch. Entgegen der zuvor durchgeführten Praktika sah ich dem fachwissenschaftlichen Praktikum ein wenig ängstlich-abwartend und nicht nur gespannt entgegen. Die Erfahrung, in einer Klasse bzw. einem Kurs und im Unterricht zu sitzen war für mich ja prinzipiell nichts Neues und Lehrerfahrungen hatte ich durch eigenen Unterricht schon vorher sammeln dürfen. Auch ist seit meinem erziehungswissenschaftlichen Praktikum gerade erst ein Semester verstrichen. Allerdings habe ich bisher nicht das Gefühl bekommen, von anderen Lehrkräften in meiner Leistung bewertet und begutachtet zu werden, wie es jetzt der Fall sein sollte.
Zwar habe ich im vorangegangenen Wintersemester zwei Veranstaltungen zur Vorbereitung auf den Unterricht besucht und einige Bücher zur Vorbereitung gelesen, dennoch fühlte ich mich diesen fachlichen Herausforderungen und den damit zusammenhängenden fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Besonderheiten gegenüber unsicher und nur unzureichend vorbereitet. Nun sollte ich Aspekte der schulischen Rahmenbedingungen, Ausstattung und Ressourcen für den Englischunterricht, die fachliche Analyse beobachteten Unterrichts anderer Lehrkräfte und schließlich die Planung, Durchführung und Auswertung einer eigenen Unterrichtseinheit erfahren.
Entsprechend den schulischen Bedingungen trafen wir uns erst am 3. Praktikumstag das erste Mal tatsächlich in der Schule, um alle anderen Praktikanten und auch kurz unsere Mentoren kennen zu lernen. Für seinen Stundenplan war an dieser Schule jeder selbst verantwortlich, ebenso wie man sich selbst ein Bild von den grundlegenden Prinzipien des Fachunterrichts machen musste. Dies konnte überwiegend nur durch Hospitationen und selbst initiierte Gespräche mit dem Kollegium geschehen.
Mit diesem Bericht am Schulzentrum XY in Bremen-Nord, vom 09.02. – 20.03.2009, werde ich gemachte Erfahrungen und Beobachtungen aus dem Praktikum, festhalten. Dem eigentlichen Bericht vorangestellt werden allgemeine Beobachtungen zum Fachbereich Englisch an dieser Schule. Dabei gehe ich auf wesentliche und das Lehrumfeld bestimmende Aspekte ein. Weiterhin beschreibe ich zusammenfassend meine Hospitationen im Unterricht und analysiere etwas ausführlicher die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung einer eigenen Unterrichtsstunde und den von mir gewählten Schwerpunkt der „Unterrichtssprache“. Abgerundet wird der Bericht mit einem persönlichen Resümee.
2. Das Schulzentrum XY und der Fachbereich Englisch
2.1 Fakten zum Schulzentrum XY (SZL)
Zum Ende der Grundschule müssen Schüler[1] und Eltern gemeinsam entscheiden, welche Bildung die Zukunft der Schüler bestimmen soll. Eine mögliche Wahl, neben den Schulverbünden und dem reinen Gymnasium, ist ein Schulzentrum, das sich grundsätzlich dadurch kennzeichnet, dass sich mehrere Schulen ein Gelände teilen. Vorteil dessen ist, dass der komplette weitere Lebensweg eines Schülers auf demselben Gelände stattfindet, weil er ohne Schul- oder Lokalitätswechsel zwischen den Schulformen wechseln kann. Mit der zur Zeit geplanten Reform, die bereits ab Sommer 2009 umgesetzt werden soll, wird dieser Aspekt allerdings wegfallen, da es von da an in Bremen nur noch Oberschulen mit Konzept und Struktur der skandinavischen Gesamtschulen und wenige übrigbleibende Gymnasien geben soll. Ziel der Reform soll eine noch bessere Förderung der Schüler bei gleichzeitig höherer Binnendifferenzierung in den Klassen sein. So soll ein gemeinsamer Erkenntnisgewinn bei lernschwächeren und auch lernstarken Schülern erzielt werden.
[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] Das SZL liegt im Norden des Ortsamtsbereiches Vegesack, direkt neben naturgeschützten Wiesen und Teichen. 1974 wurde die Schule gebaut, 1976 unter anderem um eine Dreifach-Turnhalle erweitert. Im Jahre 1991 vollkommen schadstofffrei, wurde 1994 eine Windkraft- und Solaranlage eingefügt. Seit 1977 gibt es eine Dependance in der Borchshöhe. Auffällig sind vor allem die vielen Grünanlagen, die dem Auge des Betrachters eine in das Umfeld eingebettete Ruhe der Schule vermitteln.
Üblich im Gymnasialen Zweig des SZL sind Schüleraustausche mit verschiedenen interessierten Schulen in Europa und Übersee, die Teilnahme an den "Model-United Nations" in Den Haag und an einem Betriebspraktikum in England, die Aktivitäten als UNESCO-Schule, kreative Arbeitsgemeinschaften, eine Poleposition im Bereich Computer & Internet, die Sportanlagen, das Engagement auf dem alternativen Energiesektor und der Musik- und Kunstbereich. Als Besonderheiten des SZL kann man vor allem die Sportklassen (ab Kl. 5); ein Methodencurriculum zum Lernen (ab Kl. 5), die einheitliche Schulkleidung auf Wunsch, einige Schülergemeinschaften und Arbeitsgemeinschaften, sowie andere schulische und außerschulische Angebote hervorheben und besonders den Willen der Schüler zur Selbstorganisation anerkennen.
Für mich selbst stellte sich die Schule als eine beliebte Institution mit großem Einzugsgebiet und vielfältigen sozialen Hintergründen von Schülern und Lehrerkollegium dar. In der Haupt- und Realschule entstehen jährlich durchschnittlich 2 neue Klassen, das Gymnasium wird 3- bis 4-zügig gebildet. Ab dem kommenden Schuljahr soll die neue Schulform in einer 3- (5-)[2] zügigen Oberschule des fünften Jahrgangs realisiert werden. Nicht nur wegen seiner Profile und einer wählbaren Zweitsprache Russisch, sondern vor allem wegen eines insgesamt netten Lehrerkollegiums ist mir das SZL nach meinem letzten Praktikum positiv im Gedächtnis haften geblieben, was ich mit dem neuen Praktikum zu bestätigen hoffte.
2.2 Der Fachbereich Englisch am SZL
Zur Zeit unterrichten in der Schule 65 Lehrkräfte eine sehr große Anzahl von ca. 1100 Schülern, 17 der Lehrkräfte unterrichten im Fachbereich Englisch. Eine Besonderheit der Schule ist der bilinguale Sachfachunterricht. Je zwei Klassenverbände des Gymnasiums werden bilingual, also in den Fächern Sport und Welt- und Umweltkunde (ab Kl. 5 partiell), Biologie (in Kl. 7) und Erdkunde (in Kl. 7), Musik und European Studies (ab Kl. 8) in englischer Sprache unterrichtet. Die Verteilung des Englisch-Einstiegs über mehrere Jahre hinweg soll den Vorteil haben, dass der Einstieg in die Zweitsprache durch die Handlungsorientierung erleichtert wird. Auch zum kommenden Sommer sind neben der neuen Schulform wieder zwei bilinguale Klassenverbände geplant.
Englisch als erste Fremdsprache wird in der 5.-10. Klasse 3 - 4 Stunden wöchentlich unterrichtet. Eine Ausnahme bildet der bilinguale Zweig: Hier werden die Schüler der Jahrgänge 5 und 6 pro Woche 6 Stunden in Englisch unterrichtet; 5 bzw. 4 Wochenstunden werden es in den Jahrgängen 7 bis 10, hinzu kommen ab 8. Jahrgang 5 Stunden Europastudien (European Studies) und Biologie- und Erdkundeunterricht finden nur noch in deutscher Sprache statt. In Haupt- und Realschulklassen wird der Unterricht außerdem nach G- (=Grundkurse) und E- (=Erweitertes Niveau) Kursen differenziert, so dass man den verschiedenen sprachlichen Leistungsniveaus und den Begabungen der Schüler gerecht werden kann. Zudem sind diese Kurse unter anderem neben jenen in Mathematik und Deutsch bedingend für die Zuordnung des Schwerpunktes zur Erlangung der Bildungsreife bzw. des mittleren Schulabschlusses.
Die Schule arbeitet mit einem schulinternen Curriculum[3] für den Fachbereich Englisch, das schriftlich aufgesetzt wurde und den Lehrkräften im Sekretariat zur Verfügung steht. Jedoch wird es offenbar nur in den Jahrgängen 5 und 6 aktiv genutzt. Dies soll sich zum kommenden Schuljahr mit der schulinternen Entwicklung gemeinsam ändern, ebenso wie an die Stelle der bereits seit 1998 genutzten Schulbücher neue Werke treten sollen.[4] Ich persönlich zweifle an der Erstellung bzw. Verabschiedung eines neuen Curriculums, da das Kollegium im Fachbereich Englisch als nicht harmonierend empfunden wurde. Dieser Zustand spiegelte sich vor allem darin, dass für den Fachbereich seit Dezember bis Ende Februar nach dem Rücktritt der bis dahin mehrjährigen Fachbereichsleiterin keine neue Leitung gefunden werden konnte. Inzwischen haben sich drei Lehrkräfte gemeinsam bereit erklärt, die Fachbereichsleitung zunächst bis zum Sommer gemeinsam kommissarisch zu übernehmen.
In diesem Jahr wurden die ersten Vergleichsarbeiten innerhalb des neuen VERA 8- Konzeptes geschrieben. Das SZL beteiligte sich in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik. VERA 8 sind Lernstandserhebungen des Bundes, die in Bremen nicht in die Bewertung der individuellen Schülerleistungen eingehen dürfen. An der XY habe ich unterschiedliche Umgangsweisen mit der Arbeit beobachten können. Diese variierten zwischen dem Eingewöhnen der Schüler an die Struktur der VERA- Tests durch einmaliges Durchgehen von Beispielen anhand von Materialien der Verlage Klett und Cornelsen und der völligen Ignoranz (wie vom Bund gefordert).
Unmut wurde geäußert über den hohen zeitlichen Arbeitsaufwand der Lehrkräfte für die Vorbereitung und Verwaltung der Tests und einen zeitlichen Stundenverlust, der mithin zur Nichterfüllung des Lehrplans führen könnte. Eine englische Lehrkraft beklagte zudem, dass man am SZL den Schülern die Zeit genau nach Bundesvorgaben zugeteilt habe, während von anderen Schulen bekannt wurde, dass die Schüler einen weit größeren zeitlichen Rahmen zur Verfügung hatten (zum Teil 2 statt 1 Schulstunde). Jedoch habe ich auch Kenntnis von Lehrern, die kurz nach den VERA- Tests ihr Vorbereitungsmaterial nutzten, um mit ihrer Hilfe eine den Schülern nun schon recht vertraute Klassenarbeit zu konzipieren.
3. Zusammenfassende Dokumentation der Hospitationen im Praktikum
Im Rahmen des Praktikums habe ich beobachtend am Unterrichtsgeschehen des Fachunterrichts in der ersten Fremdsprache Englisch der Jahrgänge 6-10 überwiegend in Gymnasialklassen teilgenommen. So erhielt ich vor allem während der ersten drei Wochen die Gelegenheit, verschiedene Lehrkräfte bei der Arbeit im Englischunterricht zu beobachten und vor allem den Englischunterricht meines Mentors aus einer gewissen Distanz heraus zu betrachten.
„Die Beziehung der Lehrer zu den Schüler erlebte ich als ein pädagogisches Konstrukt.“ - Unabhängig vom emotionalen Zustand der Lehrkraft hält diese Vorstellung, zumindest im gegenwärtigen, erlebten offenen Unterricht einer eingehenden Analyse nicht stand: Ein komplexes Geflecht von der Sozialstruktur, der Klasse zugrundeliegenden Regeln und Normen im Kontext pädagogischer Zielvorstellungen und entwicklungspsychologischer Bedürfnisse relativiert das Ideal der „natürlichen Beziehung“, im Sinne eines nicht von geschaffenen Regeln getragenen, sondern gewissermaßen künstlich aufrecht erhaltenen Verhaltenscodexes. Zum Verhältnis von den Schülern zur Schule ist mir direkt nichts bekannt geworden, jedoch glaube ich behaupten zu können, dass die meisten (nicht aber alle) Kinder gerne zur Schule kommen
Die Beurteilung der fachlichen Kompetenz der Lehrkräfte, insbesondere meines Mentors, fällt aus verschiedenen Gründen schwer: Einerseits sind meine eigenen didaktischen und fachbezogenen Kenntnisse noch nicht hinreichend weit ausdifferenziert, um Rückschlüsse auf die Fachkompetenz zuzulassen, andererseits machen in der Schule im Allgemeinen pädagogische Kompetenzen einen Großteil der Fachkompetenz aus. Souveränität und Abstand gegenüber den Fächern, Humor und die Fähigkeit sich selbst in Frage zu stellen, habe ich bei den besuchten Lehrkräften angetroffen. Das Gleiche gilt für das Wissen um unterschiedliche Formen des Unterrichtens, wenn auch damit über die Variationsbreite des Handelns, also praktischen Unterrichtens noch nichts gesagt ist.
Der Unterricht beginnt i.d.R. mit einer Eingangsphase, die je nach Lehrkraft sehr verschieden gestaltet wird. Der Unterricht endet auch unterschiedlich - in Abhängigkeit von der vorausgegangenen Arbeitsphase. In den meisten Fällen gab es eine Freiarbeitsphase zum Ende der Stunde, die mit der Erlaubnis zum Heimgang abgeschlossen wurde. Als Unterrichts-ziele konnte ich erkennen: Die Vermittlung elementarer Techniken und Basiswissen, der Versuch die einen Interessenausgleich ermöglichende Kommunikation zu installieren, die Anleitung zur selbstständigen Organisation von Arbeit und aufrichtiger Rechenschafts-ablegung des eigenen Lernprozesses, Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten, und Anleitung zum Umgang mit dem Internet.
Die Unterrichtsstunden verliefen als Zusammenstellung diverser Unterrichtselemente, u.a.: Gemeinsames Erkunden des Themas mit dem Lehrer, freie Arbeit mit bestimmter Arbeitsanweisung und die Vorführung verhältnismäßig komplexer Sachverhalte. Die verwendeten Arbeitsmittel decken ein weites Spektrum ab; neben der Tafel sind Arbeitsbögen, Forscherhefte, Puzzles, Modelle, Atlanten, Overheadfolien, Beamer, Ansichtsmaterial, sowie eine große Zahl an Büchern unterschiedlichsten Schwierigkeitsgrades Teil der Ausstattung, die von den Kindern ausgiebig in Anspruch genommen wird. Außerdem stehen Computerräume mit Internetanschluss und ein Leseraum zur Verfügung.
[...]
[1] Anm.: Wenn ich nachfolgend von dem bzw. den Schülern spreche, so beziehe automatisch auch Schülerinnen in meine Beobachtungen ein – es sei denn, es gibt einen gegenteiligen Hinweis.
[2] Siehe Ausführungen zum bilingualen Unterricht unter Punkt 2.2
[3] Eigene Definition eines Curriculums: Ein Curriculum umfasst den auf die Bildungseinrichtung heruntergebrochenen Lehrplan unter Hinzufügen spezifischer Lehr- und Erziehungsmethoden, sowie eigener Zielsetzungen. Es wird vom Fachbereich gemeinsam beraten und beschlossen.
[4] Zur Zeit arbeitet die Schule mit Schulbuchreihe des Klett Verlages aus der Orange-Line für die Hauptschule, Red-Line für die Realschule und Green-Line new für das Gymnasium.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Schwerpunkte eines Fachpraktikums Englisch?
Schwerpunkte sind die Analyse der Unterrichtssprache (Einsprachigkeit), die Planung eigener Unterrichtseinheiten und die Hospitation bei erfahrenen Lehrkräften.
Wie wird eine Unterrichtseinheit im Fach Englisch geplant?
Die Planung umfasst eine Bedingungsanalyse (Lerngruppe), die didaktische Reduktion, Lernzielformulierung und die Erstellung eines detaillierten Verlaufsplans.
Was bedeutet bilingualer Unterricht an Schulzentren?
Dabei werden Sachfächer wie Biologie, Erdkunde oder Sport in englischer Sprache unterrichtet, um die Sprachkompetenz handlungsorientiert zu fördern.
Welche Rolle spielt die Unterrichtssprache Englisch?
Ziel ist eine weitgehende Einsprachigkeit, um einen „Immersionseffekt“ zu erzielen, wobei sowohl sprachliche als auch nichtsprachliche Kommunikation genutzt werden.
Wie wichtig ist das Mentoring im Praktikum?
Ein guter Mentor ist entscheidend für die professionelle Entwicklung; die Arbeit reflektiert auch kritisch die Bedeutung einer konstruktiven Begleitung.
- Quote paper
- Diplomwirtschaftsjapanologin (FH) Sonja Wendel (Author), 2009, Fachpraktikum Englisch. Zusammenfassende Dokumentation und die eigene Unterrichtseinheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139298