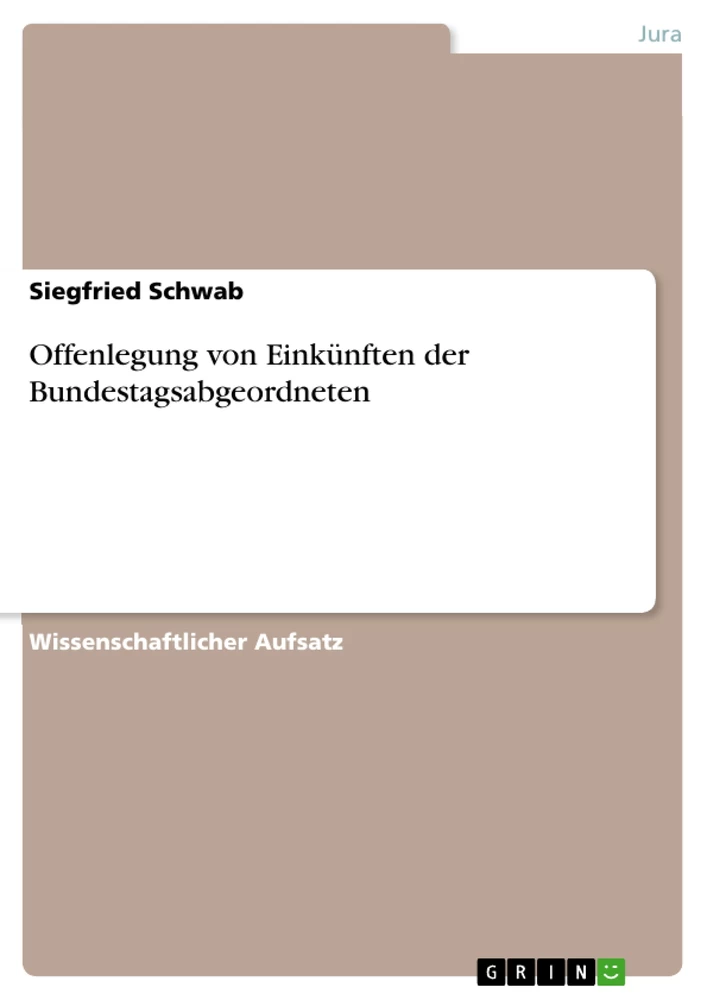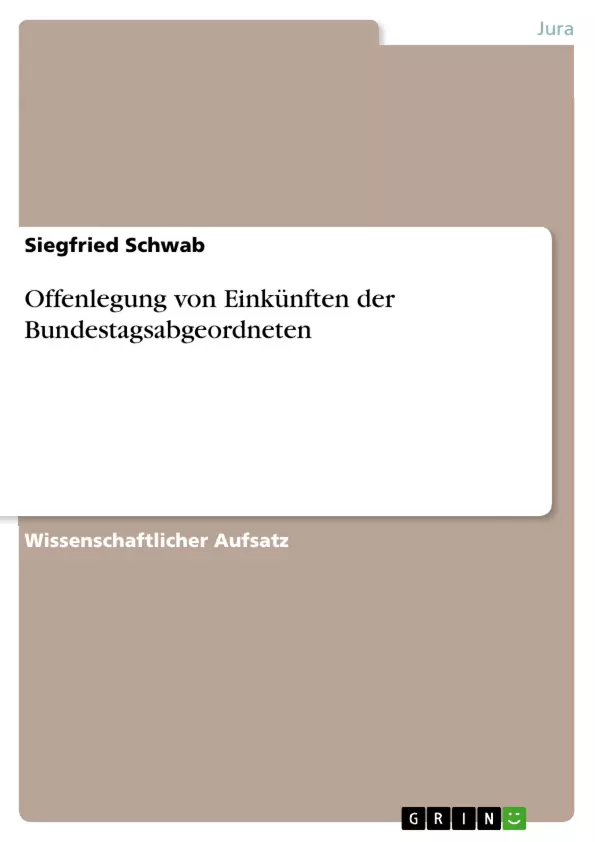Der Abgeordnete ist - vom Vertrauen der Wähler berufen - Inhaber eines öffentlichen Amtes, Träger eines freien Mandats und, gemeinsam mit der Gesamtheit der Mitglieder des Parlaments, Vertreter des ganzen Volkes. Er hat einen repräsentativen Status inne, übt sein Mandat in Unabhängigkeit , frei von jeder Bindung an Aufträge und Weisungen, aus und ist nur seinem Gewissen unterworfen.
Mit dem repräsentativen Status des Abgeordneten gem. Art. 38 Abs. 1 GG sind jedoch nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten verbunden, deren Reichweite durch das Gebot, die Repräsentations- und Funktionsfähigkeit des Parlaments zu wahren, bestimmt und begrenzt wird. Das Mandat aus eigenem Entschluss nicht wahrzunehmen, ist mit dem Repräsentationsprinzip unvereinbar.
3Die Pflichtenstellung umfasst auch, dass jeder einzelne Abgeordnete in einer Weise und einem Umfang an den parlamentarischen Aufgaben teilnimmt, die deren Erfüllung gewährleistet. Nur der Umstand, dass die Abgeordneten bei pflichtgemäßer Wahrnehmung ihres Mandats auch zeitlich in einem Umfang in Anspruch genommen sind, der es in der Regel unmöglich macht, daneben den Lebensunterhalt anderweitig zu bestreiten, rechtfertigt den Anspruch, dass ihnen ein voller Lebensunterhalt aus Steuermitteln, die die Bürger aufbringen, finanziert wird.Über Gegenstand und Reichweite von Offenbarungspflichten hat der Gesetzgeber in Ausübung seiner Kompetenz nach Art. 38 Abs. 3 GG zu entscheiden und dabei die betroffenen Rechtsgüter einem angemessenen Ausgleich zuzuführen. Regelungen, die den Abgeordneten als Privatperson betreffen, müssen nicht nur - wie sonstige Beschränkungen des freien Mandats - überhaupt Rechtfertigung in anderen Rechtsgütern der Verfassung finden, sondern sie müssen darüber hinaus in spezifischer Weise dem Hineinwirken in den persönlichen Lebensbereich des Abgeordneten Rechnung tragen; gegenläufige Belange sind gegeneinander abzuwägen und in einen angemessenen Ausgleich zu bringen. Das Interesse des Abgeordneten, Informationen aus dieser Sphäre vertraulich behandelt zu sehen, ist gegenüber dem öffentlichen Interesse an der Erkennbarkeit möglicher Interessenverknüpfungen der Mitglieder des Deutschen Bundestags grundsätzlich nachrangig.
Der Gesetzgeber kann die Ermächtigung des Art. 38 Abs. 3 GG durch generalisierende Tatbestände ausschöpfen, die an die Wahrscheinlichkeit einer Konfliktlage anknüpfen.
Der Abgeordnete ist - vom Vertrauen der Wähler berufen - Inhaber eines öffentlichen Amtes, Träger eines freien Mandats[1] und, gemeinsam mit der Gesamtheit der Mitglieder des Parlaments,[2] Vertreter des ganzen Volkes.[3] Er hat einen repräsentativen Status inne, übt sein Mandat in Unabhängigkeit[4], frei von jeder Bindung an Aufträge und Weisungen, aus und ist nur seinem Gewissen unterworfen.[5]
2. Mit dem repräsentativen Status[6] des Abgeordneten gem. Art. 38 Abs. 1 GG[7] sind jedoch nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten verbunden, deren Reichweite durch das Gebot, die Repräsentations- und Funktionsfähigkeit des Parlaments zu wahren, bestimmt und begrenzt wird.[8] Das Mandat aus eigenem Entschluss nicht wahrzunehmen, ist mit dem Repräsentationsprinzip unvereinbar.[9]
3. Die Pflichtenstellung umfasst auch, dass jeder einzelne Abgeordnete in einer Weise und einem Umfang an den parlamentarischen Aufgaben teilnimmt, die deren Erfüllung gewährleistet.[10] Nur der Umstand, dass die Abgeordneten bei pflichtgemäßer Wahrnehmung ihres Mandats auch zeitlich in einem Umfang in Anspruch genommen sind, der es in der Regel unmöglich macht, daneben den Lebensunterhalt anderweitig zu bestreiten, rechtfertigt den Anspruch, dass ihnen ein voller Lebensunterhalt aus Steuermitteln, die die Bürger aufbringen, finanziert wird.[11]
4. Aus Art. 48 Abs. 2 GG, demzufolge niemand gehindert werden darf, das Amt eines Abgeordneten zu übernehmen und auszuüben, und eine Kündigung oder Entlassung aus diesem Grunde unzulässig ist, und ebenso aus Art. 137 Abs. 1 GG, der den Gesetzgeber zu Beschränkungen der Wählbarkeit von Angehörigen des öffentlichen Dienstes ermächtigt, ist - unbestritten - zu schließen, dass das Grundgesetz die Ausübung eines Berufs neben dem Abgeordnetenmandat zulässt.[12]
5. Der Gesetzgeber durfte in Wahrnehmung seiner Kompetenz gem. Art. 38 Abs. 3 GG das verfassungsrechtliche Leitbild des Abgeordneten in dem Sinne nachzeichnen, dass die Ausübung des Mandats im Mittelpunkt der Tätigkeit eines Mitglieds des Bundestags steht und unbeschadet dieser Verpflichtung Tätigkeiten beruflicher oder anderer Art neben dem Mandat zulässig bleiben.
6. Dem von Art. 38 Abs. 1 GG gewährleisteten freien Mandat des Abgeordneten entspricht es, dass die Abgeordneten über die Art und Weise der Ausübung des Mandats grundsätzlich frei und in ausschließlicher Verantwortlichkeit gegenüber dem Wähler entscheiden. Die Beachtung der Pflicht, die Ausübung des Mandats in den Mittelpunkt der Tätigkeiten zu stellen, unterliegt nach den angegriffenen Vorschriften keiner Überwachung durch eine Behörde oder ein Gericht; Verstöße ziehen keine rechtlichen Folgen nach sich.
7. Die Grundrechte können keine Handhabe bieten, den Honoratioren-Abgeordneten[13] als verfassungsrechtliches Leitbild wieder aufleben zu lassen. Das BVerfG hat sich Erwägungen, die Rechte- und Pflichtenstellung des Abgeordneten nicht nur aus Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG zu bestimmen, sondern dafür auch auf Grundrechte zurückzugreifen, zu Recht nicht geöffnet.[14]
8. Der Akt der Stimmabgabe bei Wahlen erfordert nicht nur Freiheit von Zwang und unzulässigem Druck, sondern auch, dass die Wähler Zugang zu den Informationen haben, die für ihre Entscheidung von Bedeutung sein können. Das Volk hat Anspruch darauf zu wissen, von wem - und in welcher Größenordnung - seine Vertreter Geld oder geldwerte Leistungen entgegennehmen.
9. Über Gegenstand und Reichweite von Offenbarungspflichten hat der Gesetzgeber in Ausübung seiner Kompetenz nach Art. 38 Abs. 3 GG zu entscheiden und dabei die betroffenen Rechtsgüter einem angemessenen Ausgleich zuzuführen.[15] Regelungen, die den Abgeordneten als Privatperson betreffen, müssen nicht nur - wie sonstige Beschränkungen des freien Mandats - überhaupt Rechtfertigung in anderen Rechtsgütern der Verfassung finden, sondern sie müssen darüber hinaus in spezifischer Weise dem Hineinwirken in den persönlichen Lebensbereich des Abgeordneten Rechnung tragen; gegenläufige Belange sind gegeneinander abzuwägen und in einen angemessenen Ausgleich zu bringen. Das Interesse des Abgeordneten, Informationen aus dieser Sphäre vertraulich behandelt zu sehen, ist gegenüber dem öffentlichen Interesse an der Erkennbarkeit möglicher Interessenverknüpfungen der Mitglieder des Deutschen Bundestags grundsätzlich nachrangig.[16]
10. Der Gesetzgeber kann die Ermächtigung des Art. 38 Abs. 3 GG durch generalisierende Tatbestände ausschöpfen, die an die Wahrscheinlichkeit einer Konfliktlage anknüpfen.[17] Es begegnet keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, dass er eine generelle Anzeigepflicht für Tätigkeiten und Einkünfte außerhalb des Mandats begründet hat, die auf für die Ausübung des Mandats bedeutsame Interessenverknüpfungen hinweisen können, ohne dass es darauf ankommt, ob eine Konfliktlage im Einzelfall tatsächlich besteht. Es genügt die abstrakte Gefahr einer Beeinträchtigung der Unabhängigkeit des Mandats.
11. Die Sanktionierung von Verstößen gegen Anzeigepflichten ist mit Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG vereinbar. Die Funktionsfähigkeit des Parlaments würde beeinträchtigt und das Prinzip der strikten Gleichbehandlung aller Abgeordneten[18] verletzt, wenn Offenlegungspflichten gegenüber Abgeordneten, die deren Erfüllung verweigern, mangels wirksamer Sanktionen nicht durchgesetzt werden könnten.
§ 44b AbgG Verhaltensregeln: Der Bundestag gibt sich Verhaltensregeln, die insbesondere Bestimmungen enthalten müssen über
1. die Fälle einer Pflicht zur Anzeige von Tätigkeiten vor der Mitgliedschaft im Bundestag sowie von Tätigkeiten neben dem Mandat.
2. die Fälle einer Pflicht zur Anzeige der Art und Höhe der Einkünfte neben dem Mandat oberhalb festgelegter Mindestbeträge.
3. die Pflicht zur Rechnungsführung und zur Anzeige von Spenden oberhalb festgelegter Mindestbeträge sowie Annahmeverbote und Ablieferungspflichten in den in den Verhaltensregeln näher bestimmten Fällen.
4. die Veröffentlichung von Angaben im Amtlichen Handbuch und im Internet.
5. das Verfahren sowie die Befugnisse und Pflichten des Präsidiums und des Präsidenten bei Entscheidungen nach § 44a Abs. 3 und Abs. 4.
§ 1 Anzeigepflicht:
(1) Ein Mitglied des Bundestages ist verpflichtet, dem Präsidenten aus der Zeit vor seiner Mitgliedschaft im Bundestag schriftlich anzuzeigen:
1. die zuletzt ausgeübte Berufstätigkeit.
2. Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstandes, Aufsichtsrates, Verwaltungsrates, Beirates oder eines sonstigen Gremiums einer Gesellschaft oder eines in einer anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens.
3. Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstandes, Aufsichtsrates, Verwaltungsrates, Beirates oder eines sonstigen Gremiums einer Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts.
(2) Ein Mitglied des Bundestages ist zusätzlich verpflichtet, dem Präsidenten schriftlich die folgenden Tätigkeiten und Verträge, die während der Mitgliedschaft im Bundestag ausgeübt oder aufgenommen werden bzw. wirksam sind, anzuzeigen:
1. entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat, die selbstständig oder im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses ausgeübt werden. Darunter fallen z.B. die Fortsetzung einer vor der Mitgliedschaft ausgeübten Berufstätigkeit sowie Beratungs-, Vertretungs-, Gutachter-, publizistische und Vortragstätigkeiten. Die Anzeigepflicht für die Erstattung von Gutachten, für publizistische und Vortragstätigkeiten entfällt, wenn die Höhe der jeweils vereinbarten Einkünfte den Betrag von 1000 Euro im Monat oder von 10000 Euro im Jahr nicht übersteigt.
2. Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstandes, Aufsichtsrates, Verwaltungsrates, Beirates oder sonstigen Gremiums einer Gesellschaft oder eines in einer anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens.
[...]
[1] Die Wahrnehmung des Mandats erfordert den ganzen Menschen. Der Abgeordnete ist zumindest theoretisch keiner Partei und keinem Wahlkreis, aber auch nicht seinen Wählern verpflichtet, sondern nur dem Ganzen, dem Gemeinwohl. Das freie Mandat des Abgeordneten und die Gesamtrepräsentation des Parlaments erfordern nach heutigem Verständnis die grundsätzliche Wählbarkeit aller Bürger. Jedermann, ohne Rücksicht auf Herkunft, soziale Unterschiede, Ausbildung und Vermögen muss die gleichen Chancen haben, Mitglied des Parlaments zu werden. 1906 wurde das Diätenverbot im Reich abgeschafft. Diäten gelten als unverzichtbar und Schutz des Abgeordneten vor Nebenabreden, Zastrow, Der freie Abgeordnete, FAZ vom 14. Januar 2005, S. 3.
[2] Vgl. BVerfGE 56, 6 [405] = NJW 1981, 1831 .
[3] Vgl. BVerfGE 112, 118 [134] = NJW 2005, 203.
[4] Heußner: Die Abhängigkeit der Politiker als Funktionsmangel der Demokratie, ZRP 130ff. Droege, Herrschaft auf Zeit: Wahltage und Übergangszeiten in der repräsentativen Demokratie, DÖV 2009, S. 649; Von der Demokratie des Grundgesetzes als einer Demokratie ohne Volksabstimmung, Isensee, 60 Jahre GG, Vortrag Uni Bonn.
[5] Vgl. BVerfGE 40, 296 [314, 316] = NJW 1975, 2331; BVerfGE 76, 256 [341] = NVwZ 1988, 329.
[6] Leitbild der repräsentativen Demokratie ist auch heute nicht der dem beruflichen Leben entfremdete Politfunktionär, sondern der in ihm verwurzelte Mitbürger, der das parlamentarische Mandat nur auf Zeit wahrnimmt, Klein, Beruf und Mandat, FAZ vom 08.08.2006, S. 7.
[7] Klein, Beruf und Mandat, FAZ vom 08.08.2006, S, das GG hält in Art. 38 Abs. 1 S. 2 an der Freiheit des die sei Einführung der Repräsentativverfassung zu deren wesentlichen Merkmalen gehört. Die Freiheit des Mandats ist auch in der Parteiendemokratie unabdingbar. Sie begrenzt den Einfluss der Parteien auf den Abgeordneten und damit im Parlament. Das freie Mandat verpflichtet und erlaubt dem Abgeordneten selbstständige Meinungsbildung Er ist dem Volk gegenüber persönlich verantwortlich.
[8] Wie bereits BVerfGE 76, 256 [341f.] = NVwZ 1988, 329.
[9] Vgl. BVerfGE 56, 396 [405] = NJW 1981, 1831.
[10] Lebendigkeit und Offenheit des Willensbildungsprozesses in Fraktionen und Parlament sind zu gewährleisten. Diese Funktionen sind umso wirksamer, je weniger die Abgeordneten ausschließlich von ihrem Mandatseinkommen leben. … Ob sich ein Abgeordneter ausschließlich auf die Ausübung seines Mandats konzentriert oder ob er sich daneben noch eine Beschäftigung sucht, ist vom Verfassungsrecht in die alleinige Verantwortung des Mandatsträgers gestellt. Die Entschädigung, die er enthält, muss so bemessen sein, dass er diese Entscheidung in voller Freiheit treffen kann, Klein, FAZ. vom 08.08.2006, S. 7.
[11] Vgl. BVerfGE 32, 157 [164] = NJW 1972, 285.
[12] Vgl. auch BVerfGE 40, 296 [318f.] = NJW 1975, 2331.
[13] Vgl. BVerfGE 40, 296 [312] = NJW 1975, 2331.
[14] Vgl. BVerfGE 94, 351 [365] = NJW 1996, 2720; BVerfGE 99, 19 [29] = NJW 1998, 3042.
[15] Vgl. BVerfGE 99, 19 [32] = NJW 1998, 3042. Krit. Klein, aaO. – bedenklich ist, wenn der Abgeordnete durch die Verhaltensregeln verpflichtet wird, die Höhe seiner Erwerbseinkünfte dem Präsidenten des Deutschen Bundestages mitzuteilen, die dieser dann in gewissem Umfang auch noch zu veröffentlichen hat, was unvermeidlich Neidkomplexe schürt und den Abgeordneten entgegen den Absichten der Verfassung unter Druck setzt, seine Erwerbstätigkeit aufzugeben oder zu verringern. Ein Interesse der Parlamentsspitze oder der Öffentlichkeit zu wissen, was ein Abgeordneter verdient, ist nicht erkennbar. Der Inhaber eines parlamentarischen Mandats geht mit dessen Übernahme nicht seiner Persönlichkeitsrechte verlustig.
[16] Vgl. Benda/Landfried, Politik als Beruf, FAZ vom 06.06.2008, Nr. 130, S. 8 - billige Abgeordnete sollte sich eine repräsentative Demokratie nicht leisten. Denn Abgeordnete sind Vertreter des ganzen Volkes. Sie repräsentieren nicht allein die Partei, die sie nominiert hat, oder die Wähler, die ihnen ihre Stimme gegeben haben. Als gewählte Mitglieder des Bundestags haben sie die einzigartige Aufgabe, in einem kontinuierlichen Austausch mit den Bürgern die gesellschaftlichen Probleme zu erkennen und Lösungen zu finden, die für alle Bürger mit ihren unterschiedlichen Interessen, Wertvorstellungen und Bedürfnissen verbindlich und zugleich anerkennungswürdig sind. Dieser Verantwortung können die Abgeordneten nur gerecht werden, wenn die Bürger ihnen vertrauen und Wertschätzung entgegenbringen. Die öffentliche Diskussion über die Frage angemessener Diäten ist notwendig und kein zu vermeidendes Übel. Nur ein Austausch der Argumente in der Öffentlichkeit kann langfristig dazu beitragen, die skizzierten Missverständnisse zwischen Bürgern und Abgeordneten aufzuklären. "Politik als Beruf" - so brachte der Soziologe Max Weber diese Entwicklung schon 1919 auf den Punkt. Der Abgeordnete behält freilich mit seinem Mandat eine Sonderstellung im Vergleich zu anderen Berufen. Die Wähler haben ihm eine verantwortungsvolle Aufgabe anvertraut. Der Abgeordnete ist weder Beamter noch Richter. Er ist Vertreter des ganzen Volkes. Aus diesem Grund kann für eine angemessene Höhe der Diäten die Anknüpfung an die Einkommen vergleichbarer Berufe nur ein Indikator unter anderen sein.
[17] Vgl. BVerfGE 98, 145 [161] = NJW 1999, 1095.
[18] Vgl. BVerfGE 40, 296 [318] = NJW 1975, 2331; BVerfGE 80, 188 [220ff.] = NJW 1990, 373; BVerfGE 93, 195 [204] = NVwZ 1996, 1197; BVerfGE 112, 118 [133] = NJW 2005, 203.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet das "freie Mandat" eines Abgeordneten?
Gemäß Art. 38 GG ist ein Abgeordneter an keine Aufträge oder Weisungen gebunden und nur seinem Gewissen unterworfen.
Warum müssen Bundestagsabgeordnete ihre Nebeneinkünfte offenlegen?
Die Offenlegung dient der Transparenz, damit Wähler mögliche Interessenverknüpfungen und Abhängigkeiten ihrer Vertreter erkennen können.
Dürfen Abgeordnete neben ihrem Mandat einen Beruf ausüben?
Ja, das Grundgesetz lässt die Berufsausübung zu, jedoch muss das parlamentarische Mandat im Mittelpunkt der Tätigkeit stehen.
Ab welcher Höhe sind Einkünfte anzeigepflichtig?
Anzeigepflichtig sind Einkünfte aus Nebentätigkeiten, wenn sie bestimmte Mindestbeträge (z. B. 1000 Euro im Monat oder 10.000 Euro im Jahr) überschreiten.
Wie werden Verstöße gegen die Offenlegungspflichten geahndet?
Der Gesetzgeber kann Sanktionen festlegen, um die Funktionsfähigkeit des Parlaments und die Gleichbehandlung aller Abgeordneten sicherzustellen.
- Citar trabajo
- Prof. Dr. Dr. Assessor jur., Mag. rer. publ. Siegfried Schwab (Autor), 2009, Offenlegung von Einkünften der Bundestagsabgeordneten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139349