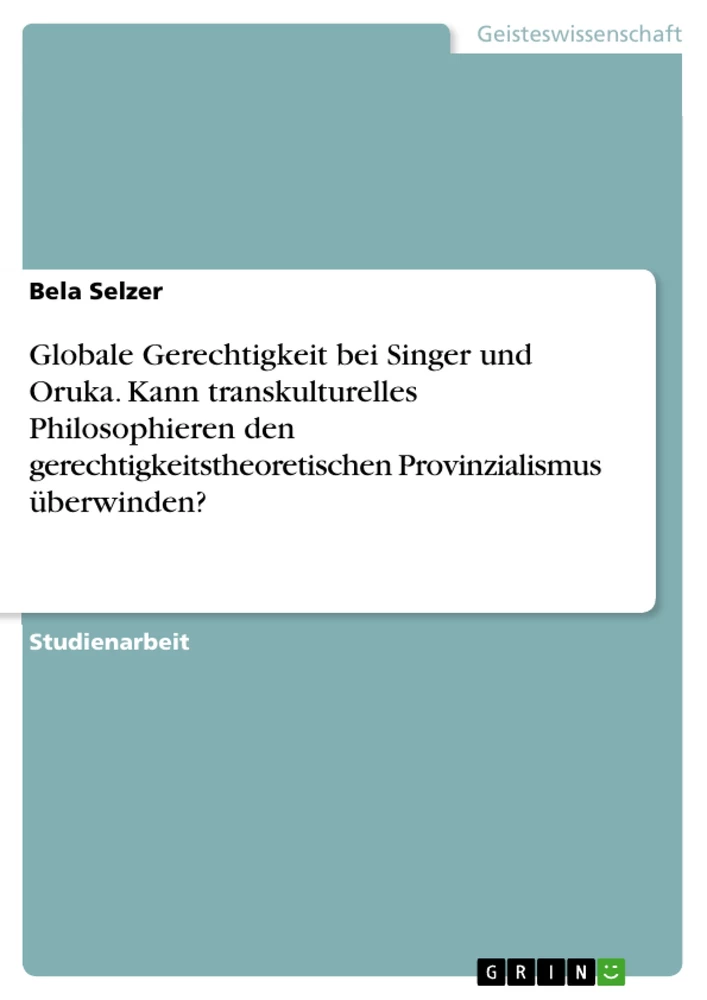Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit der globalen Gerechtigkeit nach Peter Singer und Odera Oruka und der Frage, inwieweit transkulturelles Philosophieren den gerechtigkeitstheoretischen Provinzialismus überwinden kann.
Der gegenwärtige Zustand der abendländischen Philosophie lässt sich unter Heranziehung des Gleichnisses vom Brunnenfrosch veranschaulichen, in welchem der chinesische Philosoph Chuang Tzu (369 vor Christus) von einem Frosch in einem Brunnen berichtet, der nur einen kleinen, runden Teil des Himmels sehen kann. Indem der Frosch diesen Ausschnitt des Himmels mit dem ganzen Himmel verwechselt, setzt er seine eigene begrenzte Perspektive absolut. Es ist die irrtümliche Gleichsetzung des Perspektivischen mit dem Absoluten, die Erhöhung einer relativen Sichtweise zu einer normativen Sichtweise, mit welcher zwangsläufig ein Ausschluss alternativer Blickwinkel auf den Himmel einhergeht.
Indem die einseitige Froschperspektive der Gegenwartsphilosophie unser Verständnis, unseren Blick auf die Welt und auf den Menschen auf eine eurozentrische Sicht reduziert, erfüllt sie ihren Anspruch nach der Suche universaler Erkenntnis oder allgemeingültiger Aussagen nicht. Insbesondere unter Berücksichtigung der ökonomischen, politischen und ökologischen Interdependenz der Welt bedarf es einer Gegenwartsphilosophie, die der kulturellen, sozialen und politischen Pluralität der Lebenswelten gerecht wird. Denn nur wenn möglichst viele heterogene Stimmen gehört, wahrgenommen und einbezogen werden, kann die Philosophie globalen Herausforderungen begegnen und diesen letztlich mit Lösungsansätzen entgegentreten, die der Interdependenz der gesamten Welt - und nicht nur der westlichen - Rechnung tragen.
Folglich versteht sich die vorliegende Arbeit als Beitrag zum noch jungen Projekt der Interkulturellen Philosophie , das „auf einer Philosophie des Aufsuchens gründet, die uns Menschen ein neues Mitsein ohne jeglichen exklusiven normativen Gehalt verspricht.“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Froschperspektive der abendländischen Philosophie
- Der anglo-amerikanische Provinzialismus in der globalen Gerechtigkeitstheorie
- Globale Gerechtigkeit bei Peter Singer: Die Pflicht den Armen zu helfen
- Die,,Kind im Teich\"- Allegorie
- Der Begriff der Armut und distributive Gerechtigkeit bei Peter Singer
- Die Hilfsrhetorik gegenüber dem Empfängersubjekt als „,epistemic objectification”
- Odera Oruka und das Recht auf ein menschliches Minimum
- Odera Orukas Philosophieverständnis
- Das Recht auf ein menschliches Minimum
- Eine moralische Verpflichtung zur Entwicklungshilfe: Peter Singer und Odera Oruka im Dialog
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern transkulturelles Philosophieren den gerechtigkeitstheoretischen Provinzialismus überwinden kann. Sie untersucht die Grenzen der eurozentrischen Froschperspektive der gegenwärtigen Philosophie anhand der Debatte um globale Gerechtigkeit und analysiert die ungleiche Repräsentation von Theorien aus dem anglo-amerikanischen Raum und dem „globalen Süden“.
- Kritik an der eurozentrischen Perspektive in der Philosophie
- Untersuchung der Rolle des transkulturellen Philosophierens in der Debatte um globale Gerechtigkeit
- Analyse der Theorien von Peter Singer und Odera Oruka im Kontext der globalen Gerechtigkeit
- Bewertung des Konzepts der „epistemic objectification“ von Miranda Fricker im Zusammenhang mit der globalen Gerechtigkeitstheorie
- Diskussion der Bedeutung von Inklusion und Diversität in der Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel führt in die Problematik des eurozentrischen Provinzialismus in der Philosophie ein und stellt die Bedeutung des transkulturellen Philosophierens für die Debatte um globale Gerechtigkeit heraus.
- Globale Gerechtigkeit bei Peter Singer: Das Kapitel analysiert Singers Konzept der globalen Gerechtigkeit anhand seines Essays „Hunger, Wohlstand und Moral“. Es beleuchtet die „Kind im Teich“-Allegorie und diskutiert Singers Definition von Armut und distributive Gerechtigkeit.
- Odera Oruka und das Recht auf ein menschliches Minimum: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem afrikanischen Philosophen Odera Oruka und seinem Konzept des Rechts auf ein menschliches Minimum. Es stellt Orukas philosophische Positionierung vor und untersucht seine Argumentation für eine moralische Verpflichtung zur Entwicklungshilfe.
Schlüsselwörter
Transkulturelles Philosophieren, globale Gerechtigkeit, Provinzialismus, Eurozentrismus, „epistemic objectification”, Peter Singer, Odera Oruka, Entwicklungshilfe, Armut, Menschliches Minimum, Diversität, Inklusion.
Häufig gestellte Fragen
Was kritisiert die Arbeit an der abendländischen Philosophie?
Sie kritisiert einen „eurozentrischen Provinzialismus“ (Froschperspektive), der westliche Sichtweisen als absolut setzt und alternative globale Blickwinkel ausschließt.
Was besagt Peter Singers „Kind im Teich“-Allegorie?
Singer argumentiert, dass wir eine moralische Pflicht zur Hilfe haben, wenn wir Leid verhindern können, ohne etwas von vergleichbarer moralischer Bedeutung zu opfern – so wie man ein ertrinkendes Kind aus einem Teich retten würde.
Wer war Odera Oruka und was forderte er?
Odera Oruka war ein afrikanischer Philosoph, der das „Recht auf ein menschliches Minimum“ forderte und Entwicklungshilfe als moralische Verpflichtung begründete.
Was bedeutet „epistemic objectification“?
Der von Miranda Fricker geprägte Begriff beschreibt, wie Empfängersubjekte von Hilfe (z.B. Menschen in armen Ländern) in der Theorie oft nur als Objekte und nicht als gleichwertige Wissenssubjekte wahrgenommen werden.
Was ist das Ziel der Interkulturellen Philosophie?
Ziel ist ein transkultureller Dialog, der die Pluralität der Lebenswelten anerkennt und globale Herausforderungen durch die Einbeziehung heterogener Stimmen löst.
- Arbeit zitieren
- Bela Selzer (Autor:in), 2023, Globale Gerechtigkeit bei Singer und Oruka. Kann transkulturelles Philosophieren den gerechtigkeitstheoretischen Provinzialismus überwinden?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1395237