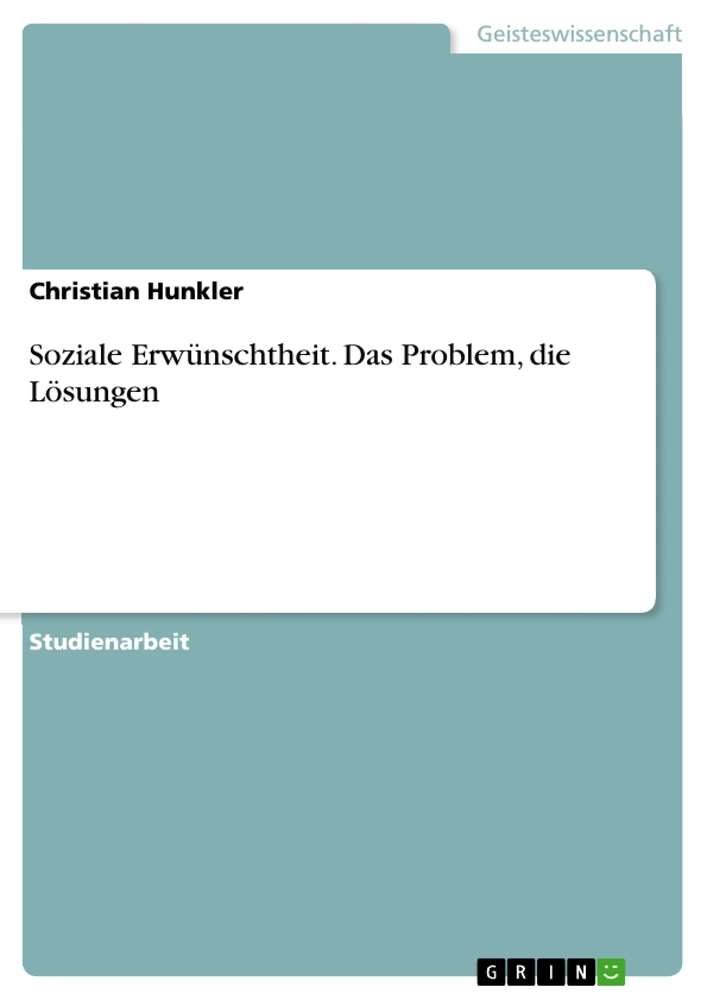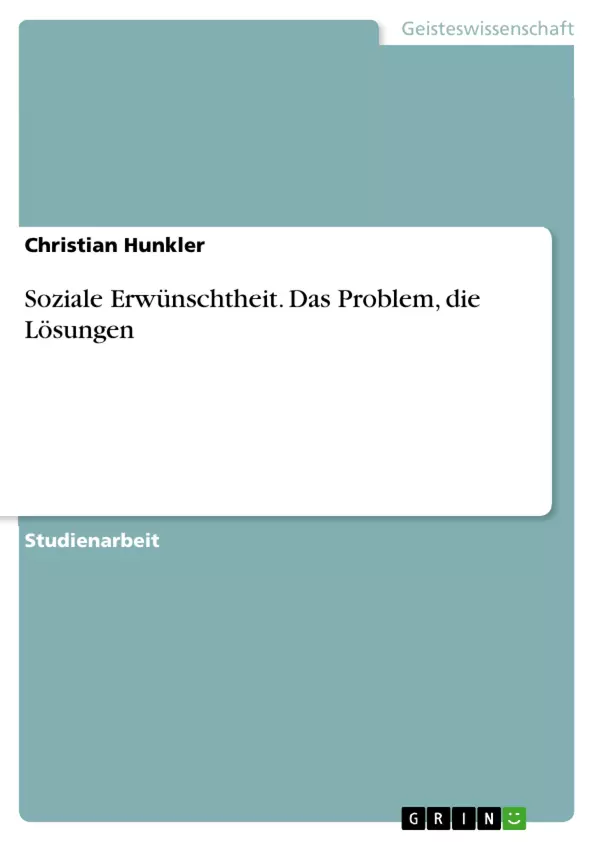Um die in der Literatur vorgeschlagenen Lösungswege adäquat bewerten zu können muss zunächst genauer definiert werden, was unter sozialer Erwünschtheit zu verstehen ist, welche Auswirkungen das Vorliegen von sozialer Erwünschtheit auf die Messung von latenten Konstrukten hat (was also genau das Problem ist) und unter welchen Umständen mit Verzerrungen durch soziale Erwünschtheit zu rechnen ist. Diese Fragestellungen werden in Abschnitt 2 „das Problem“ behandelt, vor allem die konkurrierenden Thesen zur Entstehung dieser Verzerrungen. Einerseits werden persönliche Eigenschaften als Ursache herangezogen; andere Autoren sehen Item-spezifische Unterschiede zur Erklärung heran und drittens werden situationale Faktoren als Erklärung für Verzerrungen herangezogen. Im dritten Abschnitt erfolgt dann ein Überblick über verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Generell kann man eine Lösung in der Konstruktion von Messinstrumenten sehen, die den Einfluss von SD-Verzerrungen von vorneherein minimieren bzw. ausschließen. Ein anderer Weg ist der Versuch, die Verzerrungen zu quantifizieren, um sie so „herausrechnen“ zu können. Die Messung von SD-Verzerrungen ist notwendige Bedingung für beide Arten der Lösung. Für die erste Lösung muss in einer Art Erfolgskontrolle sichergestellt werden, dass wirklich keine SD-Verzerrungen miterfasst werden. Für den zweiten Weg ist die Messung und damit die Erklärung des Zustandekommens von Verzerrungen durch soziale Erwünschtheit zentral, da nur auf Basis dieses Wissens der wahre Wert aus den tatsächlichen Antworten „errechnet“ werden kann. Zusammenfassend sollen im zweiten Abschnitt also verschiedene teilweise konkurrierende theoretische Annahmen über die Entstehungsbedingungen von SD-Verzerrungen gegenübergestellt werden. Im dritten Abschnitt werden dann darauf basierende Modelle der Erklärung des SD-Biases verglichen. Im vierten Abschnitt werden die Vor- bzw. Nachteile der erläuterten Modelle bzw. Lösungsvorschläge diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Problem
- 2.1 Definitionen
- 2.2 Systematisierung der verschiedenen Ansätze
- 2.2.1 Persönliche Prädisposition (Need for social Approval; kurz NSA)
- 2.2.2 Item Charakteristik (Trait Desirability; kurz TD)
- 2.2.3 Situationaler Ansatz – die Einflüsse der Interviewsituation
- 2.3 Das eigentliche Problem: möglicherweise falsche Ergebnisse
- 2.4.1 Auswirkungen auf die Validität von Messinstrumenten
- 2.4.2 Mögliche Auswirkungen auf die Reliabilität
- 2.4.3 Resultierende falsche Ergebnisse
- 2.4 Nachweis bzw. Entdeckung von Verzerrungen durch soziale Erwünschtheit
- 3. Die Lösung(en)?!
- 3.1 Skalen zur Erfassung des „Need for social approval“: die Marlowe-Crowne Skala
- 3.2 Techniken, die soziale Erwünschtheit nicht miterfassen
- 3.2.1 Der Implicit Association Test
- 3.2.2 Randomized Response Technique
- 3.2.3 Begrenzte Möglichkeiten dieser Techniken
- 3.3 Ein theoriegeleiteter „,mehrdimensionaler“ Ansatz für SD-Verzerrungen
- 4. Fazit & Ausblick
- 5. Literatur
- 6. Nicht zitierte Literatur
- 7. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Problem der sozialen Erwünschtheit in quantitativen Forschungsmethoden. Ziel ist es, verschiedene Definitionen und theoretische Ansätze zur Entstehung von Antwortverzerrungen durch soziale Erwünschtheit zu analysieren und Lösungsansätze kritisch zu bewerten.
- Definition und Systematisierung von sozialer Erwünschtheit
- Auswirkungen auf die Validität und Reliabilität von Messinstrumenten
- Konkurrierende Theorien zur Entstehung von Verzerrungen (persönliche Prädisposition, Item-Charakteristik, situative Faktoren)
- Bewertung verschiedener Methoden zur Erfassung und Minimierung von sozialer Erwünschtheit
- Diskussion der Vor- und Nachteile verschiedener Lösungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Antwortverzerrungen durch soziale Erwünschtheit (SD-Bias) in quantitativen Forschungsmethoden ein. Sie hebt die Bedeutung des Problems hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Fokus liegt auf der Definition von sozialer Erwünschtheit, den Auswirkungen auf Messungen und der kritischen Auseinandersetzung mit Lösungsansätzen. Die Einleitung betont die Notwendigkeit einer präzisen Definition und die Notwendigkeit, konkurrierende Erklärungsansätze für die Entstehung von SD-Verzerrungen zu untersuchen.
2. Das Problem: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem Problem der sozialen Erwünschtheit. Es analysiert verschiedene Definitionen aus der Literatur und systematisiert die verschiedenen Erklärungsansätze. Die konkurrierenden Theorien zur Entstehung von Verzerrungen werden präsentiert: persönliche Prädisposition (Need for Social Approval), Item-Charakteristik (Trait Desirability) und situative Faktoren. Das Kapitel erläutert die Auswirkungen von sozialer Erwünschtheit auf die Validität und Reliabilität von Messinstrumenten und zeigt an Beispielen, wie Antwortverzerrungen die Ergebnisse verfälschen können. Es wird deutlich, dass die Operationalisierung einzelner Entstehungsbedingungen oft nur zur Entdeckung, nicht aber zur sicheren Erklärung und zum Nachweis von Verzerrungen führt.
Schlüsselwörter
Soziale Erwünschtheit, Antwortverzerrung, SD-Bias, Validität, Reliabilität, Messinstrumente, quantitative Forschung, Need for Social Approval, Trait Desirability, Interviewsituation, Marlowe-Crowne Skala, Implicit Association Test, Randomized Response Technique.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Soziale Erwünschtheit in quantitativen Forschungsmethoden
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Problem der sozialen Erwünschtheit (sozial erwünschtes Antwortverhalten) in quantitativen Forschungsmethoden. Der Fokus liegt auf der Definition, den Ursachen und den Auswirkungen auf die Validität und Reliabilität von Messergebnissen sowie auf der kritischen Bewertung verschiedener Lösungsansätze.
Welche Definitionen und Theorien zur sozialen Erwünschtheit werden behandelt?
Die Arbeit analysiert verschiedene Definitionen von sozialer Erwünschtheit aus der Literatur und systematisiert konkurrierende Erklärungsansätze. Diese umfassen den Ansatz der persönlichen Prädisposition ("Need for Social Approval", kurz NSA), die Item-Charakteristik ("Trait Desirability", kurz TD) und situative Faktoren, die die Interviewsituation beeinflussen.
Welche Auswirkungen hat soziale Erwünschtheit auf Forschungsergebnisse?
Soziale Erwünschtheit führt zu Antwortverzerrungen, die die Validität und Reliabilität von Messinstrumenten beeinträchtigen. Die Arbeit zeigt anhand von Beispielen, wie diese Verzerrungen zu falschen Forschungsergebnissen führen können. Die Operationalisierung einzelner Entstehungsbedingungen dient oft nur zur Entdeckung, nicht aber zur sicheren Erklärung und zum Nachweis von Verzerrungen.
Welche Methoden zur Erfassung und Minimierung sozialer Erwünschtheit werden diskutiert?
Die Arbeit bewertet verschiedene Methoden zur Erfassung und Minimierung sozialer Erwünschtheit. Dazu gehören Skalen wie die Marlowe-Crowne Skala zur Erfassung des "Need for Social Approval", sowie Techniken wie der Implicit Association Test und die Randomized Response Technique. Die Arbeit diskutiert auch die Grenzen dieser Techniken.
Gibt es einen umfassenden Ansatz zur Behandlung von Verzerrungen durch soziale Erwünschtheit?
Die Arbeit schlägt einen theoriegeleiteten, "mehrdimensionalen" Ansatz zur Behandlung von Verzerrungen durch soziale Erwünschtheit vor, der die verschiedenen Erklärungsansätze berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Soziale Erwünschtheit, Antwortverzerrung, SD-Bias, Validität, Reliabilität, Messinstrumente, quantitative Forschung, Need for Social Approval, Trait Desirability, Interviewsituation, Marlowe-Crowne Skala, Implicit Association Test, Randomized Response Technique.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Problem der sozialen Erwünschtheit, ein Kapitel zu Lösungsansätzen, ein Fazit und einen Ausblick, sowie Literaturangaben und einen Anhang. Die einzelnen Kapitel werden im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeführt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist die Analyse verschiedener Definitionen und theoretischer Ansätze zur Entstehung von Antwortverzerrungen durch soziale Erwünschtheit und die kritische Bewertung von Lösungsansätzen. Die Arbeit systematisiert die verschiedenen Ansätze und diskutiert deren Vor- und Nachteile.
- Citation du texte
- Christian Hunkler (Auteur), 2002, Soziale Erwünschtheit. Das Problem, die Lösungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13965