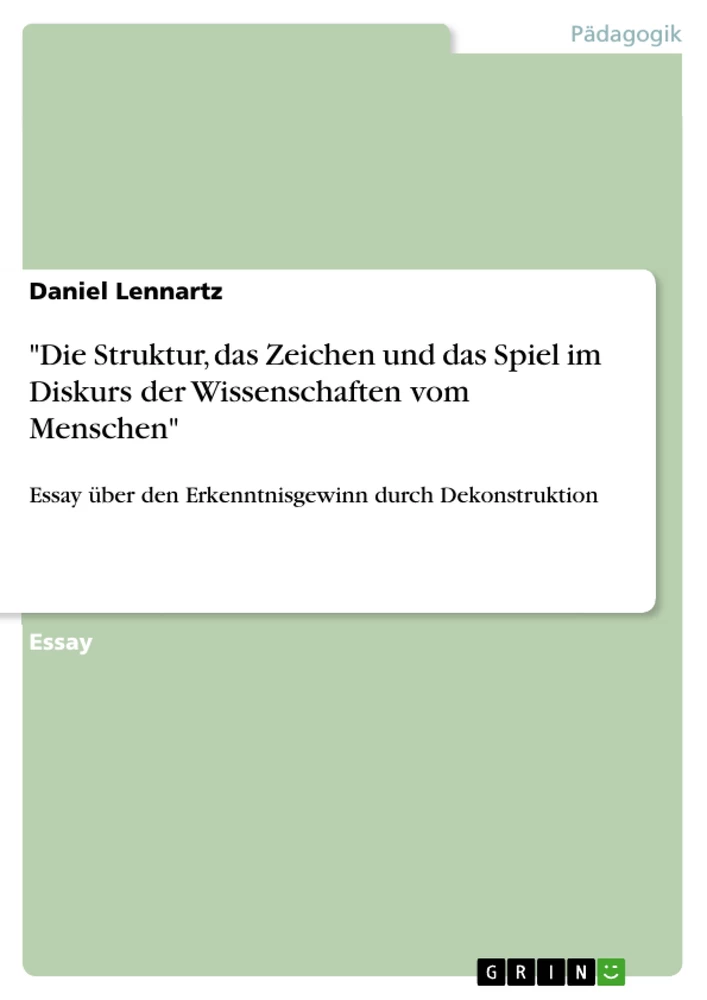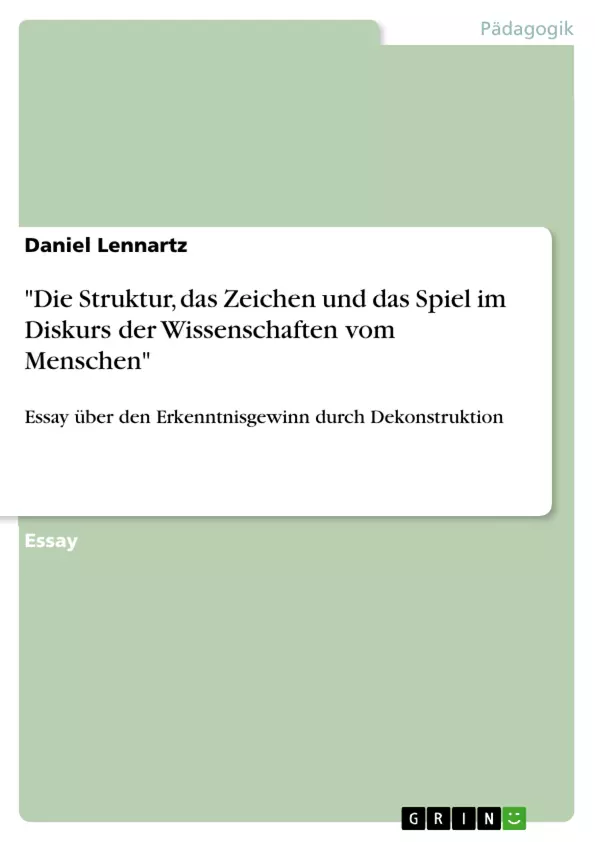Dekonstruktion, Jaques Derrida, Claude Levi-Strauss
[...]
Jaques Derrida spricht im Text „Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen“ von S. 114 –S. 139 von der Geschichte der Begriffe, einem bestimmten Ereignis in dieser Geschichte, den Derrida als Bruch bezeichnet und welche Bedeutung dies für jede Kritik bestehender Gegebenheiten hat. Dazu setzt sich Derrida dekonstruktiv mit den Texten Claude Lévi-Strauss‘ auseinander.
Mit der Strukturalität verweist Derrida zu Beginn des Textes darauf, dass Begriffe keineswegs festgeschrieben und starr sind, sondern auch selbst veränderlich sind. Jeder Begriff hat eine gewisse Struktur, d.h. Ordnung der Elemente, welche den Begriff ausmachen bzw. den Sinn herstellen. Diese Elemente sind beweglich und führen zu der Veränderlichkeit der Begriffe.
Strukturalität meint diese Veränderlichkeit der Begriffe.[...]
Inhaltsverzeichnis
- Die Strukturalität
- Das Zentrum
- Das Signifikat und der Signifikant
- Das Ereignis
- Die Sprache
- Gefangen im Zirkel
- Die Sprache verlangt nach ihrer eigenen Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert Jacques Derridas Auseinandersetzung mit der Struktur, dem Zeichen und dem Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen. Derrida dekonstruiert die Vorstellung von einem Zentrum in der Struktur und untersucht die Folgen dieser Dezentrierung für das Denken und die Sprache.
- Dekonstruktion des Begriffs der Struktur
- Die Rolle des Zentrums in der Struktur
- Das Verhältnis von Signifikant und Signifikat
- Die Sprache als Produzent von Sinnzusammenhängen
- Der Zirkel der Kritik und die Metaphysik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Strukturalität: Derrida argumentiert, dass Begriffe nicht starr und unveränderlich sind, sondern eine Struktur besitzen, die selbst veränderlich ist. Diese Veränderlichkeit der Begriffe bezeichnet er als Strukturalität. Er legt den Grundstein für seine spätere Kritik an der Vorstellung eines Zentrums in der Struktur, indem er die Dynamik und Beweglichkeit der begrifflichen Elemente betont. Die scheinbare Ordnung der Elemente ist also nicht statisch, sondern unterliegt einem ständigen Prozess der Veränderung und Neugruppierung.
Das Zentrum: Derrida beleuchtet die traditionelle Vorstellung von Struktur in der abendländischen Philosophie, die ein Zentrum als Ordnungsinstanz postuliert. Dieses Zentrum verleiht der Struktur einen festen Ursprung und begrenzt das Spiel der Elemente. Derrida zeigt jedoch das Paradoxon auf, dass dieses Zentrum sich gleichzeitig innerhalb und außerhalb der Struktur befinden müsste, was seine feste und unveränderliche Natur in Frage stellt. Die Vorstellung eines solchen Zentrums ist zentral für seine nachfolgende Kritik.
Das Signifikat und der Signifikant: Derrida erklärt den Unterschied zwischen Signifikat (Bezeichnetes) und Signifikant (Bezeichnendes) und analysiert, wie zentrierte Begriffe in der abendländischen Philosophie funktionieren. Diese zentrierten Begriffe führen dazu, dass Substitutionen, Transformationen und Permutationen immer wieder auf einen vermeintlichen wahren Sinn, das Sein oder die Präsenz, reduziert werden. Er kritisiert die Archäologie als ein Beispiel für eine Wissenschaft, die auf diese Weise arbeitet.
Das Ereignis: Dieser Abschnitt beschreibt den Bruch in der Geschichte des Begriffs der Struktur, der mit dem Beginn des Nachdenkens über die Strukturalität einhergeht. Derrida argumentiert, dass das Zentrum nicht als feste Größe, sondern als eine Funktion verstanden werden muss, in der ein unendlicher Austausch von Zeichen stattfindet. Die Existenz eines statischen Zentrums wird dadurch verneint. Die Epoche von Nietzsche, Freud und Heidegger wird als relevant für diesen Wandel genannt.
Die Sprache: Derrida betont die Rolle der Sprache bei der Produktion von Sinnzusammenhängen (Diskurs). Er verwendet das Beispiel des Begriffs „Ausländerflut“, um zu veranschaulichen, wie Sprache bestimmte Vorstellungen und Machtstrukturen erzeugt und reproduziert. Die Sprache als Mittel der Kommunikation schafft zentrierte Begriffe, die Grundlage der Kommunikation sind. Dies zeigt die Verflechtung von Sprache, Denken und Machtstrukturen auf.
Gefangen im Zirkel: Derrida analysiert Lévi-Strauss' Versuch, den Gegensatz zwischen Sinnlichkeit und Intelligibilität zu überwinden. Er kritisiert diese Strategie, da das Zeichen selbst auf diesem Gegensatz beruht. Er argumentiert, dass die Aufhebung der Differenz zwischen Signifikant und Signifikat zur Auflösung des Begriffs Signifikant führen würde. Er zeigt auf, wie Nietzsche, Freud und Heidegger trotz ihrer Kritik an der Metaphysik in deren Denkstrukturen gefangen bleiben.
Die Sprache verlangt nach ihrer eigenen Kritik: Derrida untersucht die Qualität des Diskurses im Verhältnis zur Geschichte und zur Metaphysik und beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der Verwendung metaphysischer Begriffe für die Kritik der Metaphysik ergeben. Die Ethnologie wird als Beispiel für eine Wissenschaft angeführt, die trotz ihrer Intention, sich von Ethnozentrismus zu lösen, in den gleichen Zirkel der metaphysischen Denkstrukturen gerät.
Schlüsselwörter
Dekonstruktion, Strukturalität, Zentrum, Signifikant, Signifikat, Metaphysik, Sprache, Diskurs, Zeichen, Ereignis, Lévi-Strauss, Nietzsche, Freud, Heidegger, Ethnologie, Archäologie.
Häufig gestellte Fragen zu Derridas Dekonstruktion
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text analysiert Jacques Derridas Auseinandersetzung mit der Struktur, dem Zeichen und dem Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen. Derrida dekonstruiert die Vorstellung von einem Zentrum in der Struktur und untersucht die Folgen dieser Dezentrierung für das Denken und die Sprache. Schwerpunkte sind die Dekonstruktion des Strukturbegriffs, die Rolle des Zentrums, das Verhältnis von Signifikant und Signifikat, die Sprache als Sinnproduzent, und der Zirkel der Kritik und die Metaphysik.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in ihnen?
Der Text gliedert sich in die Kapitel "Die Strukturalität", "Das Zentrum", "Das Signifikat und der Signifikant", "Das Ereignis", "Die Sprache", "Gefangen im Zirkel" und "Die Sprache verlangt nach ihrer eigenen Kritik". Jedes Kapitel untersucht einen Aspekt von Derridas Dekonstruktion, beginnend mit der Analyse der Veränderlichkeit von Begriffen (Strukturalität) über die Kritik an der Vorstellung eines Zentrums in der Struktur bis hin zur Rolle der Sprache in der Produktion von Sinn und den Herausforderungen der Selbstkritik des Diskurses.
Was versteht Derrida unter Strukturalität?
Derrida argumentiert, dass Begriffe keine starren, unveränderlichen Einheiten sind, sondern eine Struktur besitzen, die selbst veränderlich ist. Diese Veränderlichkeit bezeichnet er als Strukturalität. Er betont die Dynamik und Beweglichkeit begrifflicher Elemente, wodurch die scheinbare Ordnung nicht statisch, sondern einem ständigen Prozess der Veränderung und Neugruppierung unterliegt.
Welche Rolle spielt das Zentrum in Derridas Analyse?
Derrida kritisiert die traditionelle Vorstellung eines Zentrums in der Struktur als Ordnungsinstanz. Dieses Zentrum verleiht der Struktur einen festen Ursprung und begrenzt das Spiel der Elemente. Derrida zeigt jedoch das Paradoxon auf, dass sich dieses Zentrum gleichzeitig innerhalb und außerhalb der Struktur befinden müsste, was seine vermeintliche Unveränderlichkeit in Frage stellt.
Wie beschreibt Derrida das Verhältnis von Signifikant und Signifikat?
Derrida analysiert den Unterschied zwischen Signifikat (Bezeichnetes) und Signifikant (Bezeichnendes) und kritisiert, wie zentrierte Begriffe in der abendländischen Philosophie zu einer Reduktion von Substitutionen, Transformationen und Permutationen auf einen vermeintlichen wahren Sinn führen. Er sieht die Archäologie als Beispiel für eine Wissenschaft, die auf diese Weise arbeitet.
Welche Bedeutung hat das Ereignis in Derridas Denken?
Derrida beschreibt den Bruch in der Geschichte des Strukturbegriffs als "Ereignis". Das Zentrum wird nicht als feste Größe, sondern als Funktion verstanden, in der ein unendlicher Austausch von Zeichen stattfindet. Die Epoche von Nietzsche, Freud und Heidegger wird als relevant für diesen Wandel genannt.
Welche Rolle spielt die Sprache in Derridas Analyse?
Derrida betont die Rolle der Sprache bei der Produktion von Sinnzusammenhängen (Diskurs). Er zeigt, wie Sprache Vorstellungen und Machtstrukturen erzeugt und reproduziert (Beispiel: "Ausländerflut"). Die Sprache als Kommunikationsmittel schafft zentrierte Begriffe, die Grundlage der Kommunikation sind, und verdeutlicht die Verflechtung von Sprache, Denken und Machtstrukturen.
Was ist der "Zirkel der Kritik" und wie wird er von Derrida analysiert?
Derrida analysiert Lévi-Strauss' Versuch, den Gegensatz zwischen Sinnlichkeit und Intelligibilität zu überwinden, und kritisiert diese Strategie, da das Zeichen selbst auf diesem Gegensatz beruht. Er zeigt auf, wie Nietzsche, Freud und Heidegger trotz ihrer Kritik an der Metaphysik in deren Denkstrukturen gefangen bleiben.
Wie versteht Derrida die Selbstkritik der Sprache?
Derrida untersucht den Diskurs im Verhältnis zur Geschichte und Metaphysik und die Herausforderungen, die sich aus der Verwendung metaphysischer Begriffe für die Kritik der Metaphysik ergeben. Die Ethnologie wird als Beispiel angeführt, das trotz der Intention, sich von Ethnozentrismus zu lösen, in metaphysische Denkstrukturen gerät.
Welche Schlüsselwörter sind für das Verständnis des Textes wichtig?
Schlüsselwörter sind Dekonstruktion, Strukturalität, Zentrum, Signifikant, Signifikat, Metaphysik, Sprache, Diskurs, Zeichen, Ereignis, Lévi-Strauss, Nietzsche, Freud, Heidegger, Ethnologie und Archäologie.
- Quote paper
- Daniel Lennartz (Author), 2008, "Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139673