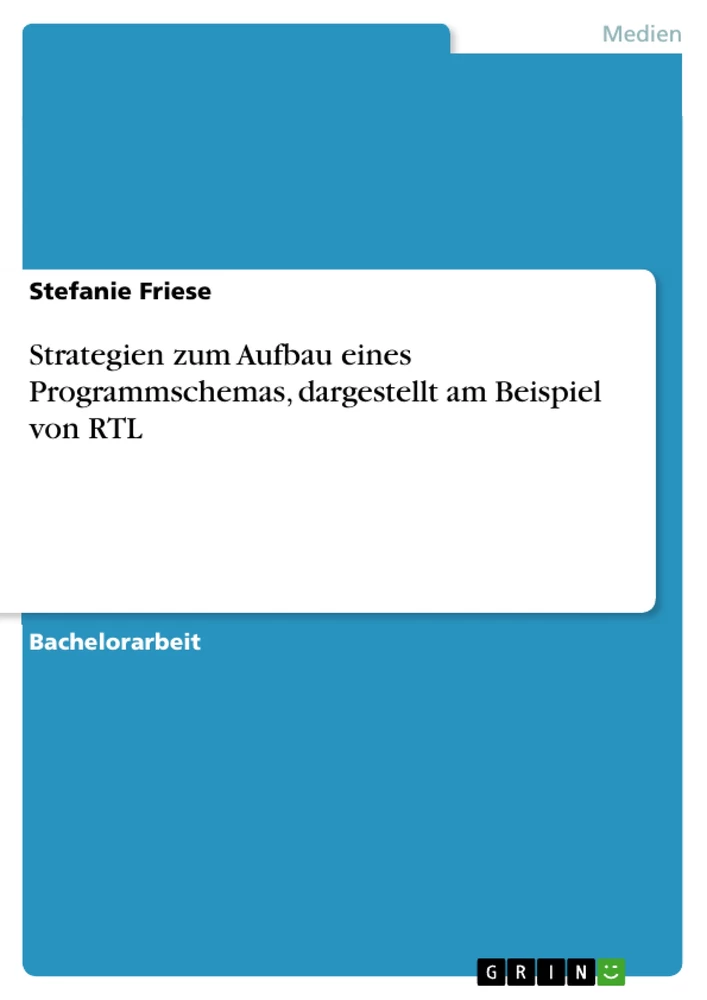Warum läuft „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ seit 16 Jahren immer montags bis freitags um 19.40 Uhr auf RTL? Warum laufen an Feiertagen gleich mehrere gute Spielfilme und an einem gewöhnlichen Wochentag so gut wie gar keine? Und warum beginnt eigentlich das Abendprogramm auf allen Sendern um 20.15 Uhr?
Das Programmschema nimmt im werbefinanzierten Fernsehen eine bedeutende Rolle ein. Die Struktur des Programmangebotes beeinflusst nicht nur die Attraktivität und die Akzeptanz einer einzelnen Sendung, sondern entscheidet zugleich über den wirtschaftlichen Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit eines privaten Fernsehsenders.
Die vorliegende Arbeit setzt sich damit auseinander, wie das Programmschema eines Privatsenders strukturiert sein muss, um einen möglichst hohen Marktanteil zu erreichen und dementsprechend hohe Einnahmen aus dem Werbemarkt erzielen zu können.
Um mit dem eigenen Programm die Aufmerksamkeit möglichst vieler Zuschauer für sich zu gewinnen, müssen die Programmplaner verschiedenste Faktoren berücksichtigen. Es wird erklärt, warum das Programm auf die Bedürfnisse der Zuschauer und deren Tagesrhythmus angepasst werden muss, welche senderinternen und –externen Gegebenheiten beachtet werden müssen, und warum die Programmumgebung ausschlaggebend für die Zuschauerbindung ist. Dazu werden die Strategien für die Platzierung eines Formates vorgestellt, die die Programmplaner anwenden, um die Programmwahl zu ihren Gunsten zu beeinflussen und gezeigt, warum diese vorrangig auf das Ziel der Maximierung des Audience-Flows und der Förderung der Rezeptionsgewohnheiten ausgerichtet sind.
Anhand einer praktischen Analyse des Programmschemas von RTL wird untersucht, wie diese Strategien in der Realität umgesetzt werden und warum es möglich ist, mit einer geschickten Programmierung zum Marktführer auf dem deutschen Fernsehmarkt zu werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Medienökonomischer Kontext zum werbefinanzierten Fernsehen
- 2.1. Ziele werbefinanzierter Fernsehsender
- 2.2. Stellenwert der Zuschauerbindung
- 2.3. Marktanteil als Indikator des Erfolges
- 3. Das Programmschema
- 3.1. Definition des Programmschemas
- 3.2. Ziel eines Programmschemas
- 3.2.1. Förderung der Rezeptionsgewohnheiten
- 3.2.2. Maximierung des Audience-Flow
- 3.3. Zeitliche Dimensionen
- 3.3.1. Das Programmjahr
- 3.3.2. Die Programmwoche
- 3.3.3. Der Programmtag
- 3.4. Dayparting
- 3.4.1. Daytime (09:00 – 18:00 Uhr)
- 3.4.2. Pre-Primetime (18:00 - 20:00 Uhr)
- 3.4.3. Primetime (20:00 - 23:00 Uhr)
- 4. Die Programmschemastrategien
- 4.1. Strategien zur Förderung der Rezeptionsgewohnheiten
- 4.1.1. Stripping
- 4.1.2. Labeling
- 4.2. Strategien zur Maximierung des Audience-Flow
- 4.2.1. Lead-in
- 4.2.2. Lead-out
- 4.2.3. Hammocking
- 4.2.4. Sandwiching
- 4.2.5. Blocking
- 4.2.6. Theming
- 4.2.7. Bridging
- 4.2.8. Seamlessness
- 4.3. Konkurrenzorientierte Strategien
- 4.3.1. Counterprogramming
- 4.3.2. Blunting
- 4.3.3. Stunting
- 4.1. Strategien zur Förderung der Rezeptionsgewohnheiten
- 5. Beispielhafte Untersuchung an RTL
- 5.1. RTL Television
- 5.1.1. RTL Positionierung
- 5.1.2. RTL - der Branchenkönig
- 5.2. Strategien im Programmschema von RTL
- 5.2.1. Daytime
- 5.2.2. Pre-Primetime
- 5.2.3. Primetime
- 5.2.3.1. Dienstag
- 5.2.3.2. Freitag
- 5.1. RTL Television
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Strategien zum Aufbau eines erfolgreichen Programmschemas im werbefinanzierten Fernsehen, am Beispiel von RTL. Ziel ist es, die Faktoren zu analysieren, die zur Maximierung des Marktanteils und damit zu hohen Werbeeinnahmen beitragen. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung der Zuschauerbindung und den Einfluss des Programmschemas auf die Rezeptionsgewohnheiten.
- Optimierung des Programmschemas für maximale Zuschauerreichweite
- Analyse der Einflussfaktoren auf die Zuschauerbindung
- Strategien zur Maximierung des Audience-Flows
- Konkurrenzorientierte Programmierungsstrategien
- Praktische Anwendung der Strategien am Beispiel RTL
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Programmschemas im werbefinanzierten Fernsehen ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Strategien zur Erreichung eines maximalen Marktanteils vor. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die angewandte Methodik.
2. Medienökonomischer Kontext zum werbefinanzierten Fernsehen: Dieses Kapitel beleuchtet die wirtschaftlichen Grundlagen des werbefinanzierten Fernsehens. Es beschreibt die Ziele der Sender, insbesondere die Maximierung des Marktanteils und die Bedeutung der Zuschauerbindung für den wirtschaftlichen Erfolg. Der Marktanteil wird als zentraler Indikator des Erfolgs definiert und seine Bedeutung für die Akquise von Werbeeinnahmen hervorgehoben.
3. Das Programmschema: Dieses Kapitel definiert das Programmschema und beschreibt dessen zentrale Ziele: die Förderung der Rezeptionsgewohnheiten der Zuschauer und die Maximierung des Audience-Flows. Es unterteilt das Programmschema in verschiedene zeitliche Dimensionen (Programmjahr, Programmwoche, Programmtag) und erläutert das Konzept des Daypartings mit seinen verschiedenen Phasen (Daytime, Pre-Primetime, Primetime).
4. Die Programmschemastrategien: Das Kapitel widmet sich den konkreten Strategien zur Umsetzung der Ziele des Programmschemas. Es beschreibt Strategien zur Förderung der Rezeptionsgewohnheiten (Stripping, Labeling) und zur Maximierung des Audience-Flows (Lead-in, Lead-out, Hammocking, Sandwiching, Blocking, Theming, Bridging, Seamlessness). Zusätzlich werden konkurrenzorientierte Strategien wie Counterprogramming, Blunting und Stunting erläutert.
5. Beispielhafte Untersuchung an RTL: Dieses Kapitel analysiert das Programmschema von RTL als Fallbeispiel. Es untersucht die Positionierung von RTL im Markt, analysiert die angewandten Strategien in den verschiedenen Dayparts (Daytime, Pre-Primetime, Primetime) und bewertet den Erfolg dieser Strategien im Hinblick auf die Marktführerschaft von RTL.
Schlüsselwörter
Programmschema, Werbefinanziertes Fernsehen, Marktanteil, Zuschauerbindung, Audience-Flow, Rezeptionsgewohnheiten, Programmierungsstrategien, RTL, Dayparting, Primetime, Konkurrenzstrategien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Programmschemastrategien im werbefinanzierten Fernsehen am Beispiel RTL
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Strategien zum Aufbau eines erfolgreichen Programmschemas im werbefinanzierten Fernsehen, anhand des Beispiels RTL. Im Mittelpunkt steht die Analyse der Faktoren, die zur Maximierung des Marktanteils und damit zu hohen Werbeeinnahmen beitragen.
Welche Ziele werden in der Arbeit verfolgt?
Die Arbeit analysiert die Bedeutung der Zuschauerbindung und den Einfluss des Programmschemas auf die Rezeptionsgewohnheiten. Konkret werden Strategien zur Optimierung des Programmschemas für maximale Zuschauerreichweite, zur Maximierung des Audience-Flows und konkurrenzorientierte Programmierungsstrategien untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Medienökonomischer Kontext zum werbefinanzierten Fernsehen, Das Programmschema, Die Programmschemastrategien und Beispielhafte Untersuchung an RTL. Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage. Kapitel 2 beschreibt die wirtschaftlichen Grundlagen des werbefinanzierten Fernsehens. Kapitel 3 definiert das Programmschema und seine Ziele. Kapitel 4 erläutert verschiedene Programmierungsstrategien. Kapitel 5 analysiert das Programmschema von RTL als Fallbeispiel.
Was versteht man unter "Programmschema" und welche Ziele verfolgt es?
Das Programmschema ist ein Plan, der die Sendungen eines Fernsehsenders über einen bestimmten Zeitraum (Tag, Woche, Jahr) anordnet. Seine Hauptziele sind die Förderung der Rezeptionsgewohnheiten der Zuschauer und die Maximierung des Audience-Flows (Zuschauerstroms).
Welche Strategien zur Maximierung des Audience-Flows werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Strategien wie Lead-in, Lead-out, Hammocking, Sandwiching, Blocking, Theming, Bridging und Seamlessness. Diese Strategien zielen darauf ab, Zuschauer über einen längeren Zeitraum an den Sender zu binden.
Welche konkurrenzorientierten Programmierungsstrategien werden diskutiert?
Die Arbeit behandelt Strategien wie Counterprogramming (gegensätzliche Programmierung), Blunting (Abschwächung der Konkurrenz) und Stunting (besondere Programmierung, z.B. mit Sonderprogrammen).
Welche Rolle spielt RTL in dieser Arbeit?
RTL dient als Fallbeispiel, um die im theoretischen Teil dargestellten Programmschemastrategien in der Praxis zu analysieren. Die Arbeit untersucht die Positionierung von RTL im Markt und die angewandten Strategien in verschiedenen Dayparts (Daytime, Pre-Primetime, Primetime).
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Programmschema, Werbefinanziertes Fernsehen, Marktanteil, Zuschauerbindung, Audience-Flow, Rezeptionsgewohnheiten, Programmierungsstrategien, RTL, Dayparting, Primetime, Konkurrenzstrategien.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit beschreibt. Es folgen Kapitel zum medienökonomischen Kontext, zum Programmschema, zu den Programmschemastrategien und eine Fallstudie zu RTL. Die Arbeit endet mit einem Fazit und einem Literaturverzeichnis.
Welche Methodik wurde in der Arbeit angewendet?
(Diese Information ist nicht explizit im bereitgestellten Text enthalten. Die Methodik müsste aus dem vollständigen Text der Bachelorarbeit entnommen werden.)
- Quote paper
- Stefanie Friese (Author), 2009, Strategien zum Aufbau eines Programmschemas, dargestellt am Beispiel von RTL, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139736