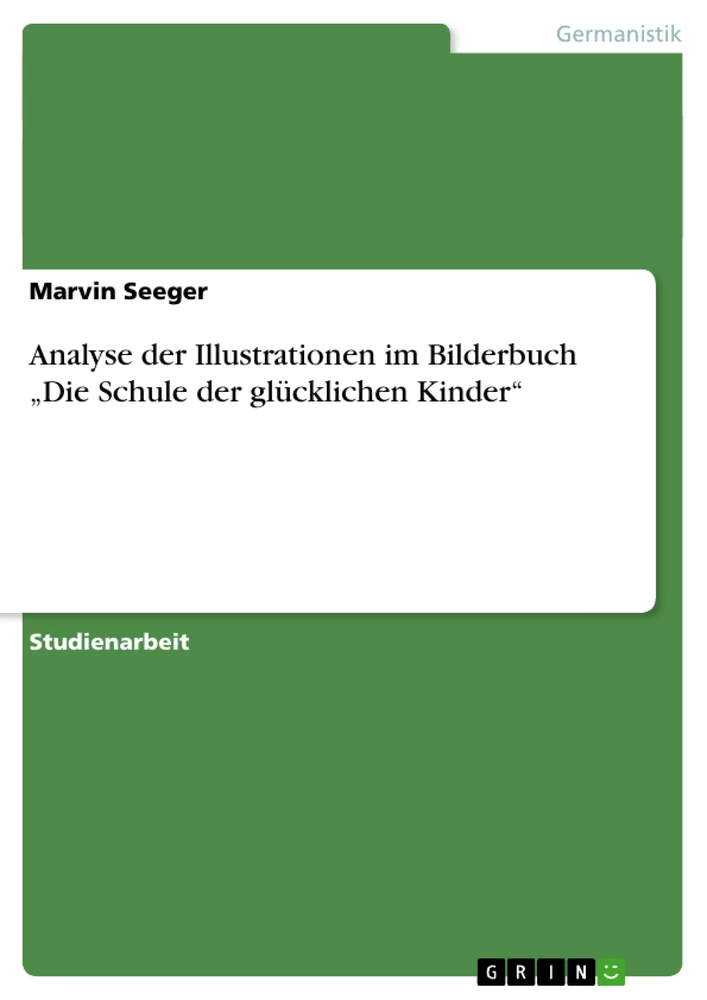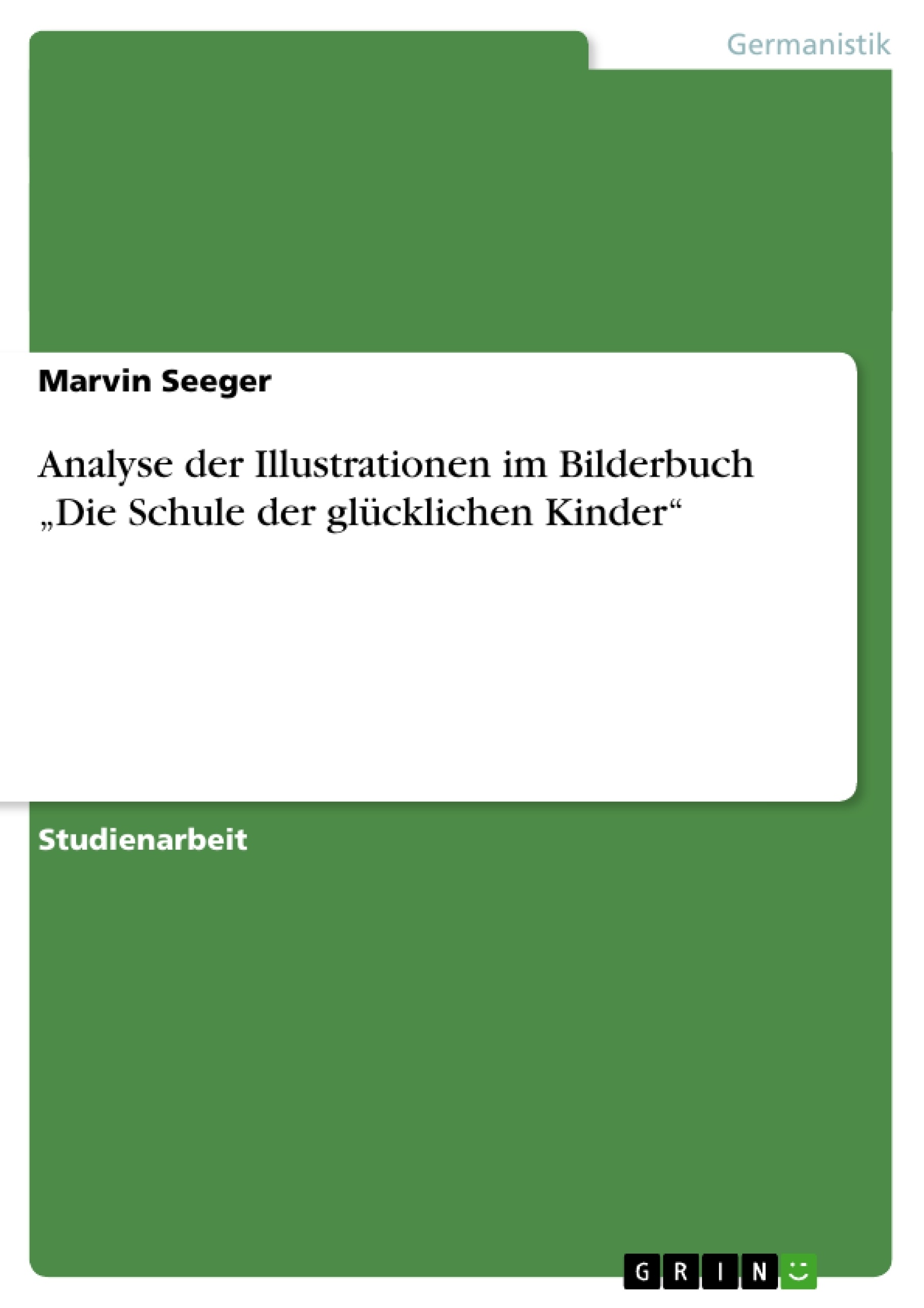Analyse der Illustrationen im Bilderbuch
„Die Schule der glücklichen Kinder“
In dieser Seminararbeit werde ich einen genauen Blick auf die Illustrationen in dem Bilderbuch „Die Schule der glücklichen Kinder“, verfasst von Gudrun Pausewang und Inge Steineke werfen, welches 1987 im Middelhauve Verlag erschien. Ich beginne mit einer kurzen Beleuchtung der beiden Autorinnen und dem Inhalt des Buches, bevor ich dazu übergehe die Illustrationen in einen Zeit- und Rezeptionszusammenhang zu stellen, um diese schließlich auf ihre Wirkung und Funktion hin zu untersuchen. Dabei soll der Fokus vor allen auf die Intention der Illustrationen gelegt werden, wobei ich versuchen werde Aussagen verschieden alter Kinder zu einem speziellen Bild zu analysieren und in einen angemessenen Kontext zu stellen.
Gliederung
1. Einleitung
2. Die Autorinnen
2.1 Gudrun Pausewang
2.2 Inge Steineke
3. Analyse der Illustrationen insgesamt
3.1 Malstil und Technik
3.2 Grundstimmung und wiederkehrende Muster
4. Wirkung und Funktion
4.1 Feldversuch mit Tim und David
4.2 Analyse der Illustration von Seite 22-23
5. Fazit
6. Literaturangaben
1. Einleitung
In dieser Seminararbeit werde ich einen genauen Blick auf die Illustrationen in dem Bilderbuch „ Die Schule der gl ü cklichen Kinder “ [1], verfasst von Gudrun Pausewang und Inge Steineke werfen, welches 1987 im Middelhauve Verlag erschien. Ich beginne mit einer kurzen Beleuchtung der beiden Autorinnen und dem Inhalt des Buches, bevor ich dazu übergehe die Illustrationen in einen Zeit- und Rezeptionszusammenhang zu stellen, um diese schließlich auf ihre Wirkung und Funktion hin zu untersuchen. Dabei soll der Fokus vor allen auf die Intention der Illustrationen gelegt werden, wobei ich versuchen werde Aussagen verschieden alter Kinder zu einem speziellen Bild zu analysieren und in einen angemessenen Kontext zu stellen.
2. Die Autorinnen
2.1 Gudrun Pausewang
Die Deutsche Autorin wurde 1928 in Ostböhmen geboren. Sie studierte an einem pädagogischen Institut und unterrichtete später als Grund- und Hauptschullehrerin. Nach langem Auslandsaufenthalt in Amerika, wo sie an unterschiedlichen Schulen lehrte, kehrte sie schließlich nach Deutschland zurück. Trotz steigernder Berühmtheit ihrer Werke arbeitete sie bis zur ihrer Pensionierung im Jahre 1989 weiter als Lehrerin.
Neben zahlreichen Jugendbüchern und Büchern für Erwachsene veröffentlichte Gudrun Pausewang viele Bilderbücher, die u.a. in Zusammenarbeit mit Inge Steineke entstanden. Bevorzugt behandelte Themen ihrer Bücher sind die Probleme der dritten Welt, Naturschutz und Frieden. Besonders in Zeiten der deutschen Friedens- und Atomkarftgegenbewegung in den 80iger Jahren schrieb sie flammende Werke, die von heutigen Kritikern häufig als zu überzeichnet und einseitig verschrien werden.
2.2 Inge Steineke
Inge Steineke studierte Malerei und Kunstpädagogik, bevor sie mit eigenen Ausstellungen, Modeschauen und Performances zu einiger Berühmtheit gelangte. Sie entwarf Kostüme für Theaterstücke u.a. auch für die Bremer Kammerspiele und das Stadttheater Erfurt.
Als Buchillustratiorin arbeitet sie seit 1985 mit unterschiedlichen Autoren zusammen. Neben der malerischen Ausgestaltung von Bilderbüchern in Zusammenarbeit mit Gudrun Pausewang und Brigitte Schär schrieb sie auch eigene Bücher, die sie selbst illustrierte. Als bekannteste Werke dieser Arbeit gelten die von ihr illustrierten Märchen von den Gebrüdern Grimm, beispielsweise „ Dornr ö schen “, das über den Herder Verlag erschien.
3. Analyse der Illustrationen insgesamt
3.1 Malstil und Technik
Die großen doppelseitigen Bilder werden kaum von dem wenigen Text beeinflusst, der zumeist peripher eingeschoben ist und nicht sofort ins Auge fällt. Die rahmenlosen Illustrationen füllen den gesamten Seiteninhalt, was bei einigen Bildern den Eindruck von Überladenheit vermittelt. Alle Illustrationen sind in demselben malerischen Stil gehalten, wirken naiv getuscht, sind aber trotz ihres skizzenhaften Charakters sehr detailliert. Man kann den Bildern ihren Entstehungsprozess eindeutig ansehen, bei dem auf virtuosen Bleistiftzeichnungen Tusche aufgetragen wurde. Zum Teil wurden die Skizzen auch blank belassen.
Es sind stets viele Personen und Handlungen in den Bildern zu entdecken, was sie lebhaft und verspielt wirken lässt. Fast jedes Bild strahlt eine kindliche Dynamik aus. Die Farbwahl spiegelt den Inhalt des Bildes wieder und verleiht jedem Bild somit einen individuellen Charakter, obwohl sich in der Masse die Illustrationen ähneln. Es wurden überwiegend „freundliche Farben“ benutzt, d.h. unaufdringliche, helle Farben, die keine starken Kontraste schaffen, sondern weich ineinander überfließen. Allgemein sind die Farben zwar intensiv gehalten, jedoch erweckt der grobe Tuschstil einen Anschein von Unfertig- und Unwirklichkeit.
3.2 Grundstimmung und wiederkehrende Muster
Das Buch vermittelt eine träumerische und surreale Atmosphäre. Durchgehend fröhliche und farbenfrohe Abbildungen geben eine positive, harmonische Stimmung und veranlassen sich eingehender mit ihnen zu beschäftigen. Auch die eingeflochtenen märchenhaften Elemente (Zwerge, Ritter usw.) und die inhaltliche Fülle der Illustrationen laden die Kinder förmlich dazu ein in eine andere Welt abzutauchen, wobei die Stimmung auch nicht in Spannung oder Grusel umkippt. Auch wenn Monster und ähnliches auftauchen, bleiben diese klar abgegrenzt von der Harmonie ausstrahlenden Umgebung, in der sich die Kinder aufhalten.
Beispielsweise sind die Farben des Bildes auf Seite 11-12 hauptsächlich in einem düsterem Rot-ton gehalten, was die Rolle der als Monster dargestellten Lehrer perfekt widerspiegelt. Zudem ist die Fläche in der sich Kinder aufhalten illuminiert und setzt sich trotz „vertuschter“ Übergänge gut von den dunklen, bedrohlichen Gestalten ab. Dieses Muster lässt sich noch anhand weiterer Bilder erkennen, in denen dunklere Farben zum Einsatz kommen: Stets ist dort die Gefahr gegenwärtig, findet jedoch entfernt von den abgebildeten Kindern auf einer anderen Ebene statt.
Die leicht verschwommen wirkenden Bilder vermitteln den Eindruck immer distanziert von Rezipienten zu bleiben. Nicht allein deshalb drängt sich der Gedanke an Traumbilder auf, auch der bereits erwähnte Tuschstil verstärkt diese Assoziation weiter.
Alle Bilder sind durchgehend gespickt mit allerhand Freizeitgegenständen, Tieren, Fabelwesen und Naturdarstellungen, die vor allem Kinder ansprechen und Assoziationsfreudigkeit wecken. Dies steht im kompletten Gegensatz zu dem eigentlichen Thema des Buches Schule, lässt doch gerade dieses eine triste und langweilige Umgebung vermuten. Die Illustrationen werden so vereinnahmt und stehen symbolisch für das Kind als Individuum und seine Bedürfnisse.
Ob meine bisherigen Einschätzungen der kindlichen Rezeption richtig sind, werde ich anhand eines Feldversuches im nächsten Punkt klären.
4. Wirkung und Funktion
4.1 Feldversuch mit Tim und David
In diesem Versuch habe ich zwei Jungen, Tim und David (6 und 9 Jahre alt), die Abbildung von Seite 22-23 vorgelegt und mich mit ihnen anschließend über das Gesehene und Gefühlte unterhalten. Den zugehörigen Text habe ich dazu abgeklebt, damit dieser keinerlei Einfluss auf die Bildrezeption nehmen konnte. Da aber die komplette Verschriftlichung des Interviews den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, beschränke ich mich hier nur auf die für meine Untersuchung nach Funktion und Wirkung des Bildes wichtigen Erkenntnisse.
[...]
[1] Bezieht sich auf: Gudrun Pausewang, Inge Steineke: „Die Schule der glücklichen Kinder“. Middelhauve Verlag, Köln, 1987
- Arbeit zitieren
- Marvin Seeger (Autor:in), 2009, Analyse der Illustrationen im Bilderbuch „Die Schule der glücklichen Kinder“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139751