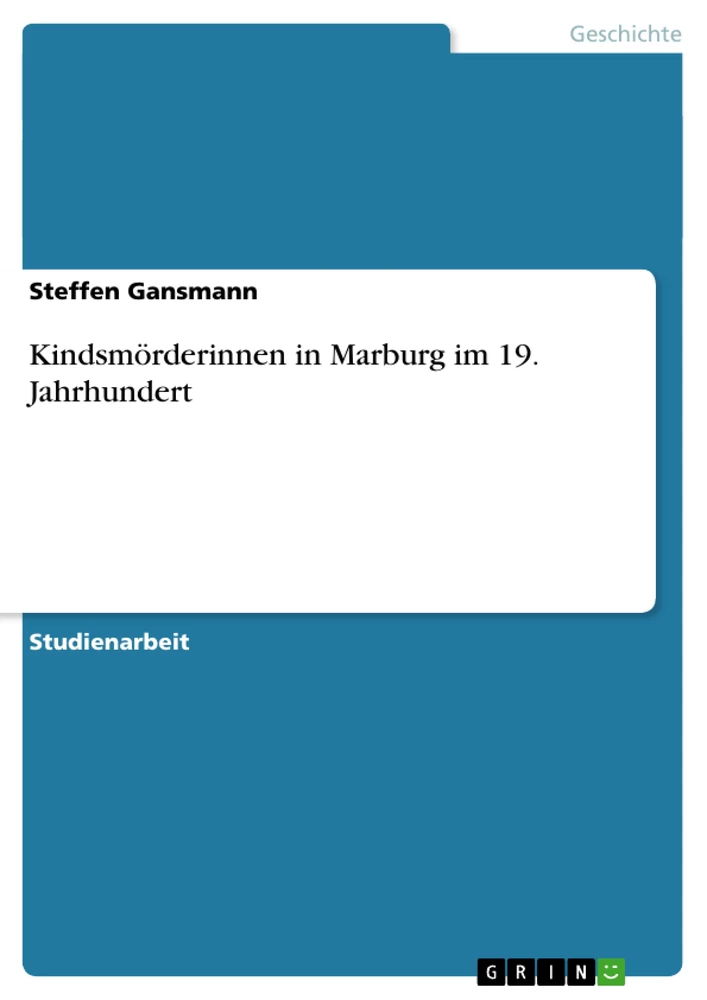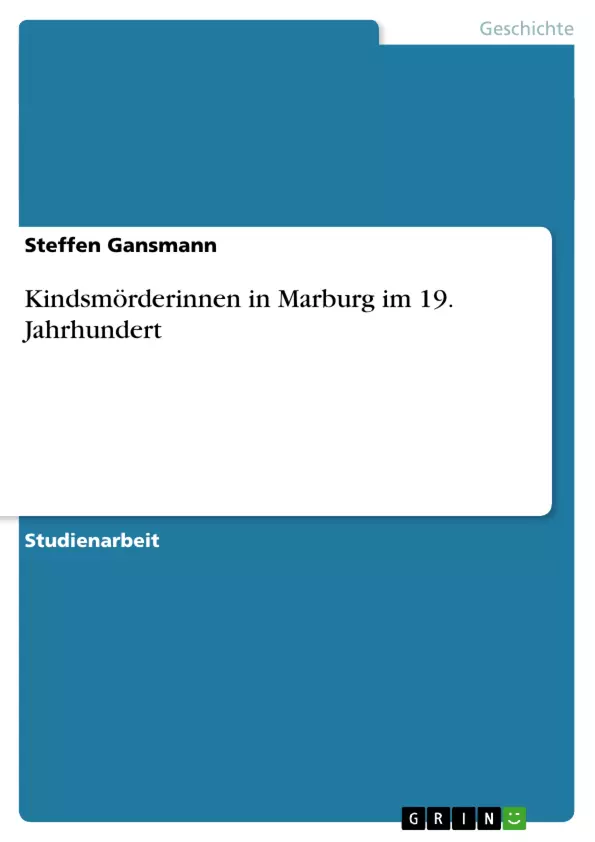Diese Verschriftlichung meines Beitrags zu einem Gruppenreferat bietet eine Darstellung der gesellschaftlichen Umstände im Kurhessen des 19. Jahrhunderts und einen Überblick über die Motive für Kindsmorde und soziale Hintergründe der Täterinnen sowie die Prozesse gegen sie.
Das Kurfürstentum Hessen 19. Jahrhundert
Das Kurfürstentum Hessen war im 19.Jahrhundert ein kleines und armes Land 75% der Bevölkerung lebten als Bauern auf dem Dorf und 25% als Handwerker und Händler in den Städten.[1] Es war unzulänglich regiert und weit hinter der Zeit zurück, folglich ein klassisches Auswanderungsland.[2]
Gründe hierfür waren die schlechte Bodenbeschaffenheit, Mangel an Bodenschätzen,
vernachlässigte Viehzucht und das Erbrecht[3], welches mit höherer Anzahl an männlichen Nachkommen das Erbe an Landbesitz für den einzelnen immer kleiner werden ließ! Hinzu kamen europaweit in den 1830 1850er Jahren eine große Anzahl wirtschaftlicher und agrarischer Krisenperioden in kurzen Abständen, in dessen Folge sich die Armut immer mehr ausbreitete, besonders in Hessen, welches als „Armenhaus Deutschlands“ galt,[4] und hier am größten in Gegenden wie Marburg, wo es keine Fabriken und Maschinen gab.[5] So waren beispielweise aufgrund der sozialen Notlage im 50% der Marburger Gewerbebevölkerung auf öffentliche Unterstützung angewiesen.[6]
Die sozialen Folgen dieser wirtschaftlichen Krise waren die Zunahme der Tagelöhnerarbeit bei Männern und die Erhöhung des Gesindedaseins als Magd bei Frauen von der Jugend bis ins späte Erwachsenenleben![7] Hiermit einher ging ein Anstieg der Säuglingssterblichkeit, und ebenso der Kindsmordrate in Marburg & Kurhessen.
Ebenso kam es auch zu einer großen Auswanderungswelle nach Amerika.[8]
Dem versuchte die Regierung Kurhessens mit der längst überfälligen Verabschiedung einer Verfassung für Hessen im Jahre 1830[9] Herr zu werden: Sie sah unter anderem die Abschaffung der Feudalabgaben vor ganze 30 Jahre später als im als fortschrittlich geltenden Preußen![10]
Des weiteren beinhaltete sie die Einführung von Verehelichungsbeschränkungen, um der drohenden Verelendung entgegenzuwirken. Hieran gekoppelt waren staatlich angeordnete Vermögensanforderungen, 300 Gulden in der Stadt[11] und 200 Gulden auf dem Land[12] beziehungsweise der Nachweis der Fähigkeit zur Ernährung einer Familie und Mindestalter von 22 für Männer oder 18 Jahre für Frauen zur Heirat![13]
Man rechnete wohl damit, daß man unter Umständen vielleicht das ein oder andere uneheliche Kind nebst seiner Mutter versorgen müsse, aber die Versorgung von verelendeten Großfamilien nun der Vergangenheit angehören würde.
Dieser Plan scheiterte jedoch, da durch fehlende Industrie und unentwickeltes Gewerbe bei Zunahme von Konkubinaten[14] und somit eine Zunahme unehelicher Kinder zu verzeichnen war ein explosionsartiger Anstieg unehelicher Geburten, so betrug die Rate der unehelichen Kinder 1838 in Kurhessen 10,65% und in Marburg: 12,00%, 1842 hingegen in Kurhessen: 12,84% und in Marburg 18,54%[15] und somit einer raschen Zunahme der Bevölkerung, die Verarmung weiter voranschritt.[16] Ein Teufelskreis aus dem aus zu dieser Zeit für Angehörige der immer größer werdenden Unterschicht keinen Ausweg gab.
[...]
[1] Janho, S.27f
[2] Metz Becker, S.200, 1996
[3] Janho, S.27f
[4] Metz Becker, S.159,1997b
[5] Janho, S.28
[6] Janho, S.30
[7] Metz Becker, S.202, 1996
[8] Metz Becker, S.159, 1997b
[9] Metz Becekr, S.201, 1996
[10] Janho, S.28
[11] Metz Becker, S.202, 1996
[12] Metz Becker, S.202, 1996
[13] Janho, S.39
[14] Janho, S.41
[15] Metz, Becker, S.140, 1993
[16] Metz Becker, S. 201, 1996
Häufig gestellte Fragen
Warum galt Hessen im 19. Jahrhundert als „Armenhaus Deutschlands“?
Aufgrund schlechter Bodenbeschaffenheit, fehlender Bodenschätze, mangelnder Industrie (besonders in Marburg) und wiederkehrender Wirtschaftskrisen lebte ein Großteil der Bevölkerung in tiefer Armut.
Was waren die Gründe für Kindsmorde in dieser Zeit?
Die Hauptgründe waren soziale Not, die Stigmatisierung unehelicher Kinder und die Unfähigkeit, eine Familie aufgrund wirtschaftlicher Krisen und Heiratsbeschränkungen zu ernähren.
Welche Heiratsbeschränkungen gab es in Kurhessen?
Um die Verelendung zu stoppen, führte die Regierung Vermögensanforderungen ein: 300 Gulden in der Stadt und 200 Gulden auf dem Land mussten nachgewiesen werden, um heiraten zu dürfen.
Wie wirkte sich das Erbrecht auf die Bauern aus?
Das Realerbteilungsrecht führte dazu, dass Landbesitz bei vielen männlichen Nachkommen in immer kleinere, kaum noch lebensfähige Parzellen aufgeteilt wurde, was die Armut verschärfte.
Warum stieg die Zahl unehelicher Geburten trotz Verboten an?
Da viele Paare die finanziellen Anforderungen für eine Heirat nicht erfüllten, kam es vermehrt zu Konkubinaten (wilden Ehen), was zu einem explosionsartigen Anstieg unehelicher Kinder führte.
- Citation du texte
- Steffen Gansmann (Auteur), 2009, Kindsmörderinnen in Marburg im 19. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139757