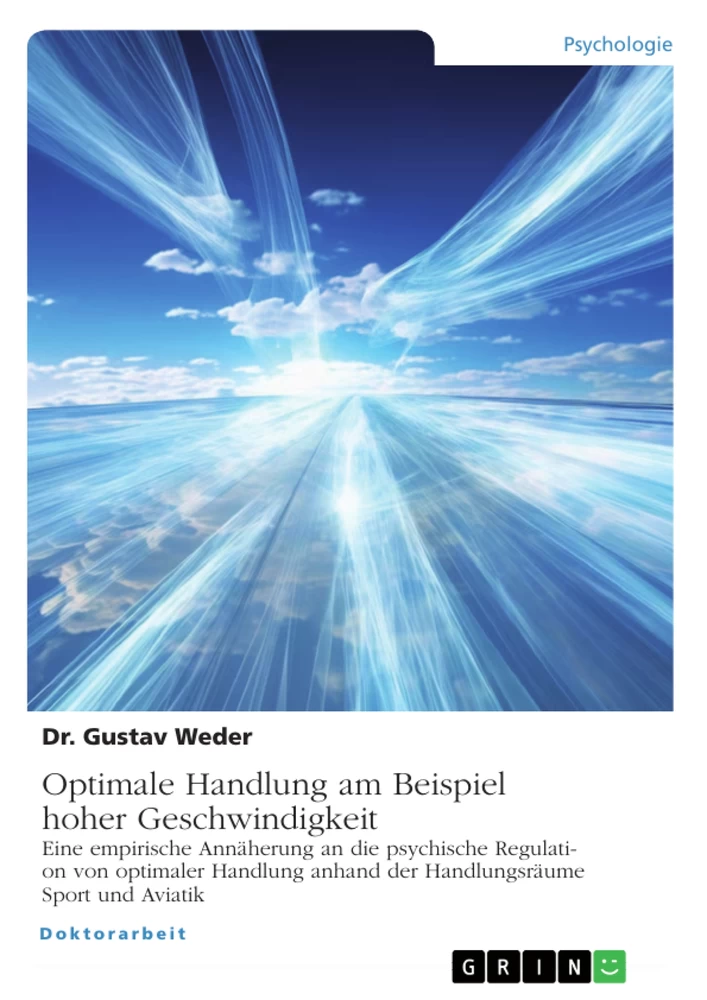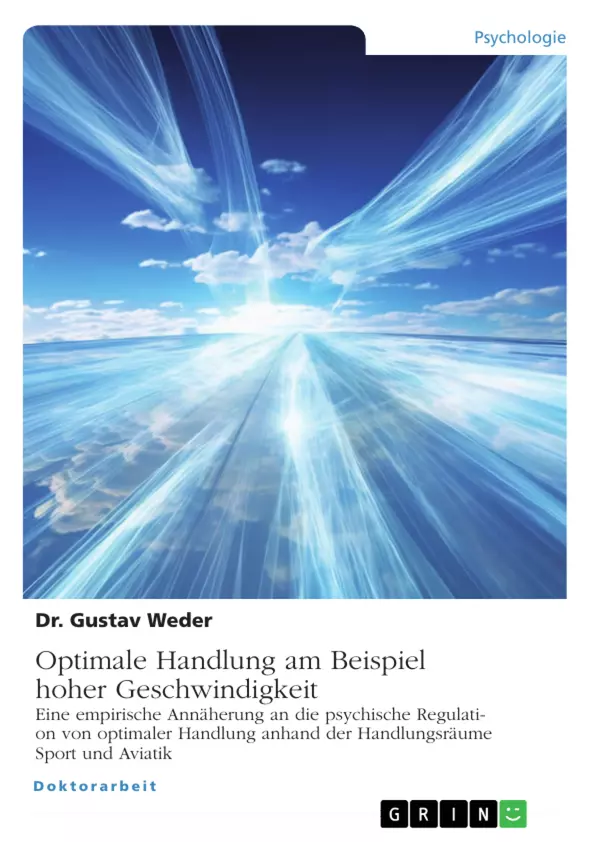Erhöhte Geschwindigkeit führt zu einer Verknappung der Zeit, die einem Menschen für eine bestimmte Handlung zur Verfügung steht. Dies bewirkt, dass die Anforderungen an die psychische Regulation dieser Handlung verschärft werden und somit die Person-Umwelt-Interaktion intensiviert wird. Diese Doktorarbeit befasst sich mit eben dieser Frage der optimalen Handlung am Beispiel hoher Geschwindigkeit, welche anhand von praktischen Erfahrungsberichten aus der Aviatik und dem Sport diskutiert, mit theoretischen Ansätzen aus verschiedenen Disziplinen reflektiert betrachtet und in Prozessmodellen dargestellt wird.
Die Thematik ist sowohl für die untersuchten als auch für alltägliche Situationen von Interesse. Der Autor will seine Leserinnen und Leser dazu anregen, die empirischen Ergebnisse losgelöst von den genannten Beispielen auch auf individuelle und kollektive Themen im wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Alltag zu beziehen, die eine erhöhte Geschwindigkeit und damit Stressbelastung zur Folge haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Grundsätzliche Fragestellung
- Aufbau der Arbeit
- THEORIE
- Die Person-Umwelt-Interaktion in der kognitiven Handlungstheorie
- Handlungsraumspezifische Konzeption
- Repräsentative Handlungsräume
- Eingrenzung
- Strukturverwandtschaften
- Handlungsintention
- Expert(inn)enwissen
- Geschwindigkeit
- Risiko
- Strukturunterschiede
- Biomechanische Settings
- Wahrnehmungssysteme
- Steuerungssysteme
- Feedbacksysteme
- Persönlichkeitsspezifische Anforderungen
- Zusammenfassung
- Kognitionspsychologische Konzeption
- Wahrnehmung
- Limitierende Funktion
- Wahrnehmung und Handlung
- Informationsselektion
- Kognition
- Emotion
- Neurophysiologische Ursachen
- Psychophysiologische Konsequenzen
- Motivation
- Bewusstsein
- Ordnungsschwelle
- Aufmerksamkeit und Konzentration
- Automatisierung
- Psychologische Sicht
- Physikalische Sicht
- Psychophysikalische Sicht
- Zeit
- Volition
- Persönlichkeit
- Zusammenfassung
- Handlungstheoretische Konzeption
- Dimensionen der Handlung
- Situationsoptimierung
- Intentionalität
- Organisationsstruktur des Handelns
- Prozess
- Regulierende Systeme
- Regelungsprinzipien
- Interne Repräsentation
- Zusammenfassung
- Zusammenfassung und Ausblick
- Konsequenzen für die Studie
- Präzisierung der Fragestellung
- METHODIK
- Qualitativ-empirische psychologische Forschung
- Grundsätzliche Überlegungen
- Zur Logik in der Wissenschaftstheorie
- Stellenwert von Sprache und Kommunikation
- Erschliessung handlungsrelevanter interner Repräsentationen
- Grundzüge der Grounded Theory Konzeption
- Wissenschaftstheoretisches Paradigma
- Der Forscher als Instrument
- Expert(inn)en-Stichproben
- Expert(inn)en als Repräsentanten kleiner Stichproben
- Kriterien für den Expert(inn)en-Status
- Statistische Informationen
- Forschungsprozess
- Verwobenheit von Datenproduktion und -auswertung
- Datenproduktion
- Qualitative Interviews
- Interviewvorbereitung und -durchführung
- Problemfeld Interviewer-Effekt
- Anonymität
- Datenauswertung
- Prozedur und Analyseinstrumente der Grounded Theory Konzeption
- Chronologie der Forschungsphasen
- Explorative Vorstudie
- Erste Forschungsphase im Handlungsraum Sport
- Zweite Forschungsphase im Handlungsraum Aviatik
- Weiterführende Analyseschritte
- Gütekriterien
- Überlegungen für die qualitativ-empirische Forschung
- Problemfelder der qualitativ-empirischen Forschung
- Induktion und Deduktion
- Stichproben- und Repräsentationsprobleme
- Angewandte Kriterien
- Gegenstandsangemessenheit
- Transparenz des Forschungsprozesses
- Methodenkritik
- Zusammenfassung
- EMPIRIE
- Zur psychischen Regulation von optimaler Handlung.
- Handlungsführende und -begleitende Kognitionen und Emotionen der Sportler(innen)
- Gesteigerte Intensität
- Erhöhte Kompetenzgefühle und Befriedigung
- Hohe Konzentration
- Gesteigerte Wahrnehmung
- Grenzerfahrung
- Optimales Handlungsgefühl
- Verschmelzung mit dem Gerät
- Reduktion der "Selbstwichtigkeit"
- Fliessen in einer "Zone"
- Chaos
- Handlung aus dem Unbewussten
- "Körperaustritt"
- Veränderte Zeitwahrnehmung
- Relativität von Zeit und Geschwindigkeit
- Zeitlupenwahrnehmung
- "Zeitlosigkeit"
- Handlungsführende und -begleitende Kognitionen und Emotionen der Piloten
- Vorbereitungen
- Planung und Auswertung
- Hohe Motivation
- Einschätzung von Risiko
- Optimale Handlungsausführung
- Hohe Konzentration
- Situationsübersicht und Orientierung nach vorne
- Gefühl der Einheit mit Gerät
- Erhöhtes Erregungsniveau
- Perfektion und gutes Handlungsgefühl
- Relativität der Geschwindigkeitswahrnehmung
- Winkelgeschwindigkeit von Objekten
- Veränderte Wahrnehmung der Zeit
- Täuschungen
- Handlung unter Zeitdruck
- Jetzt und Zukunft - ohne Vergangenheit
- Reduktion auf Wesentliches und Entscheiden
- Intuition, Erfahrung und Automatismen
- Überforderung und Hormone
- Ein Vergleich zwischen Sportler(inne)n und Piloten
- Gemeinsamkeiten
- Unterschiede
- Zusammenfassung
- Thematische Einzelfalldarstellungen
- Die Wichtigkeit der Planung und Auswertung
- Entscheiden und Handeln unter zeitlichem Stress
- Optimale Handlungsausführung im Einklang mit optimalem Handlungsgefühl
- Zeit- und Geschwindigkeitsrelativität - Neudefinition von Zeit
- Die Rolle der kognitiven Handlungstheorie in der Person-Umwelt-Interaktion
- Die Analyse handlungsraumspezifischer Konzeptionen, insbesondere im Sport und in der Aviatik
- Die Untersuchung der kognitionspsychologischen Konzeptionen, einschließlich Wahrnehmung, Emotion, Motivation und Bewusstsein
- Die Exploration der Handlungstheoretischen Konzeptionen und deren Einfluss auf die Regulation optimaler Handlung
- Die Anwendung qualitativ-empirischer Forschung zur Erhebung und Analyse von Daten aus Expert(inn)eninterviews
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Dissertation befasst sich mit der psychischen Regulation optimaler Handlung am Beispiel hoher Geschwindigkeit in den Handlungsräumen Sport und Aviatik. Ziel ist es, die kognitiven und emotionalen Prozesse zu verstehen, die zu optimaler Handlung in Situationen mit hohem Tempo und erhöhtem Risiko führen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, in der die grundsätzliche Fragestellung und der Aufbau der Arbeit dargestellt werden. Im Theorieteil wird die Person-Umwelt-Interaktion im Rahmen der kognitiven Handlungstheorie beleuchtet. Dabei werden handlungsraumspezifische Konzeptionen, kognitionspsychologische Konzeptionen und handlungstheoretische Konzeptionen behandelt. Der Methodenteil erläutert das wissenschaftstheoretische Paradigma der Arbeit und die angewandte Methodik, insbesondere die qualitative Forschung mit Expert(inn)en-Stichproben und die Grounded Theory Konzeption. Der Empirieteil präsentiert die Ergebnisse der Analyse der Expert(inn)eninterviews aus den Handlungsräumen Sport und Aviatik, wobei die Handlungsführenden und -begleitenden Kognitionen und Emotionen im Fokus stehen. Abschließend wird ein Vergleich zwischen Sportler(inne)n und Piloten gezogen und thematische Einzelfalldarstellungen beleuchten wichtige Aspekte der optimalen Handlung in beiden Handlungsräumen.
Schlüsselwörter
Optimale Handlung, Geschwindigkeit, Handlungsraum, Sport, Aviatik, Kognition, Emotion, Motivation, Bewusstsein, Wahrnehmung, Zeit, Grounded Theory, Qualitative Forschung, Expert(inn)eninterviews, Psychische Regulation.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „optimale Handlung“ unter hohem Zeitdruck?
Es beschreibt die psychische Regulation von Handlungen in Situationen extremer Geschwindigkeit, in denen Wahrnehmung und Kognition intensiviert werden müssen.
Wie unterscheidet sich die Zeitwahrnehmung bei Piloten und Sportlern?
In Momenten höchster Konzentration berichten beide Gruppen oft von einer „Zeitlupenwahrnehmung“ oder dem Gefühl der „Zeitlosigkeit“, was die Handlungssteuerung optimiert.
Was ist das „Gefühl der Einheit mit dem Gerät“?
Es ist eine Form der Verschmelzung von Mensch und Technik (z.B. Flugzeug oder Sportgerät), die automatisiertes Handeln aus dem Unbewussten ermöglicht.
Welche Rolle spielt die Grounded Theory in dieser Dissertation?
Die Grounded Theory dient als methodischer Rahmen für die Auswertung qualitativer Experteninterviews, um theoretische Prozessmodelle der Handlung zu entwickeln.
Kann man diese Erkenntnisse auf den Alltag übertragen?
Ja, der Autor regt dazu an, die Ergebnisse auf wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stresssituationen zu beziehen, die ebenfalls durch hohe Geschwindigkeit geprägt sind.
- Quote paper
- Gustav Weder (Author), 2002, Optimale Handlung am Beispiel hoher Geschwindigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1399173