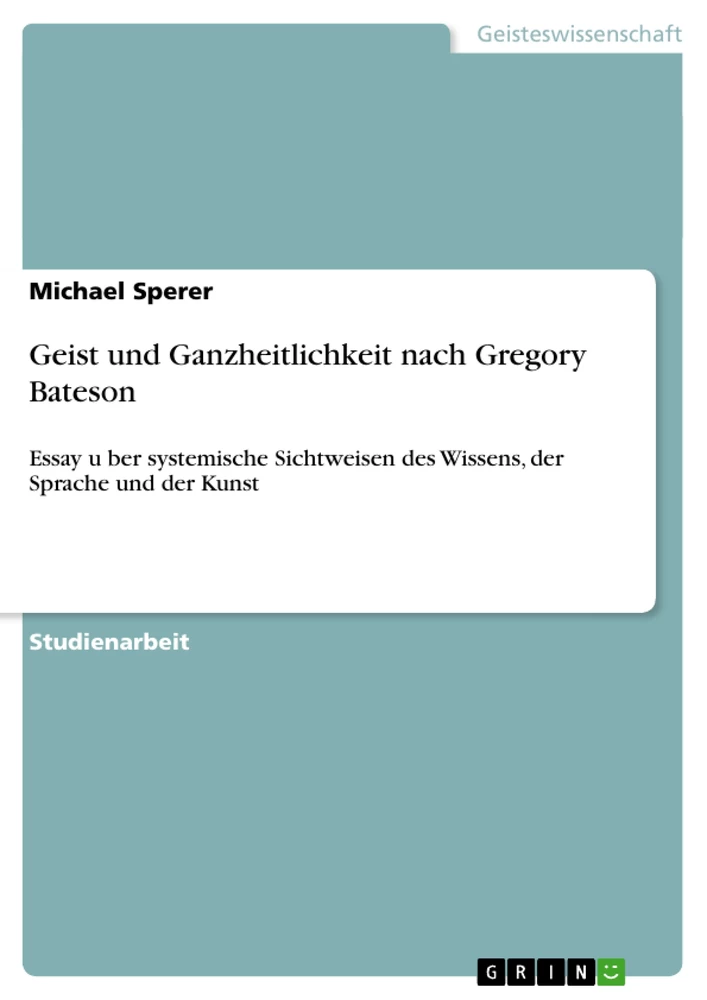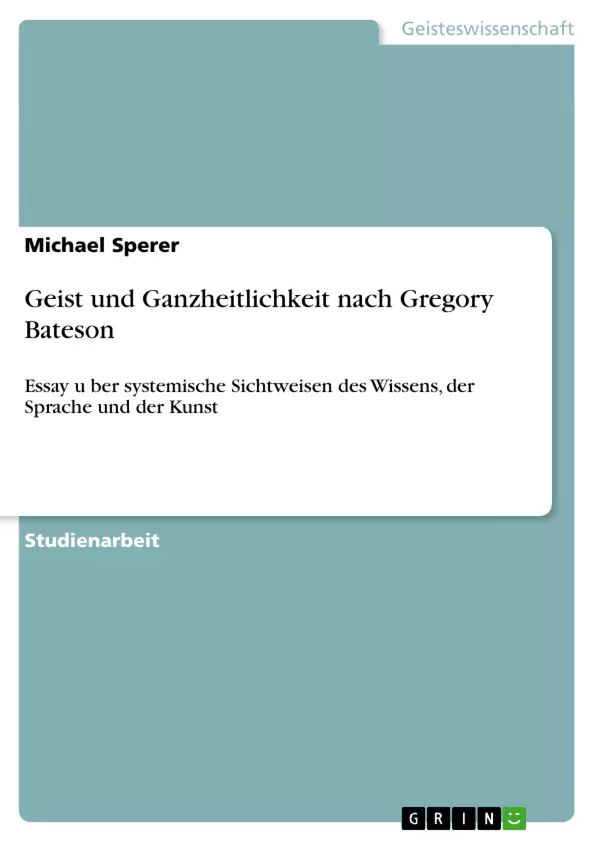In this essay I'm trying to reconstruct the systemic, epistemologic and ecologic view of knowledge, speech and art by anthropologist Gregory Bateson (1904-1980). By comparing with newer (social) systemic approaches, a central idea lies in observing relatons instead of substances in nature and mind. Complex areas as the connection between conciousness and unconsciousness and the emergence of speech will be discussed in comparison with nonverbal forms of communication, art and handcraft.
Geist und Ganzheitlichkeit nach Gregory Bateson
Essay über systemische Sichtweisen des Wissens, der Sprache und der Kunst
Autor: Michael Sperer
Seminararbeit im Fach „Themen der theoretischen Soziologie II”, Institut für theoretische Soziologie, Johannes Kepler Universität Linz, Sommersemester 2oo8
Abstrakt:
In this essay I'm trying to reconstruct the systemic, epistemologic and ecologic view of knowledge, speech and art by anthropologist Gregory Bateson (19o4−198o(. By comparing with newer (social( systemic approaches, a central idea lies in observing relations instead of substances in nature and mind. Complex areas as the connection between conciousness and unconsciousness and the emergence of speech will be discussed in comparison with primitive forms of art and handcraft.
1. Einleitung
Ein besonderes Merkmal, das die Arbeit Gregory Batesons auszeichnet, ist der Fokus auf Beziehungen. Diese können als zentraler Gegenstand der Soziologie bezeichnet werden, durchdringen aber in ihrer allgemeinsten Bedeutung ebenso die Psychologie, die Kultur, die Ökologie uvm. Bateson könnte eventuell als „Beziehungswissenschafter” gesehen werden und ist so für viele Disziplinen gleichermaßen interessant: kehrt man den „Blick” von einer Realität aus sichtbaren Subjekten ab und bedenkt die vielen unsichtbaren Relationen und Wirkungen zwischen diesen, lassen sich dynamische Beziehungsmuster feststellen, die Subjektbildung sowohl ermöglichen als auch bedingen. Diese Sichtweise unterscheidet sich möglicherweise von jener, die wir alltäglich zur Beschreibung der Realität heranziehen, wo wir Subjekte1 meist nach ihrer offensichtlich wahrnehmbaren manifesten Gegenständlichkeit identifizieren und abgrenzen, ohne dass die mehr oder weniger latenten Verbindungen, aus denen sie im Grunde bestehen, ausreichend berücksichtigt werden. Dies resultiert nach Bateson aus natürlichen Grenzen unseres Bewusstseins und der menschlichen Fähigkeit zur Abstraktion mittels einer digital charakterisierten Sprache2. Eine gewisse „Subjektorientiertheit” unserer Sprache − und vielleicht unseres Bewusstseins im Allgemeinen − wird von Bateson teilweise angesprochen und kritisiert, wenn Gefühle wie z.B. Liebe, Hass, Furcht etc. als isolierte Empfindungen des Individuums gesehen werden, obwohl sie meist auf andere bezogen sind und folglich auch vergleichbare Muster sozialer Sachverhalte (Kontingenzen( sind (vgl. Bateson ,9I6: S. 2I4; ,98,: S.,95(. Da sich die Realität nach Bateson in unzähligen Kausalketten & −kreisläufen (vgl. Bateson ,98,, S. 2o4−2o5( darstellt, sollen hier seine Thesen aus der Perspektive „Geist und Ganzheitlichkeit” diskutiert werden. Eine Grundaussage Bateson's ist die zweckgebundene, selektive Wahrnehmung des Bewusstseins einzelner Kreislaubögen einer vom Unbewussten viel umfangreicher verarbeiteten Realität. So ist „...die bewusste Auffassung des Netzwerks als ein Ganzes eine ungeheuerliche Leugnung der Integration dieses Ganzen.” (1981, S. 2oI(. So bestimmt auch jede wissenschaftliche Sichtweise Realität nach ihrer eigenen Terminologie, während sie andere Sichtweisen ausspart. Dies sollte der Text berücksichtigen, weshalb Bezüge zur Soziologie zugunsten erkenntnistheoretischer Ausführungen weniger im Vordergrund stehen. Dabei sollen sich anschlussfähige Aussagen Niklas Luhmanns wiederfinden, um einer „Ganzheitlichkeit” − wenn schon sprachlich−rational eingeschränkt darstellbar − zumindest in kleinen Absätzen näher zu kommen.
2. Qualitative und quantitative Grenzen des Bewusstseins
Mit der Perspektive einer durch und durch aus Zusammenhängen bestehenden Welt fällt es schwer, einen thematischen Punkt zu setzen, an dem man anfängt, um in weiterer Folge eine gegliederte Beschreibung dieser Sichtweise zu geben. Bateson löst dieses Problem, in dem er in seinem Theorieentwurf über „Stil, Grazie und Information in der primitiven Kunst” auf die Unterscheidung zwischen Bewusstsein und Unbewusstsein hinweist. Diese beiden Ebenen des Geistes scheinen bei Tieren noch wesentlich stärker integriert zu sein als beim Menschen, der durch Selbstbewusstsein, abstraktem Denken und Kommunizieren (im Gegensatz zu einfacher, „bildlicher” Kommunikation von Tieren( vielen potentiellen Täuschungen ausgeliefert ist. Nicht nur verwendet der Mensch in bewussten d.h. sekundären Denkprozessen mehrheitlich bereits die Logik der Sprache, die von jener der unbewussten, prim ä ren Prozesse abweicht, auch erlaubt uns das Bewusstsein quantitativ wie qualitativ nur sehr beschränkt auf unser Wissen zurückzugreifen.
Müssten wir beispielsweise eine umfassende Beschreibung aller Ereignisse vornehmen, die zur Fertigung eines selbstgemachten (Kunst−(Gegenstandes notwendig waren, könnten wir zum einen nicht mehr die Summe aller Details des Arbeitsverlaufs wiedergeben, geschweige denn die Summe der Tätigkeiten die notwendig waren, um die Arbeit überhaupt beginnen zu können usw. usf.. Die Gesamtheit der „automatisierten” Ereignisse unseres täglichen Schaffens fasst Bateson mit dem Begriff der Gewohnheit zusammen, in der sich das Unbewusstsein zu erkennen gibt (vgl. 1981, S.2oo(. Im Ausblenden gewöhnlicher Tätigkeiten liegt u.a. eine wichtige Ökonomie unseres Denkens − der wir vielleicht im Alter gerne durch unkonventionelles, „bewusstmachendes” Handeln und Erinnern gegensteuern wollen − die aber eine notwendige Voraussetzung zur Bewältigung tatsächlich neuer Aufgaben ist.
Zum anderen wäre eine qualitative Erklärung der Fertigkeiten, d.h. wie oder auf welche Weise wir den Gegenstand zu dem gemacht haben, was er ist, ebenso schwer möglich. Bateson erklärt diese Schwierigkeit anhand folgender Erkenntnisse: Erlerntes Wissen über Denken, Handeln und Wahrnehmung wird nach Samuel Butler durch Übung in unbewusstere Ebenen abgelegt, weshalb bestehende Fertigkeiten mit dem Grad ihrer Ausprägung umso unauffälliger (und schwieriger sprachlich kommunizierbar( angewendet werden. Damit hängt auch ein enormer, unbewusster Bestand mathematischen Wissens (Perspektive, Dynamik, etc.( zusammen, den wir Adalbert Ames' zufolge vielfach anwenden, ohne ihn rational begründen zu können. Zudem ist der Primärprozess anders strukturiert als das Bewusstsein, was Sigmund Freud und andere durch die Traumdeutung herausgefunden haben. Demnach haben Träume als das pure Unbewusste einen relationalen und metaphorischen Charakter, worin Subjekte und ihre Eigenschaften variabel in Beziehung gesetzt werden, die als Metaphern anderer undƒoder umfassenderer Zusammenhänge im Bewusstseinszustand interpretiert werden können. Für Bateson scheint das technische wie ästhetische In− Beziehung−Setzen eines Handwerkers von Form, Material und Farbe in seinem Werk zum Teil dieser unbewussten Logik unterworfen zu sein. Als viertes Hindernis zur Erklärung des „Zustandebringens” eines produzierten Gegenstands ließe sich die Verdrängungstheorie Freuds heranziehen, die das Einsperren unerwünschter Triebe in vom Bewusstsein nicht erreichbare Ebenen des Geistes annimmt (vgl. auch Hofstadler, 2oo6, S. 52(. Bateson teilt zwar diese These nicht vollständig, doch mögen Affekte oder unbewusste Diskrepanzen ebenso eine Rolle dabei spielen, wenn manche Arbeitsschritte auf unnachvollziehbare Weise vorgenommen werden.
Diese Schnittstellen zum Unbewusstsein ermöglichen uns den Rückgriff auf vorhandene Fertigkeiten und Kenntnisse, ohne aber sie meist ausreichend erklären zu können. Den Vorgang des Rückgriffs bezeichnet Bateson auch als Einfühlun g in sich und in den bearbeiteten Gegenstand. Ein versierter Produzent kann − wie umgangssprachlich gerne gesagt − eine „Beziehung zum Werk” herstellen, weil er über umfangreiches Beziehungswissen verfügt, mit dem er Verbindungen zwischen Objekten anders konstruiert und einen innovativen, interessanten, verblüffenden usw. Gegenstand erschafft.
Wir können uns durch kognitives Rekonstruieren eines geschaffenen Werkes nur einen Teilbereich aller darin enthaltenen Wahrheiten bewusst machen, obwohl wir im Unbewusstsein ungleich mehr darüber wissen müssten, sofern wir es selbst gestaltet haben. Doch auch der Beobachter des Werkes kann Rückschlüsse über darin enthaltene Informationen anstellen mittels Einfühlung in seine eigenen unbewussten Wissensbestände. Bateson behandelt diesen Zugriff auf unser Gesamtwissen neben den Möglichkeiten LernenƒÜbung, Drogenkonsum und Traumdeutung vorwiegend anhand der Gestaltung und Rezeption von primitiver, d.h. nonverbaler Kunst. Dort werden ganzheitliche Kenntnisse und Fertigkeiten in ästhetische Formen umgesetzt, die sich wiederum dem Betrachter nach folgender Fragestellung erschließen lassen: „In welchem Ausmaß wurde im Kunstwerk die Integration von bewussten und unbewussten Wissen in entsprechende Formen transformiert?” (vgl. Bateson 1981, S. 183, 194, 2o6(. Diese Frage nach dem Informationsgehalt des Kunstgegenstandes wird zum Teil auch von vielen KunstrezipientInnen gestellt, wenn z.B. nach einem Kino− oder Galleriebesuch eine Diskussion über verschiedene Interpretationen entsteht.
[...]
1 Im Text wird der Begriff Subjekt anstatt Objekt verwendet1 da die Beobachtung der Realität das eigene Selbst beinhaltet.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Essay "Geist und Ganzheitlichkeit nach Gregory Bateson"?
Der Essay rekonstruiert die systemische, epistemologische und ökologische Sichtweise von Wissen, Sprache und Kunst des Anthropologen Gregory Bateson. Er vergleicht Batesons Ansatz mit neueren systemischen Ansätzen und betont die Bedeutung der Beobachtung von Beziehungen anstelle von Substanzen in Natur und Geist. Der Essay behandelt komplexe Bereiche wie die Verbindung zwischen Bewusstsein und Unbewusstsein sowie die Entstehung von Sprache im Vergleich zu primitiven Kunstformen und Handwerkskunst.
Was ist das zentrale Thema in Gregory Batesons Arbeit?
Das zentrale Thema in Batesons Arbeit ist der Fokus auf Beziehungen. Diese Beziehungen werden als zentraler Gegenstand der Soziologie betrachtet, durchdringen aber auch die Psychologie, die Kultur, die Ökologie und viele andere Bereiche.
Wie unterscheidet sich Batesons Sichtweise von der alltäglichen Wahrnehmung der Realität?
Batesons Sichtweise unterscheidet sich von der alltäglichen Wahrnehmung der Realität, indem er den "Blick" von einer Realität aus sichtbaren Subjekten abkehrt und die unsichtbaren Relationen und Wirkungen zwischen diesen Subjekten berücksichtigt. Anstatt Subjekte nach ihrer offensichtlich wahrnehmbaren Gegenständlichkeit zu identifizieren, konzentriert er sich auf die dynamischen Beziehungsmuster, die Subjektbildung ermöglichen und bedingen.
Was sind die qualitativen und quantitativen Grenzen des Bewusstseins laut Bateson?
Bateson argumentiert, dass das Bewusstsein sowohl qualitativ als auch quantitativ begrenzt ist. Wir können nicht alle Details der Ereignisse, die zur Fertigung eines Gegenstandes notwendig waren, wiedergeben. Zudem ist eine qualitative Erklärung der Fertigkeiten schwer möglich, da erlerntes Wissen durch Übung in unbewusstere Ebenen abgelegt wird. Auch der Primärprozess ist anders strukturiert als das Bewusstsein.
Was versteht Bateson unter Gewohnheit?
Bateson fasst die Gesamtheit der "automatisierten" Ereignisse unseres täglichen Schaffens mit dem Begriff der Gewohnheit zusammen, in der sich das Unbewusstsein zu erkennen gibt. Das Ausblenden gewöhnlicher Tätigkeiten ermöglicht eine Ökonomie des Denkens, die eine notwendige Voraussetzung zur Bewältigung tatsächlich neuer Aufgaben ist.
Was bedeutet "Einfühlung" im Kontext von Batesons Theorie?
Bateson bezeichnet den Vorgang des Rückgriffs auf vorhandene Fertigkeiten und Kenntnisse als Einfühlung in sich und in den bearbeiteten Gegenstand. Ein versierter Produzent kann eine "Beziehung zum Werk" herstellen, weil er über umfangreiches Beziehungswissen verfügt.
Wie behandelt Bateson den Zugriff auf unser Gesamtwissen?
Bateson behandelt den Zugriff auf unser Gesamtwissen neben den Möglichkeiten Lernen/Übung, Drogenkonsum und Traumdeutung vorwiegend anhand der Gestaltung und Rezeption von primitiver, d.h. nonverbaler Kunst. Dort werden ganzheitliche Kenntnisse und Fertigkeiten in ästhetische Formen umgesetzt.
Welche Frage stellt sich der Betrachter von primitiver Kunst laut Bateson?
Der Betrachter von primitiver Kunst stellt sich die Frage: "In welchem Ausmaß wurde im Kunstwerk die Integration von bewussten und unbewussten Wissen in entsprechende Formen transformiert?"
- Citar trabajo
- Michael Sperer (Autor), 2008, Geist und Ganzheitlichkeit nach Gregory Bateson, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140090