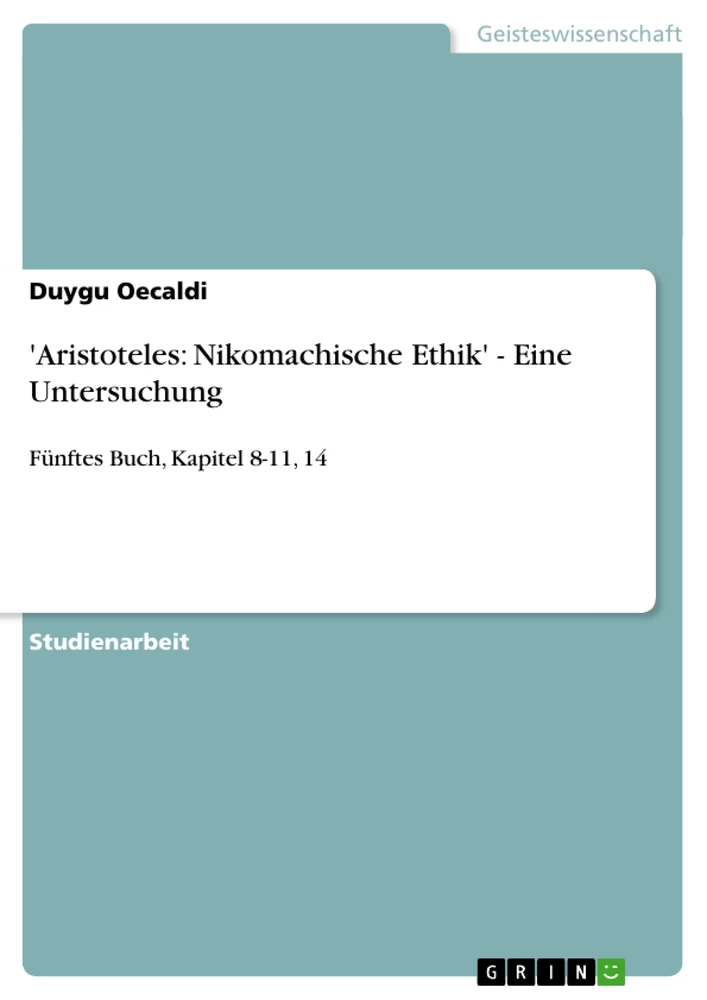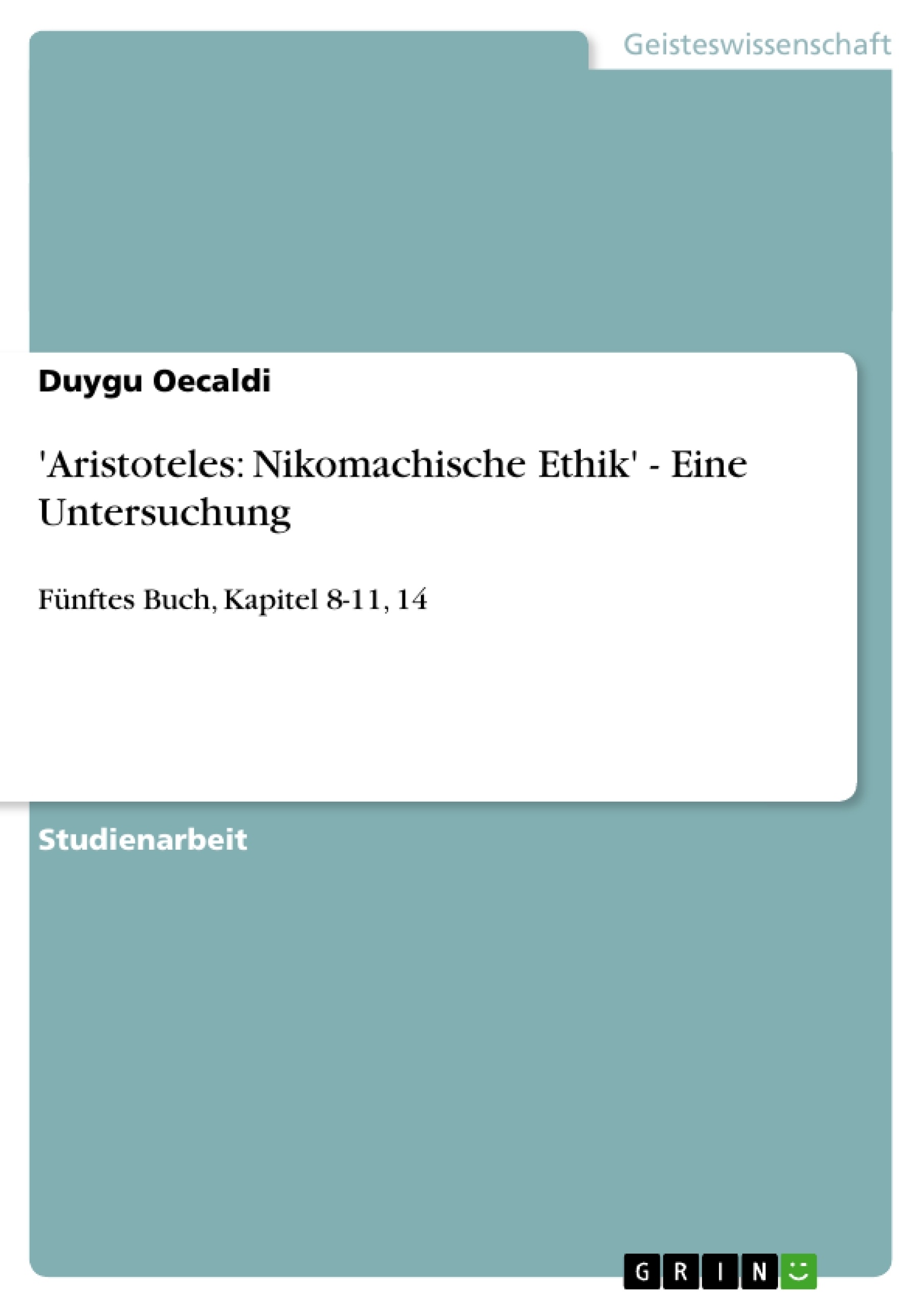Die Ausarbeitung zu Aristoteles´ Werk „Nikomachische Ethik“ beinhaltet zum Fünften Buch die Kapitel 8-11 und 14. Meine Strukturierung entspricht seinen Kapiteln, da es am sinnvollsten ist, die Zäsuren, die er vorgenommen hat, beizubehalten, um den Inhalt besser darlegen zu können.
Näher vorgestellt werden die verschiedenen Typen von Gerechtigkeit.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Hauptteil
2.1 Kapitel 8
2.2 Kapitel 9
2.3 Kapitel 10
2.4 Kapitel 11
2.5 Kapitel 14
3. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die Ausarbeitung meines Referats zu Aristoteles´ Werk „Nikomachische Ethik“ beinhaltet zum Fünften Buch die Kapitel 8-11 und 14. Meine Strukturierung entspricht seinen Kapiteln, da es am sinnvollsten ist, die Zäsuren, die er vorgenommen hat, beizubehalten, um den Inhalt besser darlegen zu können.
2. Hauptteil
2.1 Kapitel 8
Im achten Kapitel des Fünften Buches untersucht Aristoteles inwiefern die Widervergeltung einer Form der Gerechtigkeit, die er zuvor definiert hat, zu zuordnen ist.
Einleitend werden zwei Positionen vorgestellt, welche die Widervergeltung als das Gerechte schlechthin darstellen (vgl. 1132b21-25). Der Begriff der Widervergeltung bedeutet Gleiches mit Gleichem zu sühnen, ganz nach dem Prinzip: „Auge um Auge“ und „Zahn um Zahn“.
Anschließend stellt er fest, dass die Widervergeltung nicht mit der distributiven oder der kommutativen Gerechtigkeitsform der partikularen Gerechtigkeit übereinstimmt. Veranschaulicht wird durch ein Beamten- Beispiel wie sich die Widervergeltung unmöglich konstant gewähren kann, wenn es sich bei den beteiligten Personen nicht um Ebenbürtige handelt. Zum Beispiel darf derjenige, der einen Beamten schlägt, geschlagen werden und sollte sogar eine zusätzliche Bestrafung erhalten, wobei sich dies umgekehrt nicht entsprechend verhalten würde (vgl. 1132b30). Damit ist die distributive Gerechtigkeit, die entsprechend der Würdigkeit der Person austeilt, vorab ausgeschlossen. Bleibt bei der kommutativen Gerechtigkeitsform näher zu prüfen, ob sich die Widervergeltung dort findet.
Er führt nun die Freiwilligkeit bzw. die Unfreiwilligkeit als elementaren Faktor der weiteren Untersuchung an, denn in dem Fall der Unfreiwilligkeit gibt es keine Widervergeltung, dagegen im Falle der Freiwilligkeit, die unter anderem im Bereich des Tausches, Kaufes und Verkaufes vorkommt (vgl. 1132b31), schon. In dem Bereich der Freiwilligkeit sind nämlich Wechselbeziehungen grundlegend, die nicht funktionieren würden, wenn es keine Form der Widervergeltung geben würde, die Gutes mit Gutem und auch Schlechtes mit Schlechtem begegnet (vgl. 1132b31). Es handelt sich um eine proportionale Vergeltung, die nicht nach der Gleichheit verfährt, jedoch letztlich eine Gleichheit herstellt (vgl. 1132b31 und 1133a10). Aristoteles verdeutlicht dies durch eine Diagonalverbindung, wenn von zwei Personen die Güter auf einen Nenner gebracht werden, d.h., dass beispielsweise ein Haus dem Wert von fünf Betten entspricht (vgl. 1133b25). Diese Widervergeltung, die im freiwilligen Teil der kommutativen Gerechtigkeit vorkommt, stellt eine Prämisse zur Erhaltung des Staates dar. Denn es ist ein Ausgleich zur Gleichheit von Dingen, die sonst untereinander ungleich sind. Damit wird eine Vergleichbarkeit hergestellt (vgl. 1133a19), die zum Tausch notwendig ist, denn diese muss aufgrund von bestimmten, z.T. wechselseitigen Bedürfnissen gegeben sein.
An dieser Stelle wird auch die Rolle des Geldes verdeutlicht: es schafft „eine Mitte“ (1133a20); denn als Vertreter der Bedürfnisse erleichtert es den Tauschhandel, vor allem dann, wenn die Wertigkeiten vergleichbarer Dinge zu weit auseinander liegen. Wenn einem Haus 100 Paar Schuhe äquivalent sind, braucht derjenige mit dem Bedürfnis nach Schuhen bestimmt keine so große Menge. Damit erklärt sich auch, dass das Geld nicht von Natur, sondern von den Menschen eingeführt worden ist (vgl. 1133a30), damit „jeder das Seinige erhält“ (1133b3), welches sich nicht im Sinne der Proportionalität, sondern im Sinne der Gleichheit durch die Vergleichbarkeit verhält. Auch ermöglicht das Geld gerade dadurch einen bequemeren späteren Tausch (1133b11). Der Wert des Geldes ist zwar veränderlich, verhält sich jedoch relativ stabil (1133b134), sodass es eine Erleichterung ist, im Falle eines späteren Bedürfnisses zum Geld zurückzugreifen und es als „Bürge“ (1133b13) zu behandeln.
2.2 Kapitel 9
Im folgenden neunten Kapitel definiert Aristoteles die Gerechtigkeit sowie Ungerechtigkeit aus der vorausgehenden Analyse.
Er bezeichnet das gerechte Handeln als die Mitte zwischen dem Unrechttun und Unrechtleiden (vgl. 1133b30). Man handelt laut Aristoteles also gerecht, wenn man sich selbst nicht begünstigt, aber auch nicht aufopferungsvoll ist. Die Gerechtigkeit entspricht der Mitte, ist aber nicht identisch mit der Tugend, die ebenfalls eine Mitte darstellt, weil sie vielmehr die Mitte schafft (vgl. 1133b33).
Mit der Ungerechtigkeit verhält es sich dann gegensätzlich. Die Ungerechtigkeit „schafft die Extreme“ (1133b34), womit entweder Mangel oder Übermaß gemeint ist. Entsprechend bedeutet dies, dass die Handlung entweder zum eigenen Vorteil oder zum eigenen Nachteil ausginge. Als wichtiger Faktor muss nach der proportionalen Gleichheit gehandelt werden, wobei nicht nur die eigene Person, sondern auch die anderen beachtet werden (vgl. 1134a6). Ein Handeln gegen die Proportion entspricht einer Handlung zum eigenen Vorteil und gleichzeitig einem entsprechenden Nachteil für das Gegenüber.
Aristoteles behauptet, dass bei der ungerechten Tat, das Unrechtleiden das geringere Übel ist als das Unrechttun. Die Handlung einer Person gegenüber zwei weiteren Personen müsste gleich im Sinne der Austeilung, dass beiden identisches widerfährt, sein, denn sobald der eine Zuviel und der andere Zuwenig bekommt, was zufällig (vgl. 1134a12) geschieht, tut der austeilende Unrecht und von denjenigen, die ausgeteilt bekommen, tut derjenige, dem Zuviel zugewiesen wird, ebenso Unrecht, dagegen derjenige, der Zuwenig erhält, muss Unrecht leiden (1134a10).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Aristoteles unter „Widervergeltung“?
Widervergeltung bedeutet, Gleiches mit Gleichem zu sühnen („Auge um Auge“), wobei Aristoteles dies differenziert im Bereich des Tausches betrachtet.
Welche Rolle spielt das Geld in der Nikomachischen Ethik?
Geld dient als „Mitte“ und Vertreter der Bedürfnisse, um unterschiedliche Güter vergleichbar und tauschbar zu machen.
Wie definiert Aristoteles gerechtes Handeln?
Gerechtes Handeln ist die Mitte zwischen dem Unrechttun (Vorteil für sich selbst) und dem Unrechtleiden (Nachteil für sich selbst).
Was ist distributive Gerechtigkeit?
Es ist die Form der Gerechtigkeit, die Güter entsprechend der Würdigkeit oder dem Verdienst der beteiligten Personen verteilt.
Ist Geld eine natürliche oder menschliche Erfindung?
Laut Aristoteles existiert Geld nicht von Natur aus, sondern wurde von Menschen eingeführt, um den Tauschhandel zu erleichtern.
- Quote paper
- Duygu Oecaldi (Author), 2008, 'Aristoteles: Nikomachische Ethik' - Eine Untersuchung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140104