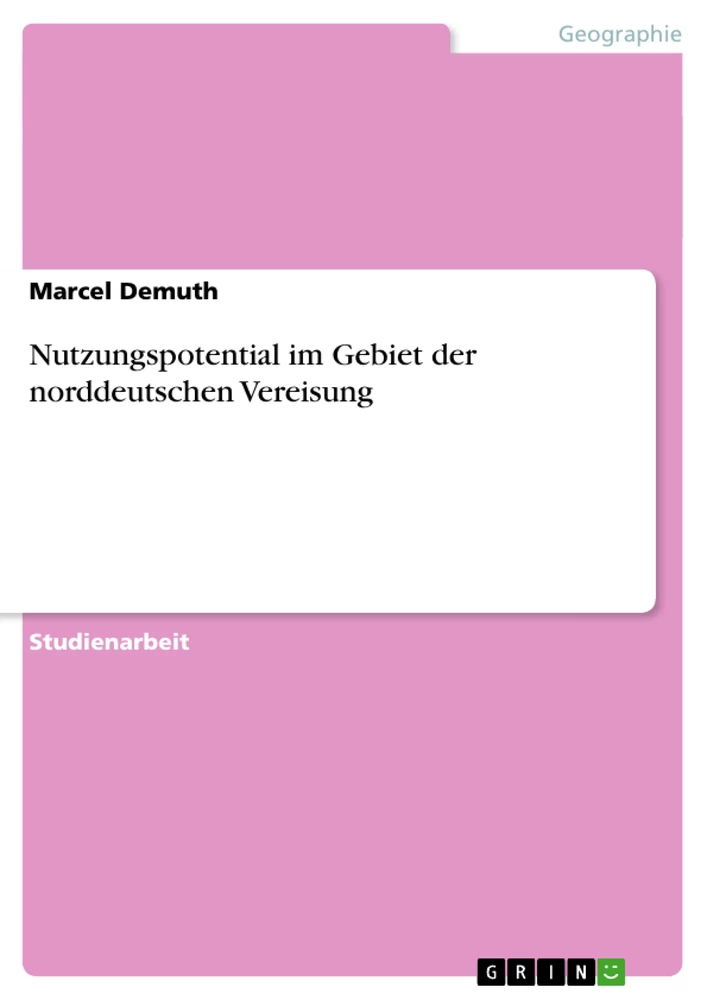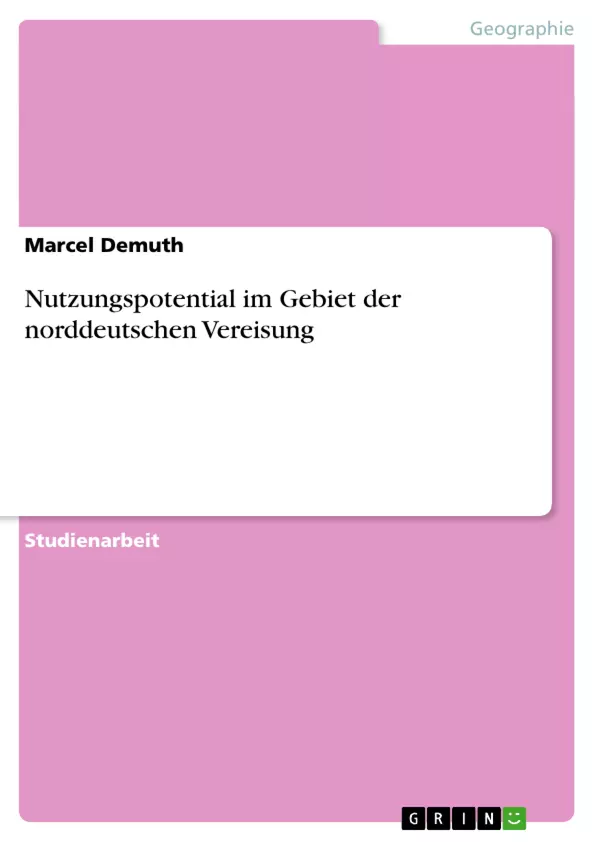Seit jeher bedient sich der Mensch an dem, was die Natur ihm zur Verfügung stellt. Im
Laufe der Geschichte gab es eine stetig steigende Entwicklung im Bezug auf die Nutzung
der Reichtümer der Erde. Dieses Wachstum war eng verbunden mit der technologischen,
sozialen, wirtschaftlichen und demographischen Entwicklung der Menschheit. In Folge
dessen hat sich das so genannte Naturraumdargebot, definiert als die gesamten „von [der]
Natur bereitgestellten Reichtümer […], ohne Differenzierung der Nutzungsmöglichkeiten“
(LESER 2005, S. 599), im Laufe der Menschheitsentwicklung reduziert. Auschlaggebend
für diese Entwicklung sind die letzten 150 Jahre, in denen der Mensch durch extensive
Ausbeutung, bedingt durch ein rasantes Bevölkerungswachstums und einer Vielzahl technologischer
Innovationen, diese Reichtümer stark dezimierte. Da in vielen Fällen die Nutzungsmöglichkeiten
jedoch aus technischen, finanziellen oder politischen Gründen begrenzt
sind, beschränkt sich diese „Ausbeutung“ auf die so genannten Geopotentiale, welches
„im weitesten Sinne die natürlichen Ressourcen der Erde, die wirtschaftlich nutzbar
sind“ (LESER 2005, S. 290) beschreibt. Wie gut eine solche Ressource für die Menschen
nutzbar ist, beschreibt das Nutzungspotential. Dieses determiniert sich aus verschieden
geographischen und geologischen Faktoren, je nach Nutzungsart. Diese Faktoren, den daraus
entstehend Nutzungsmöglichkeiten und deren Verbreitung werden im Folgenden näher
erläutert.
Gliederung
I Abbildungsverzeichnis
II Einleitung
1 räumliche Eingliederung
2 Potential und Nutzung
2.1 Boden und Klima – Landwirtschaft
2.2 Geologie und Tektonik – Rohstoffe
2.2.1 Salz
2.2.2 Erdöl und Erdgas
2.2.3 Kohle
2.3 Tourismus
3 Fazit
III Literatur- und Quellenverzeichnis
I Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Gebiet der norddeutschen Vereisung
Abb. 2: Niederschlagssummen
Abb. 3: Bodengüte
Abb. 4: Salzstock im Untergrund von Norddeutschland
Abb. 5: Salzstöcke in Norddeutschland
Abb. 6: statische Reichweite der Reserven Öl und Gas
Abb. 7: landschaftliche Attraktivität
II Einleitung
Seit jeher bedient sich der Mensch an dem, was die Natur ihm zur Verfügung stellt. Im Laufe der Geschichte gab es eine stetig steigende Entwicklung im Bezug auf die Nutzung der Reichtümer der Erde. Dieses Wachstum war eng verbunden mit der technologischen, sozialen, wirtschaftlichen und demographischen Entwicklung der Menschheit. In Folge dessen hat sich das so genannte Naturraumdargebot, definiert als die gesamten „von [der] Natur bereitgestellten Reichtümer […], ohne Differenzierung der Nutzungsmöglichkeiten“ (Leser 2005, S. 599), im Laufe der Menschheitsentwicklung reduziert. Auschlaggebend für diese Entwicklung sind die letzten 150 Jahre, in denen der Mensch durch extensive Ausbeutung, bedingt durch ein rasantes Bevölkerungswachstums und einer Vielzahl technologischer Innovationen, diese Reichtümer stark dezimierte. Da in vielen Fällen die Nutzungsmöglichkeiten jedoch aus technischen, finanziellen oder politischen Gründen begrenzt sind, beschränkt sich diese „Ausbeutung“ auf die so genannten Geopotentiale, welches „im weitesten Sinne die natürlichen Ressourcen der Erde, die wirtschaftlich nutzbar sind“ (Leser 2005, S. 290) beschreibt. Wie gut eine solche Ressource für die Menschen nutzbar ist, beschreibt das Nutzungspotential. Dieses determiniert sich aus verschieden geographischen und geologischen Faktoren, je nach Nutzungsart. Diese Faktoren, den daraus entstehend Nutzungsmöglichkeiten und deren Verbreitung werden im Folgenden näher erläutert.
1 räumliche Eingliederung
Abbildung 1: Gebiet der norddeutschen Vereisung
(Quelle: ECKART (2001), S. 1)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Gebiet der norddeutschen Vereisung deckt sich weitestgehend mit dem des Norddeutschen Tieflandes. Auf Grund seiner glazialen Vorgeschichte kann der Betrachtungsraum in Alt- und Jungmoränengebiet unterteilt werden. Es ist ein relativ flaches und ebenes Gebiet, welches im Westen durch die Ems und im Osten durch die Oder abgegrenzt wird (Haversath 1997, S. 7). Die höchste Erhebung, der Fläming östlich von Magdeburg, ist gerade einmal 201 Meter über NN. Als nördliche Abgrenzung fungieren die Küsten von Nord- und Ostsee. Problematischer ist hingegen die südliche Abgrenzung des Betrachtungsraumes. Hier stellen die maximalen Eisausbreitungen – im westlichen Bereich die Maximalausbreitung der Saalevereisung, im östlichen Bereich die Maximalausbreitung der Elstervereisung – die Grenzen des Betrachtungsraumes dar. In diesen Bereichen sind die Grenzen weniger deutlich ausgeprägt. Teilweise befindet sich die maximale Eisausbreitungslinie im Übergangsgebiet zwischen Tiefland und Mittelgebirgen, was eine exakte Abgrenzung erschwert. In Abbildung ist die maximale Eisausbreitung anhand der roten Linie dargestellt. Es ist ersichtlich, dass die Vereisungslinie stellenweise über die Fläche des Tieflandes (beige Farbe) bis in den Mittelgebirgsraum reicht (Glaser et al. 2007, S. 109).
2 Potential und Nutzung
Die verschiedensten Nutzungsarten und –möglichkeiten setzten bestimmte geographische und geologische Bedingungen bzw. Faktoren voraus. Bezüglich der landwirtschaftlichen Nutzung sind die Böden und das Klima von entscheidender Bedeutung. Die Böden und deren Entwicklung wiederum hängen eng mit dem Ausgangssubstrat, dem Relief aber ebenso von den klimatischen Bedingungen ab. Ein differenzierteres Bild ergibt sich für die Rohstoffe. Für deren Entstehung und die Bildung von Lagerstätten sind tektonische und geologische Prozesse ausschlaggebend. Aber auch klimatische Faktoren sind essenziell, jedoch nicht die heutigen, sondern die erdgeschichtlich bedeutend früheren klimatischen Bedingungen. Der touristische Nutzen benötigt ebenso bestimmt Faktoren, wie beispielsweise spezielle klimatische Bedingungen (jedoch sehr unterschiedlich je nach Tourismuszweig) und landschaftliche Gegebenheiten. Aber im Gegensatz zu den bereits genannten Nutzungsarten kann touristisches Nutzenpotential auch durch anthropologisches Einwirken entstehen. Die genannten Nutzungsarten werden in den folgenden Abschnitten genauer betrachtet.
2.1 Boden und Klima – Landwirtschaft
Das Potential eines Raumes für die landwirtschaftliche Nutzung wird durch verschiedene Faktoren bestimmt. Neben kulturellen und technischen Faktoren sind es grundlegend die Böden und deren „Qualität“, aber ebenso das Klima und das Relief.
Abbildung 2: Niederschlagssummen
(Quelle: GLASER et al. (2007), S. 32)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die klimatischen Bedingungen im Raum der norddeutschen Vereisung lassen sich folgendermaßen beschreiben: Es liegt ein gemäßigtes Klima vor, welches durch milde Temperaturen und geringe Niederschläge charakterisiert wird. In Abbildung 2 werden die jährlichen Niederschlagssummen dargestellt. Zu erkennen ist, dargestellt durch hellere bzw. dunklere Farben, dass es einen Unterschied in den Niederschlagwerten zwischen dem westlichen und östlichen Gebiet gibt. Sind die jährlichen Niederschlagssummen im Westen mit 700 bis 800 mm schon gering, werden diese im Osten nochmals unterschritten. Hier sind jährliche Niederschlagssummen von 500 bis 600 mm zu verzeichnen. Die Grundmuster der Niederschlags- und Temperaturverteilung werden durch verschiedene regionale und lokale Besonderheiten im Relief modifiziert. In Abbildung 2 wird dies durch die hell markierten Bereiche östlich des Harzes deutlich. Durch die Abschirmwirkung des Harzes stellen diese Räume die trockensten Gebiete in ganz Deutschland dar (Haversath 1997, S. 40-43).
Diese Besonderheiten haben, neben dem Ausgangssubstrat, ebenso Einfluss auf die Böden und deren Entwicklung. Die Ausgangssubstrate der Böden im Betrachtungsraum sind glaziale Ablagerungen. Auf Grund der unterschiedlichen Dauer der Einwirkungszeit der exogenen Kräfte haben sich sehr unterschiedliche Böden entwickeln können. Da im Bereich des Jungmoränenlandes Erosions- und Auswaschungsprozess erst seit rund 12.000 Jahren wirken können, finden sich dort noch sehr fruchtbare und kalkhaltige Böden (Bauer 2005, S. 176). Typische Böden dieser Raumeinheit sind Parabraunerden und Pseudogleye (Glaser et al. 2007, S. 68).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "Naturraumdargebot"?
Es beschreibt die Summe aller von der Natur bereitgestellten Reichtümer eines Raumes, unabhängig von ihrer aktuellen Nutzungsmöglichkeit.
Welches Gebiet umfasst die norddeutsche Vereisung?
Das Gebiet deckt sich weitgehend mit dem Norddeutschen Tiefland und wird durch die maximalen Eisausbreitungen der Saale- und Elstervereisung begrenzt.
Welche Rohstoffe sind in Norddeutschland wirtschaftlich nutzbar?
Besonders bedeutend sind Salzvorkommen (Salzstöcke), Erdöl, Erdgas sowie in bestimmten Bereichen auch Kohle.
Warum sind die Böden im Jungmoränenland fruchtbarer?
Da dort exogene Kräfte wie Auswaschung erst seit etwa 12.000 Jahren wirken, sind die Böden oft noch kalkhaltiger und nährstoffreicher als im Altmoränenland.
Wie beeinflusst das Relief die Landwirtschaft in Norddeutschland?
Obwohl das Gebiet flach ist, führen kleine Erhebungen wie der Fläming oder die Abschirmwirkung von Gebirgen (z. B. Harz) zu regionalen Unterschieden bei Niederschlag und Bodenqualität.
- Citation du texte
- B.Sc. Marcel Demuth (Auteur), 2009, Nutzungspotential im Gebiet der norddeutschen Vereisung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140129