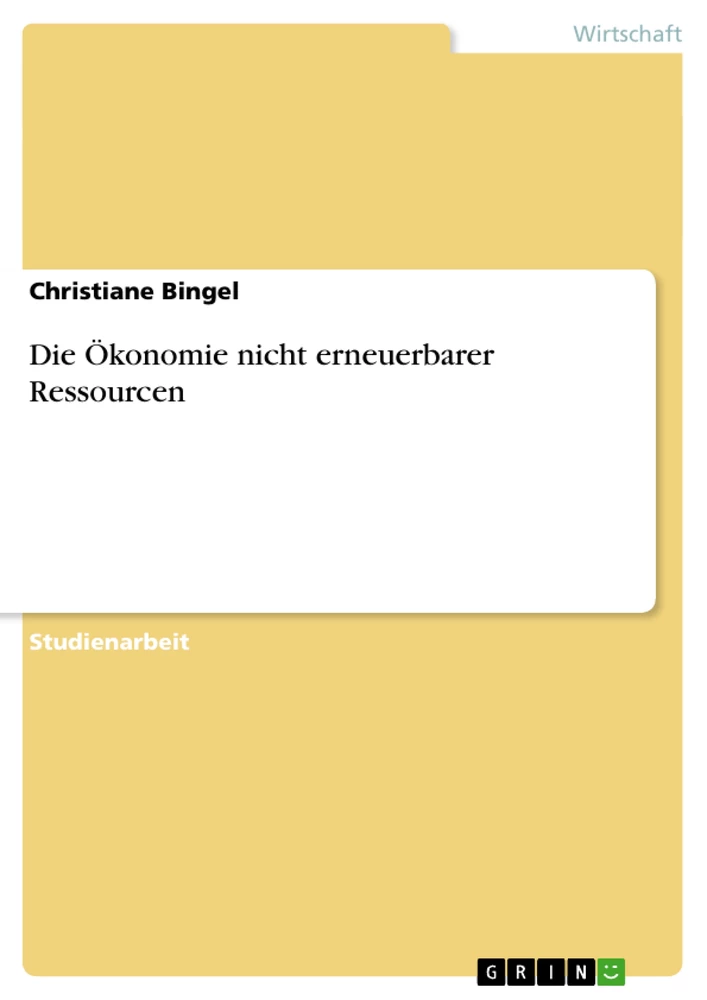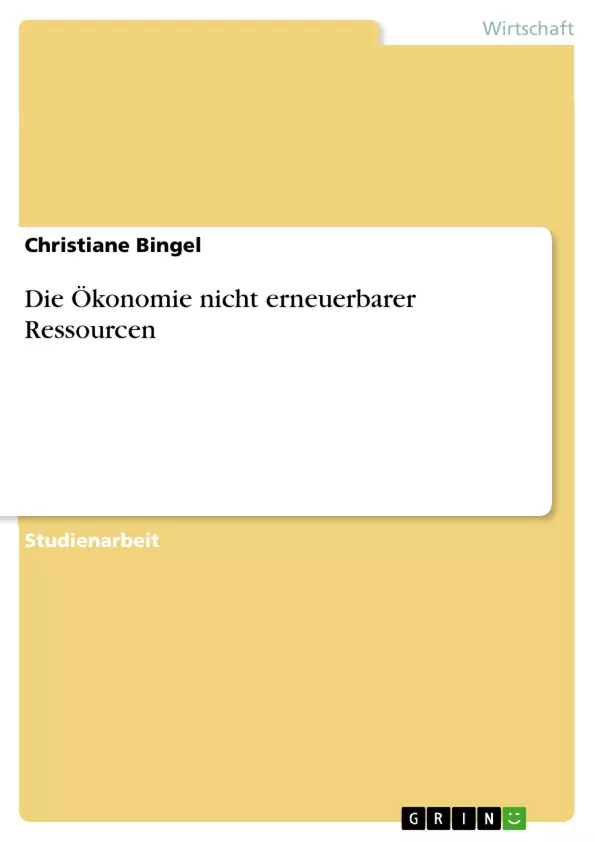„Energie ist ein wichtiger Motor unserer Gesellschaft und Industrie. Ihre Bereitstellung ist eine essentielle Voraussetzung für das Funktionieren des öffentlichen Lebens.“
Der Energieverbrauch der Menschheit schnellt nicht zuletzt wegen aufkeimender Industrialisierungsbestrebungen von Schwellen- und Entwicklungsländern und des scheinbar unstillbaren Durstes der Industrieländer nach mehr Leistung immer weiter in die Höhe. Würden unserer Gesellschaft die Energiequellen entzogen, bräche das strukturierte Leben, wie wir es kennen, unweigerlich zusammenbrechen.
Zu den wichtigsten Energieträgern unserer Zeit zählen gegenwärtig Erdöl, Erdgas, Kohle und Uran. Ihnen ist gemein, dass sie in absehbarer Zeit erschöpft sein werden. Vor allem Kohle und Erdöl sind seit Jahrzehnten unverzichtbar. Gleichzeitig zählen sie als die CO2-intensivsten Energierohstoffen zu den „Dreckschleudern“ dieses Planeten.
Diese Arbeit soll einen Einblick in die Ökonomie nicht erneuerbarer Ressourcen gewähren. Zu Beginn werden in Kapitel 2 einige grundlegende Begriffe erklärt sowie die globale Ressourcensituation als auch die Reichweite der wichtigsten Energieträger dargelegt. Im dritten Teil erfolgt eine ausführliche formale Analyse der Ressourcenproblematik. Diese beinhaltet neben der Erläuterung des Generationenkonflikts, der Modellierung eines Grundmodells und der Erklärung der Hotelling-Regel auch die Untersuchung der Ressourcennutzung auf dem Konkurrenz- und dem Monopolmarkt ohne und mit Berücksichtigung der Abbaukosten und von Explorationstätigkeiten. Weiterhin wird erklärt, wie Knappheit ökonomisch gemessen werden kann und ob ein Wachstumsstopp Sinn macht. Abschließend wird ein kurzer Ausblick gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen
- 2.1 Begriffliche Abgrenzung
- 2.2 Die globale Situation
- 2.3 Reichweite der wichtigsten Energieträger
- 3. Modellierung des Ressourcenproblems
- 3.1 Der Generationenkonflikt - Ein intertemporales Allokationsproblem
- 3.2 Das Grundmodell
- 3.3 Die Hotelling-Regel
- 3.4 Vollständige Märkte
- 3.5 Monopolistische Ressourcenbesitzer
- 3.6 Berücksichtigung von Extraktionskosten
- 3.7 Exploration
- 3.8 Knappheit von Ressourcen
- 3.9 Wachstumsstopp?
- 4. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Ökonomie nicht erneuerbarer Ressourcen. Ziel ist es, einen Überblick über die grundlegenden Konzepte und die Modellierung der Ressourcenproblematik zu geben. Die Arbeit analysiert die globale Situation und die Reichweite wichtiger Energieträger.
- Begriffliche Abgrenzung von Ressourcen und Reserven
- Modellierung des Ressourcenproblems anhand verschiedener Marktstrukturen
- Der Generationenkonflikt als intertemporales Allokationsproblem
- Die Hotelling-Regel und ihre Bedeutung
- Knappheit von Ressourcen und die Frage nach einem Wachstumsstopp
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die essentielle Rolle von Energie für die Gesellschaft und Industrie und hebt den steigenden Energieverbrauch hervor, insbesondere durch Schwellen- und Entwicklungsländer. Sie benennt die wichtigsten, nicht erneuerbaren Energieträger (Erdöl, Erdgas, Kohle, Uran) und deren begrenzte Verfügbarkeit, sowie deren negative Umweltfolgen. Die Arbeit kündigt die folgenden Kapitel mit ihren jeweiligen Schwerpunkten an.
2. Grundlagen: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für das Verständnis der Ressourcenproblematik. Es beginnt mit der begrifflichen Abgrenzung von Ressourcen und Reserven, wobei zwischen verschiedenen Ressourcenarten (biogenetisch, erschöpflich, regenerierbar) differenziert wird. Anschließend wird die globale Situation der Ressourcen und die voraussichtliche Reichweite der wichtigsten Energieträger skizziert. Die klare Definition der zentralen Begriffe schafft die Grundlage für die nachfolgende, detailliertere Analyse.
3. Modellierung des Ressourcenproblems: Dieses Kapitel bietet eine umfassende formale Analyse der Ressourcenproblematik. Es behandelt den Generationenkonflikt als intertemporales Allokationsproblem, entwickelt ein Grundmodell und erläutert die Hotelling-Regel. Die Analyse umfasst die Betrachtung der Ressourcennutzung auf Wettbewerbs- und Monopolmärkten, jeweils mit und ohne Berücksichtigung von Abbaukosten und Exploration. Schließlich wird die ökonomische Messung von Knappheit und die Frage eines sinnvollen Wachstumsstopps diskutiert. Das Kapitel verbindet theoretische Modelle mit der realen Herausforderung der Ressourcenknappheit.
Schlüsselwörter
Nicht erneuerbare Ressourcen, Ressourcenökonomie, Energieträger, Generationenkonflikt, Hotelling-Regel, Marktstrukturen (vollständige Märkte, Monopol), Extraktionskosten, Exploration, Ressourcenknappheit, Wachstumsstopp.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Ökonomie nicht erneuerbarer Ressourcen
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich mit der Ökonomie nicht erneuerbarer Ressourcen. Sie gibt einen Überblick über grundlegende Konzepte und die Modellierung der Ressourcenproblematik. Schwerpunkte sind die globale Situation und die Reichweite wichtiger Energieträger.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Begriffliche Abgrenzung von Ressourcen und Reserven, Modellierung des Ressourcenproblems anhand verschiedener Marktstrukturen (vollständige Märkte und Monopole), den Generationenkonflikt als intertemporales Allokationsproblem, die Hotelling-Regel und ihre Bedeutung, die Berücksichtigung von Extraktionskosten und Exploration, die ökonomische Messung von Ressourcenknappheit und die Frage nach einem Wachstumsstopp.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Einleitung, 2. Grundlagen (begriffliche Abgrenzung, globale Situation, Reichweite wichtiger Energieträger), 3. Modellierung des Ressourcenproblems (Generationenkonflikt, Grundmodell, Hotelling-Regel, verschiedene Marktstrukturen, Extraktionskosten, Exploration, Knappheit, Wachstumsstopp) und 4. Ausblick.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung betont die essentielle Rolle von Energie für Gesellschaft und Industrie, den steigenden Energieverbrauch (besonders in Schwellen- und Entwicklungsländern), die begrenzte Verfügbarkeit nicht erneuerbarer Energieträger (Erdöl, Erdgas, Kohle, Uran) und deren negative Umweltfolgen. Sie kündigt die Schwerpunkte der folgenden Kapitel an.
Was sind die Grundlagen, die im zweiten Kapitel behandelt werden?
Das zweite Kapitel klärt die begrifflichen Grundlagen: Abgrenzung von Ressourcen und Reserven (verschiedene Ressourcenarten: biogenetisch, erschöpflich, regenerierbar). Es skizziert die globale Situation der Ressourcen und die voraussichtliche Reichweite wichtiger Energieträger.
Wie wird das Ressourcenproblem modelliert (Kapitel 3)?
Kapitel 3 bietet eine formale Analyse: Der Generationenkonflikt wird als intertemporales Allokationsproblem dargestellt. Es wird ein Grundmodell entwickelt und die Hotelling-Regel erläutert. Die Analyse umfasst Wettbewerbs- und Monopolmärkte, mit und ohne Abbaukosten und Exploration. Schließlich werden ökonomische Messgrößen für Knappheit und die Frage eines Wachstumsstopps diskutiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Nicht erneuerbare Ressourcen, Ressourcenökonomie, Energieträger, Generationenkonflikt, Hotelling-Regel, Marktstrukturen (vollständige Märkte, Monopol), Extraktionskosten, Exploration, Ressourcenknappheit, Wachstumsstopp.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, einen Überblick über die grundlegenden Konzepte und die Modellierung der Ressourcenproblematik zu geben und die globale Situation sowie die Reichweite wichtiger Energieträger zu analysieren.
- Citar trabajo
- Christiane Bingel (Autor), 2008, Die Ökonomie nicht erneuerbarer Ressourcen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140137