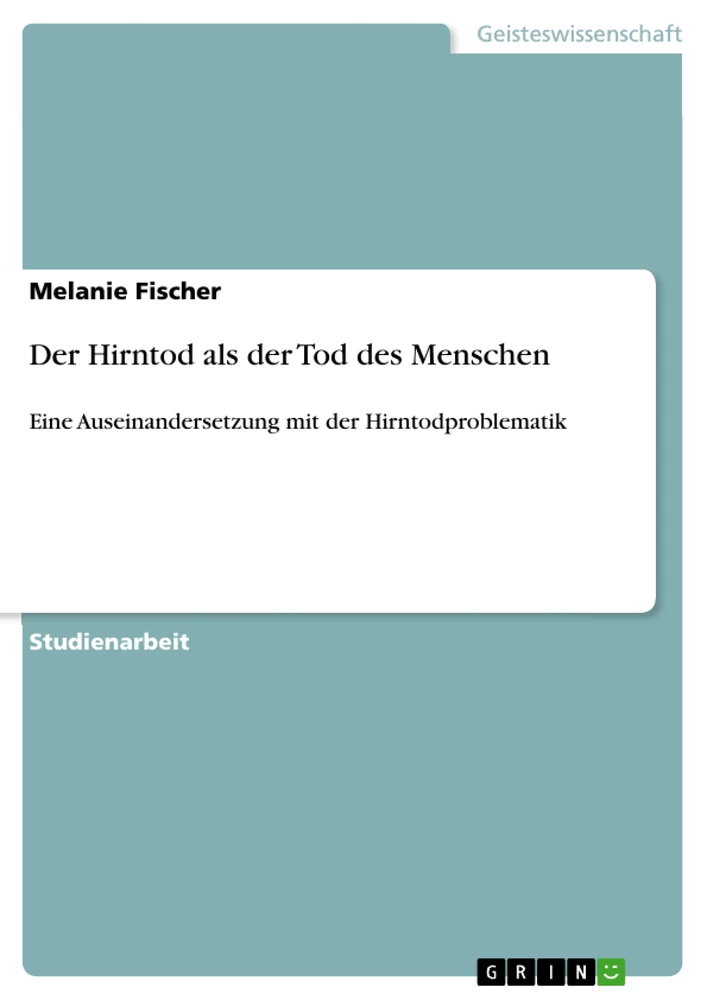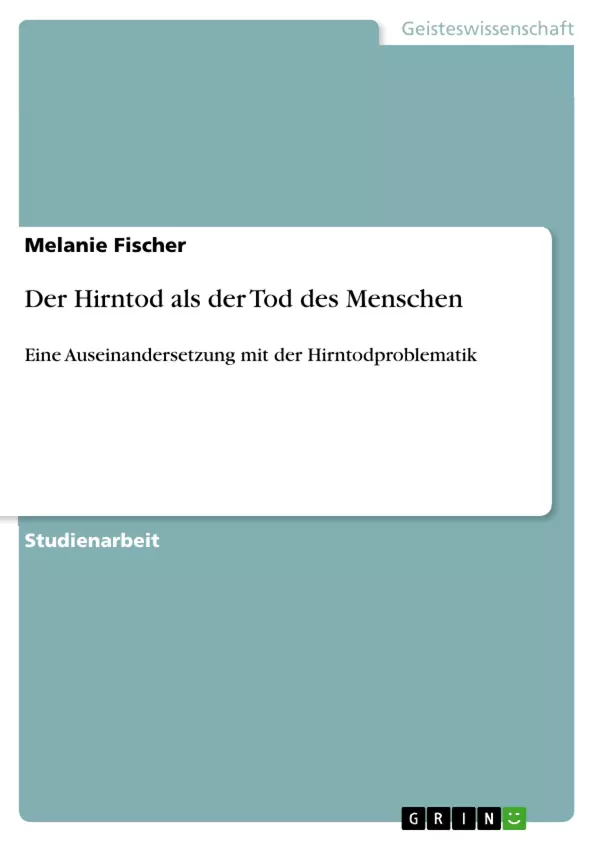Der vorliegende Text beschäftigt sich mit der Hirntoddebatte.
Im Zuge der fortschreitenden Entwicklung der Transplantationsmedizin erfolgte eine Infragestellung der klassischen Definition des Todes als Herz-Kreislauf- und Atemstillstand. Die Abkehr vom damals gültigen Todeskonzept wurde schließlich 1969 mit der Etablierung des Coma dépassé, gleichbedeutend mit Hirntod, als neues Kriterium für die Diagnose des bereits eingetretenen Todes des Menschen durch eine Ad-hoc-Kommission der amerikanischen Harvard Medical School vollzogen. Patienten im irreversiblen Koma wurden aufgrund dieser Gleichsetzung von Gehirnversagen und Tod schon vor der Beendigung aller intensivmedizinischen Behandlungsmaßnahmen für tot erklärt. „Warum [aber] soll denn eigentlich der komatöse Patient, dessen Herz- und Atmungstätigkeit künstlich unterstützt werden, kein Leben mehr haben, also tot sein?“ ist die entscheidende Frage, mit der sich die vorliegende Arbeit beschäftigt. Die „Unanschaulichkeit des Hirntodes“ und der Zusammenhang zur Transplantationsmedizin lassen prinzipielle Zweifel an der Gültigkeit des Hirntodkonzeptes aufkommen. So wird in dieser Arbeit von der These ausgegangen, dass der Tod des Organs Gehirn nicht gleichbedeutend mit dem Tod des Menschen als ganzheitliches Individuum ist und der Hirntod ein Übergangsstadium innerhalb des sich irreversibel fortsetzenden Sterbeprozesses darstellt, nicht aber schon dessen endgültiges Ende.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Hirntodkonzept
- Todesbegriff(e)
- Definition Hirntod
- Diagnose Hirntod
- Vom Teilhirntod zum Ganzhirntod
- Ebenen des (Hirntodes)
- Kritik am Hirntodkonzept
- Die Hirntoddefinition als utilitaristisches Kalkül
- Zweifel am Hirntod als endgültigem Tod
- Die doppelte Begründung der Hirntodkonzeption
- Der Hirntod als endgültiger Bewusstseinsverlust und Ende der Person
- Der Hirntod als Desintegration der Einheit des Organismus
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Hirntodkonzept und seine philosophischen Implikationen. Sie hinterfragt die Gleichsetzung von Hirntod und Tod des Menschen als Ganzes und beleuchtet die ethischen Herausforderungen, die sich insbesondere im Kontext der Transplantationsmedizin ergeben.
- Der traditionelle Todesbegriff im Vergleich zum Hirntodkonzept
- Die medizinische Diagnose und Definition des Hirntods
- Ethische und philosophische Kritik am Hirntodkonzept
- Der Hirntod als endgültiger Bewusstseinsverlust oder als Desintegration des Organismus
- Der Zusammenhang zwischen Hirntodkonzept und Transplantationsmedizin
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Gleichsetzung von Hirntod und Tod des Menschen vor. Sie skizziert den historischen Wandel im Verständnis des Todes, ausgehend vom klassischen Verständnis von Herz-Kreislauf- und Atemstillstand hin zum Hirntodkonzept, das im Kontext der Entwicklung der Transplantationsmedizin entstand. Die Arbeit untersucht kritisch, ob der Tod des Gehirns tatsächlich dem Tod des Menschen als Ganzes entspricht und ob der Hirntod ein endgültiges oder ein Übergangsstadium darstellt. Die Unanschaulichkeit des Hirntods und der Zusammenhang mit der Transplantationsmedizin werden als zentrale Problemfelder hervorgehoben.
Das Hirntodkonzept: Dieses Kapitel beginnt mit einer Erörterung verschiedener Todesbegriffe. Es differenziert zwischen dem irreversiblen Erlöschen der Lebensfunktionen und dem partiellen Tod einzelner Organe. Es wird erklärt, dass der Tod des Gesamtorganismus nicht mit dem isolierten Funktionsverlust einzelner Organe gleichgesetzt werden kann. Die Unterscheidung zwischen klinischem und biologischem Tod wird erläutert, wobei der klinische Tod als ein Zustand definiert wird, in dem eine Reanimation noch möglich ist. Das Kapitel legt die Grundlage für die nachfolgende kritische Auseinandersetzung mit dem Hirntodkonzept.
Kritik am Hirntodkonzept: Dieses Kapitel analysiert die Kritik am Hirntodkonzept. Es diskutiert die Hirntoddefinition als pragmatisches Kalkül, hinterfragt die Endgültigkeit des Hirntods als Todeskriterium und untersucht die doppelte Begründung des Hirntodkonzepts: einmal als endgültiger Bewusstseinsverlust und Ende der Person, und zum anderen als Desintegration der Einheit des Organismus. Die jeweiligen Argumente werden ausführlich dargestellt und kritisch gewürdigt. Der ethische Konflikt, der durch die Verbindung von Hirntod und Transplantationsmedizin entsteht, wird kurz angerissen, ohne jedoch den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Philosophische Implikationen des Hirntodkonzepts
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Hirntodkonzept und seine philosophischen Implikationen. Sie hinterfragt die Gleichsetzung von Hirntod und Tod des Menschen als Ganzes und beleuchtet die ethischen Herausforderungen, die sich insbesondere im Kontext der Transplantationsmedizin ergeben.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt den traditionellen Todesbegriff im Vergleich zum Hirntodkonzept, die medizinische Diagnose und Definition des Hirntods, ethische und philosophische Kritik am Hirntodkonzept, den Hirntod als endgültigen Bewusstseinsverlust oder als Desintegration des Organismus und den Zusammenhang zwischen Hirntodkonzept und Transplantationsmedizin.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Hirntodkonzept, ein Kapitel zur Kritik am Hirntodkonzept und eine Zusammenfassung. Das Kapitel zum Hirntodkonzept behandelt verschiedene Todesbegriffe, die Diagnose des Hirntods und die Unterscheidung zwischen klinischem und biologischem Tod. Das Kapitel zur Kritik analysiert die Hirntoddefinition als pragmatisches Kalkül, hinterfragt die Endgültigkeit des Hirntods und untersucht die doppelte Begründung des Konzepts (Bewusstseinsverlust und Desintegration des Organismus).
Welche Kritikpunkte am Hirntodkonzept werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die Hirntoddefinition als utilitaristisches Kalkül, Zweifel an der Endgültigkeit des Hirntods als Todeskriterium und die doppelte Begründung des Hirntodkonzepts: einmal als endgültiger Bewusstseinsverlust und Ende der Person, und zum anderen als Desintegration der Einheit des Organismus. Der ethische Konflikt im Zusammenhang mit der Transplantationsmedizin wird ebenfalls angesprochen.
Wie wird der traditionelle Todesbegriff im Vergleich zum Hirntodkonzept dargestellt?
Die Arbeit vergleicht den traditionellen Todesbegriff (Herz-Kreislauf- und Atemstillstand) mit dem Hirntodkonzept, das im Kontext der Transplantationsmedizin entstand. Sie untersucht kritisch, ob der Tod des Gehirns tatsächlich dem Tod des Menschen als Ganzes entspricht.
Welche zentralen Fragen werden in der Einleitung gestellt?
Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Gleichsetzung von Hirntod und Tod des Menschen. Sie skizziert den historischen Wandel im Verständnis des Todes und hebt die Unanschaulichkeit des Hirntods und den Zusammenhang mit der Transplantationsmedizin als zentrale Problemfelder hervor.
Was ist die Kernaussage der Zusammenfassung der Kapitel?
Die Zusammenfassung der Kapitel fasst die Argumentationslinien der einzelnen Kapitel zusammen und verdeutlicht die kritische Auseinandersetzung mit dem Hirntodkonzept und seinen ethischen Implikationen, insbesondere im Kontext der Organtransplantation.
- Citation du texte
- Melanie Fischer (Auteur), 2008, Der Hirntod als der Tod des Menschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140160