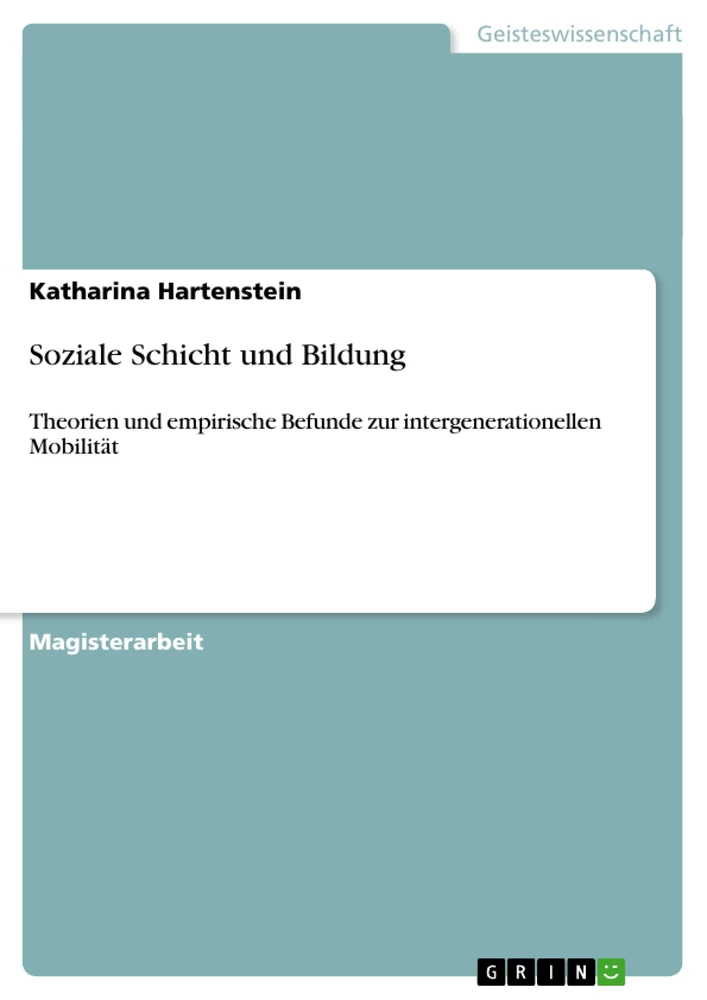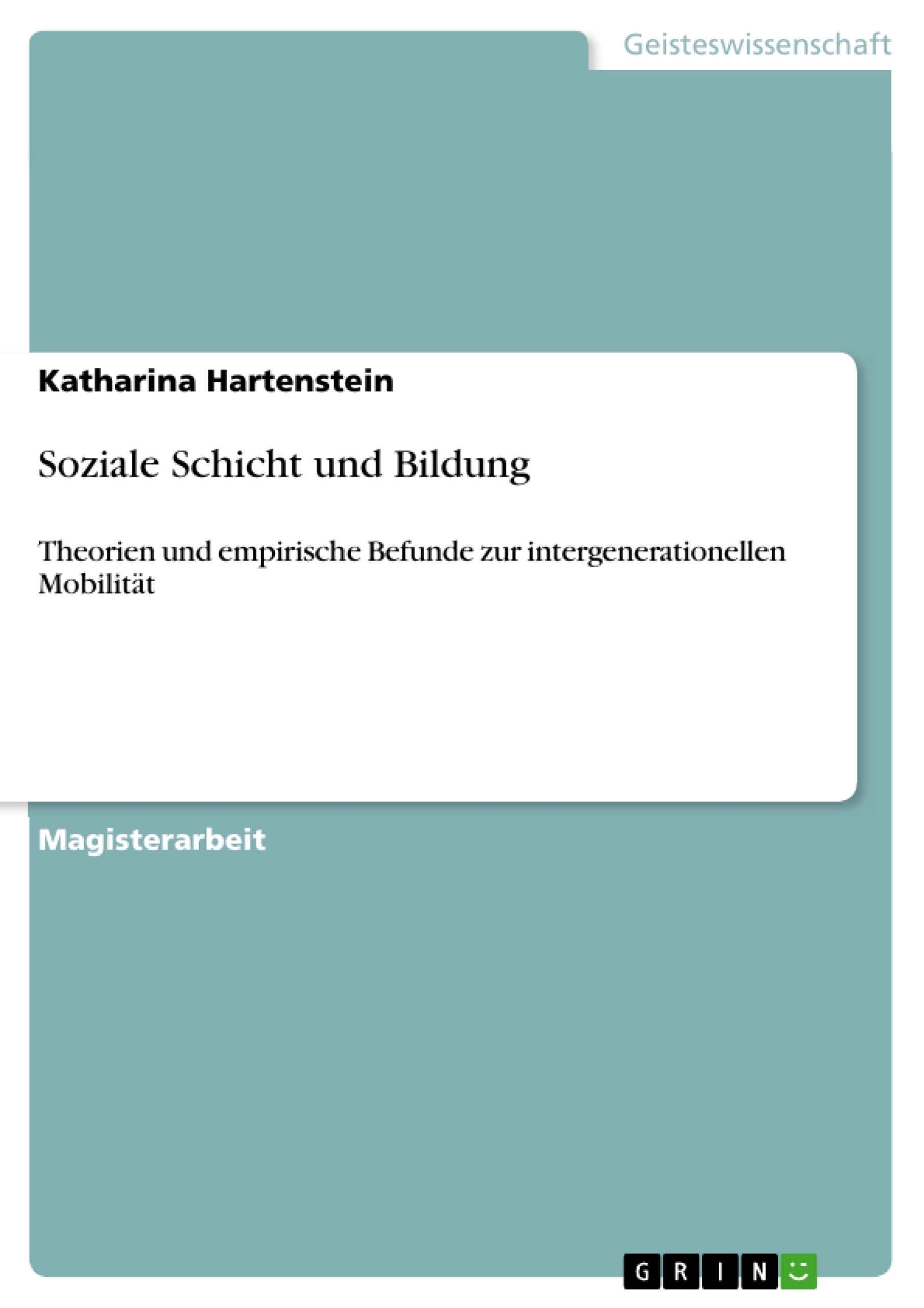Intelligenz und Bildung der Deutschen, so heißt es in dem Bestseller „Generation Doof. Wie blöd sind wir eigentlich?“ von Stefan Bonner und Anne Weiss, befinden sich auf einer Talfahrt – und das bereits seit Jahren. Die „Generation Doof“, wie die Autoren die nachwachsende Generation nennen, die sich durch bestimmte doofe Einstellungen, Interessen und Verhaltensweisen kennzeichnet und aus den heute 15- bis 25-Jähringen besteht, übernimmt langsam aber sicher das Ruder. Dabei ist Bildung nicht dasselbe wie Intelligenz. Individuen können über eine gewisse Grundbildung verfügen, „ohne dass sonderlich viel Licht im Oberstübchen brennt“ (Bonner/Weiss 2008: 53). Umgekehrt können sie auch intelligent sein, „ohne jemals ein Buch aufgeschlagen zu haben“ (ebd.: 53). Die Autoren resümieren: „Was unsere Bildung angeht, hapert es nicht nur an der Hardware, sondern auch an der Software ganz gewaltig. Vor allem Allgemeinwissen ist heute etwas, das man bekanntlich haben sollte – doch gemeinerweise wissen wir praktisch gar nichts“ (ebd.).
Zwar auf eine simple Art und Weise, aber dennoch treffend, machen sie deutlich, dass echtes Wissen nicht nur für den Hauptgewinn in einer Bildungsshow wichtig ist, sondern auch einen praktischen Nutzen hat (vgl. ebd.: 59). Dabei ist die wahllose Aneignung von enzyklopädischem Wissen nicht entscheidend. Heute ist im Umgang mit Wissen nicht der Fundus im eigenen Kopf entscheidend, sondern die Fähigkeit, sich aus dem unbegrenzten Wissensmeer jene Puzzelteile herauszusuchen und zusammenzusetzen, die nicht nur einen unscharfen Bildsalat ergeben, sondern ein stimmiges Gesamtbild (vgl. ebd.: 61).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bildung und Soziale Schicht
- Bildung
- Soziale Schicht
- Schichtspezifische Bildung
- Theoretische und methodische Erklärungen von Bildungsunterschieden
- Vorschulische Bildung
- Schulische Bildung
- Hochschulstudium und berufliche Bildung
- Zusammenfassung
- Intergenerationale Bildungsmobilität
- Bildungsexpansion und Bildungsaufstiege
- Zur Vererbung von Bildungsaufstiegen und Bildungs- bzw. Berufsstatus
- Zusammenfassung
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die soziale Selektivität von Bildung, wobei Bildung im weiteren Sinne von vorschulischer, schulischer und beruflicher Bildung verstanden wird. Der Schwerpunkt liegt auf der intergenerationalen Bildungsmobilität und den Einflussfaktoren der Herkunftsfamilie auf Bildungsunterschiede. Die Arbeit analysiert theoretische Ansätze zur Erklärung von Bildungsungleichheit und beleuchtet die Zusammenhänge zwischen Bildung, sozialer Schicht und den daraus resultierenden Lebenschancen.
- Soziale Selektivität von Bildung
- Intergenerationale Bildungsmobilität
- Einflussfaktoren der Herkunftsfamilie auf Bildungserfolg
- Theoretische Ansätze zur Erklärung von Bildungsunterschieden
- Zusammenhang zwischen Bildung, sozialer Schicht und Lebenschancen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der sozialen Selektivität von Bildung ein und verweist auf die Relevanz des Themas im Kontext gesellschaftlicher Ungleichheit. Sie erläutert den umfassenden Bildungsbegriff der Arbeit und benennt die intergenerationale Bildungsmobilität als zentralen Schwerpunkt. Die Einleitung verdeutlicht den Fokus auf soziostrukturelle Ansätze zur Erklärung von Bildungsunterschieden, wobei pädagogische und kontextuelle Aspekte bewusst ausgeklammert werden, um zunächst den Einfluss der Herkunftsfamilie zu beleuchten.
Bildung und Soziale Schicht: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es definiert die Begriffe „Bildung“ und „soziale Schicht“ und untersucht ihren Zusammenhang. Es werden schichtspezifische Bildungsverläufe analysiert, von der vorschulischen über die schulische bis hin zur Hochschul- und Berufsbildung. Die Zusammenfassung des Kapitels bündelt die Erkenntnisse über die Korrelation zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg und liefert einen Überblick über verschiedene theoretische und methodische Ansätze zur Erklärung dieser Zusammenhänge, wie Macht- und Kontrolltheorien, die Rational-Choice-Theorie und modernisierungstheoretische Hypothesen. Dabei werden die Rolle des Elternhauses und schichtspezifische Schulformen und angestrebte bzw. tatsächliche Abschlüsse hervorgehoben.
Intergenerationale Bildungsmobilität: Dieses Kapitel analysiert die intergenerationale Bildungsmobilität im Kontext der Bildungsexpansion in Deutschland. Es untersucht Bildungsaufstiege als Folge der Bildungsexpansion und beleuchtet die Vererbung von Bildungsaufstiegen und -status. Es werden empirische Studien (z.B. Fuchs und Sixt, Girod, Becker) herangezogen, um soziale Mobilität in Form von schulischen und beruflichen Bildungsaufstiegen zu untersuchen und die Statusvererbungsprozesse zwischen Generationen zu analysieren. Die Zusammenfassung dieses Kapitels fasst die Ergebnisse der untersuchten Studien zusammen und diskutiert die komplexen Muster der intergenerationalen Bildungsmobilität.
Schlüsselwörter
Soziale Selektivität, Bildung, soziale Schicht, intergenerationale Bildungsmobilität, Bildungsungleichheit, Bildungsexpansion, Bildungsaufstieg, Herkunftsfamilie, soziostrukturelle Ansätze, empirische Studien.
Häufig gestellte Fragen zum Text über Soziale Selektivität von Bildung
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text untersucht die soziale Selektivität von Bildung und konzentriert sich dabei auf die intergenerationale Bildungsmobilität. Er analysiert den Einfluss der Herkunftsfamilie auf Bildungsunterschiede und beleuchtet den Zusammenhang zwischen Bildung, sozialer Schicht und Lebenschancen. Der Fokus liegt auf soziostrukturellen Ansätzen, wobei pädagogische und kontextuelle Faktoren zunächst ausgeklammert werden.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Die zentralen Themen sind: Soziale Selektivität von Bildung, intergenerationale Bildungsmobilität, Einflussfaktoren der Herkunftsfamilie auf Bildungserfolg, theoretische Ansätze zur Erklärung von Bildungsunterschieden und der Zusammenhang zwischen Bildung, sozialer Schicht und Lebenschancen. Der Text behandelt Bildung im umfassenden Sinne (vorschulisch, schulisch, beruflich).
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu "Bildung und Soziale Schicht", ein Kapitel zu "Intergenerationale Bildungsmobilität" und eine abschließende Diskussion. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.
Wie wird der Begriff "Bildung" im Text verstanden?
Der Text versteht Bildung umfassend, inklusive vorschulischer, schulischer und beruflicher Bildung.
Welche theoretischen Ansätze werden zur Erklärung von Bildungsunterschieden verwendet?
Der Text erwähnt verschiedene theoretische Ansätze, darunter Macht- und Kontrolltheorien, die Rational-Choice-Theorie und modernisierungstheoretische Hypothesen, um die Korrelation zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg zu erklären. Die Rolle des Elternhauses und schichtspezifische Schulformen werden ebenfalls hervorgehoben.
Welche empirischen Studien werden im Text erwähnt?
Der Text bezieht sich auf empirische Studien von Autoren wie Fuchs und Sixt, Girod und Becker, um soziale Mobilität und Statusvererbungsprozesse zwischen Generationen zu untersuchen.
Was ist der Schwerpunkt des Kapitels "Intergenerationale Bildungsmobilität"?
Dieses Kapitel analysiert die intergenerationale Bildungsmobilität im Kontext der Bildungsexpansion in Deutschland, untersucht Bildungsaufstiege und beleuchtet die Vererbung von Bildungsaufstiegen und -status.
Was sind die Schlüsselwörter des Textes?
Die Schlüsselwörter sind: Soziale Selektivität, Bildung, soziale Schicht, intergenerationale Bildungsmobilität, Bildungsungleichheit, Bildungsexpansion, Bildungsaufstieg, Herkunftsfamilie, soziostrukturelle Ansätze, empirische Studien.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text untersucht die soziale Selektivität von Bildung, wobei der Schwerpunkt auf der intergenerationalen Bildungsmobilität und den Einflussfaktoren der Herkunftsfamilie auf Bildungsunterschiede liegt. Er analysiert theoretische Ansätze zur Erklärung von Bildungsungleichheit und beleuchtet den Zusammenhang zwischen Bildung, sozialer Schicht und den daraus resultierenden Lebenschancen.
- Citar trabajo
- Katharina Hartenstein (Autor), 2009, Soziale Schicht und Bildung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140256