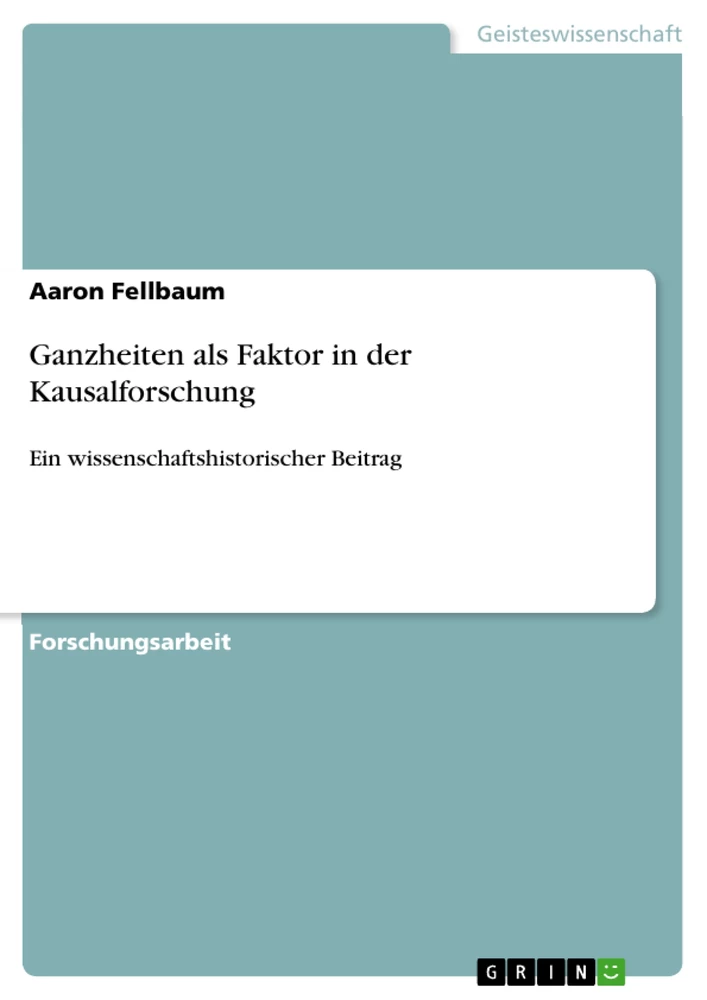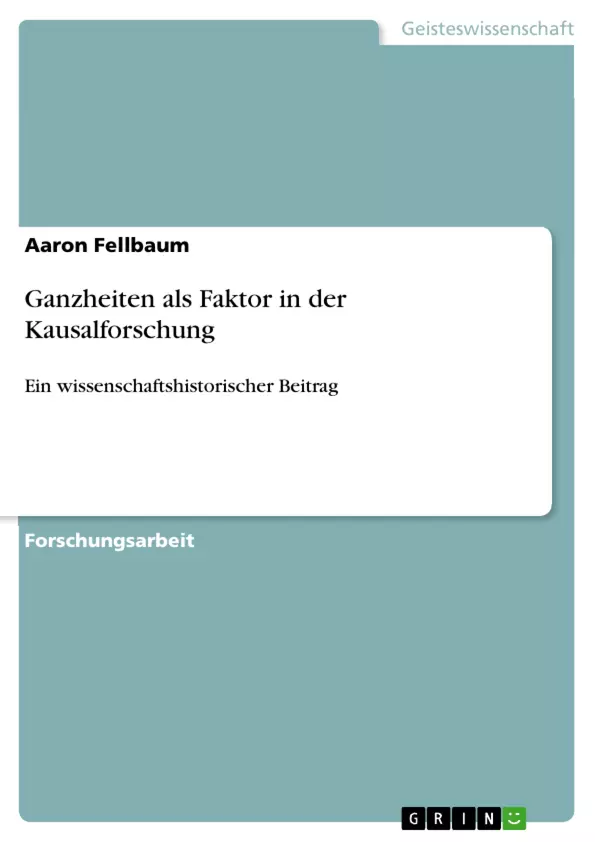Organismen sind Kausalstrukturen eigener Art. Die vermeintliche Ganzheitskausalität (charakteristisch für Organismen), d.h. Kausalität, die durch mechanische Effekte nicht erklärbar ist, kann als Denkhilfe zur Phänomenbeschreibung (d.h. als Idee im erkennenden Subjekt) interpretiert werden (Kant). Da Kausalstrukturen (als Strukturen, die in der Natur zu entdecken sind) nun einmal keine bloßen Ideen des Subjekts sind, gab es von Anfang an Widerstand gegen dies Denken Immanuel Kants. Es schien in der Naturphilosophie nach 1790 möglich zu sein, Organismen durch die Differenzierung verschiedener Ebenen der Leitung des Kausalgeschehens objektiv (und als Naturprodukte, in der Natur vorfindlich [z.B. Schelling, Oken u.a.]) erfassen zu können.
Doch hatte man sich zu früh gefreut, einen Fehler in Kants Denken entdeckt zu haben. Bei der zunehmenden Ausdifferenzierung der Beschreibungsebenen in der Naturforschung ist es nämlich wieder (aufgrund der Inkompatibilität der Wirklichkeitsebenen) für Naturforscher (insbesondere Physiker) nicht möglich, auf subjektive, also reflektierte (tentative) Kausalmodelle zu verzichten. Die vermeintliche Schwäche von Immanuel Kants Kritik der Urteilskraft (1790) enthüllt den Königsberger Professor letztlich doch auch heutzutage als einen Philosophen mit Gespür für die Situation des Naturforschers im Zeitalter nach der Systematisierung der empirisch vorgefundenen Natur durch Karl von Linné (1707-1778): Zumindest Teile der Kausalanalyse müssen durch Eigentätigkeit des epistemischen Subjekts, durch durchsichtige Verständlichkeit des Denkens des Naturforschers, erklärt und damit interpretiert werden, da es leider keine ideale Wissenschaft gibt und vermutlich nie geben wird. Also ist das explanans dem explanandum, der Natur selbst, niemals angemessen. Theorienentwürfe sind immer notwendige Entwicklungen und sie sind nie dem explanandum vollkommen angemessen.
Inhaltsverzeichnis
- (A) Organismische Ganzheitskausalität
- Die Unlösbarkeit der Paradoxien
- Reflexion der Urteilskraft
- Das Ganze kann nicht aus seinen Teilen zusammengesetzt sein
- ,,Idee des Ganzen“ als Erkenntnisgrund
- Ganzheit als Idee der epistemischen Subjektivität
- Ganzheit als (reflexiv angenommener) Kausalfaktor
- „Ideen der Reflexion“
- „Endursachen“ im Naturzweck
- Gott schuf die organische Natur wie ein Künstler
- ,,regulative Annahmen“
- Mentale Kausalität kann ausgeschlossen werden
- Geistige Zustände als Handlungs-Ursachen
- „Idee des Ganzen“ als „regulative Annahme“
- Die schwerwiegenden Folgen für die Naturinterpretation
- (B) (a): Die organische Ganzheit als Teil der Ganzheit der Natur selbst
- Leben als in sich geschlossene universale Kausalität
- Die Fensterlose Monade
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Forschungsarbeit untersucht die Rolle von Ganzheiten in der Kausalforschung. Der Autor argumentiert, dass die vermeintliche Ganzheitskausalität, die durch mechanische Effekte nicht erklärbar ist, als Denkhilfe für die Phänomenbeschreibung interpretiert werden kann. Der Text befasst sich mit der Kritik des Philosophen Immanuel Kant an der organismischen Ganzheitskausalität und den späteren Versuchen, diese Kritik zu widerlegen. Ziel ist es, zu beleuchten, warum Kants Argumentation im Kontext der modernen Naturforschung relevant bleibt.
- Die Rolle von Ganzheiten in der Kausalforschung
- Kants Kritik an der organismischen Ganzheitskausalität
- Versuche, Kants Kritik zu widerlegen
- Die Relevanz von Kants Argumentation für die moderne Naturforschung
- Die Rolle der epistemischen Subjektivität in der Kausalforschung
Zusammenfassung der Kapitel
(A) Dieses Kapitel befasst sich mit der organismischen Ganzheitskausalität, einer Konzeption, die auf Immanuel Kant zurückzuführen ist. Die Hauptargumentation Kants besagt, dass die Ganzheit eines Organismus nicht aus seinen Teilen zusammengesetzt sein kann und daher keine mechanistische Erklärung findet. Er argumentiert, dass die „Idee des Ganzen“ als „regulative Annahme“ für unser Denken dient und keine kausale Wirkung auf die Naturerscheinungen hat.
(B) (a): Dieses Kapitel analysiert die Gegenbewegung zu Kants Kritik, die sich aus der Idee entwickelt hat, die organische Ganzheit als Teil der Ganzheit der Natur selbst zu betrachten. Dieser Ansatz, der unter anderem von F.W.J. Schelling und Lorenz Oken vertreten wurde, betonte die Universalität und Geschlossenheit der Kausalstruktur des Lebendigen.
Schlüsselwörter
Ganzheitskausalität, organismische Ganzheit, epistemische Subjektivität, Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, Naturphilosophie, Naturforschung, Mechanismus, Teleologie, Naturzweck, regulative Annahmen, Kausalität, Leibniz, Monadologie, Schelling, Oken.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Ganzheitskausalität" bei Organismen?
Es bezeichnet eine Form der Kausalität, die über rein mechanische Effekte hinausgeht und den Organismus als ein Ganzes betrachtet, das nicht bloß die Summe seiner Teile ist.
Welche Position vertrat Immanuel Kant zur Ganzheit in der Natur?
Kant sah die "Idee des Ganzen" als eine regulative Annahme des menschlichen Verstandes (Subjektivität), nicht als eine objektiv in der Natur beweisbare mechanische Kraft.
Warum ist Kants "Kritik der Urteilskraft" heute noch relevant?
Weil moderne Naturforscher (wie Physiker) oft feststellen, dass sie auf subjektive Kausalmodelle angewiesen sind, da Theorien die Komplexität der Natur nie vollkommen abbilden können.
Was kritisierten Philosophen wie Schelling oder Oken an Kant?
Sie versuchten, Organismen als objektiv erfassbare Naturprodukte darzustellen, deren Ganzheit direkt in der Natur vorfindlich ist, statt sie nur als Idee des Subjekts zu betrachten.
Was ist ein "Naturzweck"?
Ein Naturzweck beschreibt ein Objekt (wie einen Organismus), bei dem die Teile nur durch ihre Beziehung zum Ganzen und zueinander möglich sind, was eine teleologische Betrachtung erfordert.
- Citation du texte
- Aaron Fellbaum (Auteur), 2023, Ganzheiten als Faktor in der Kausalforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1402869