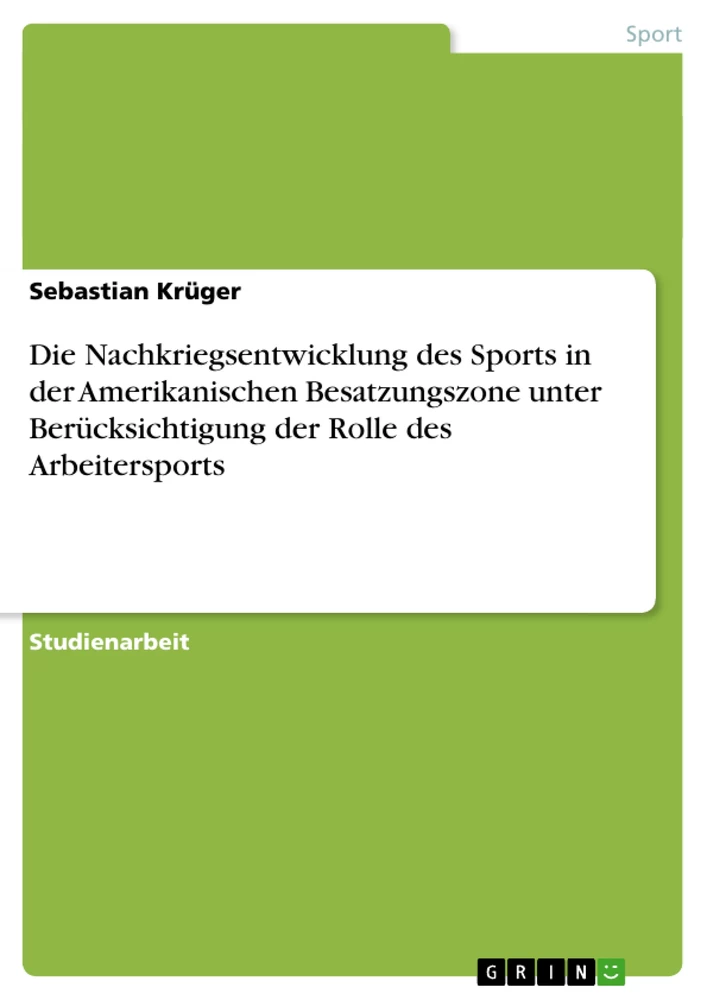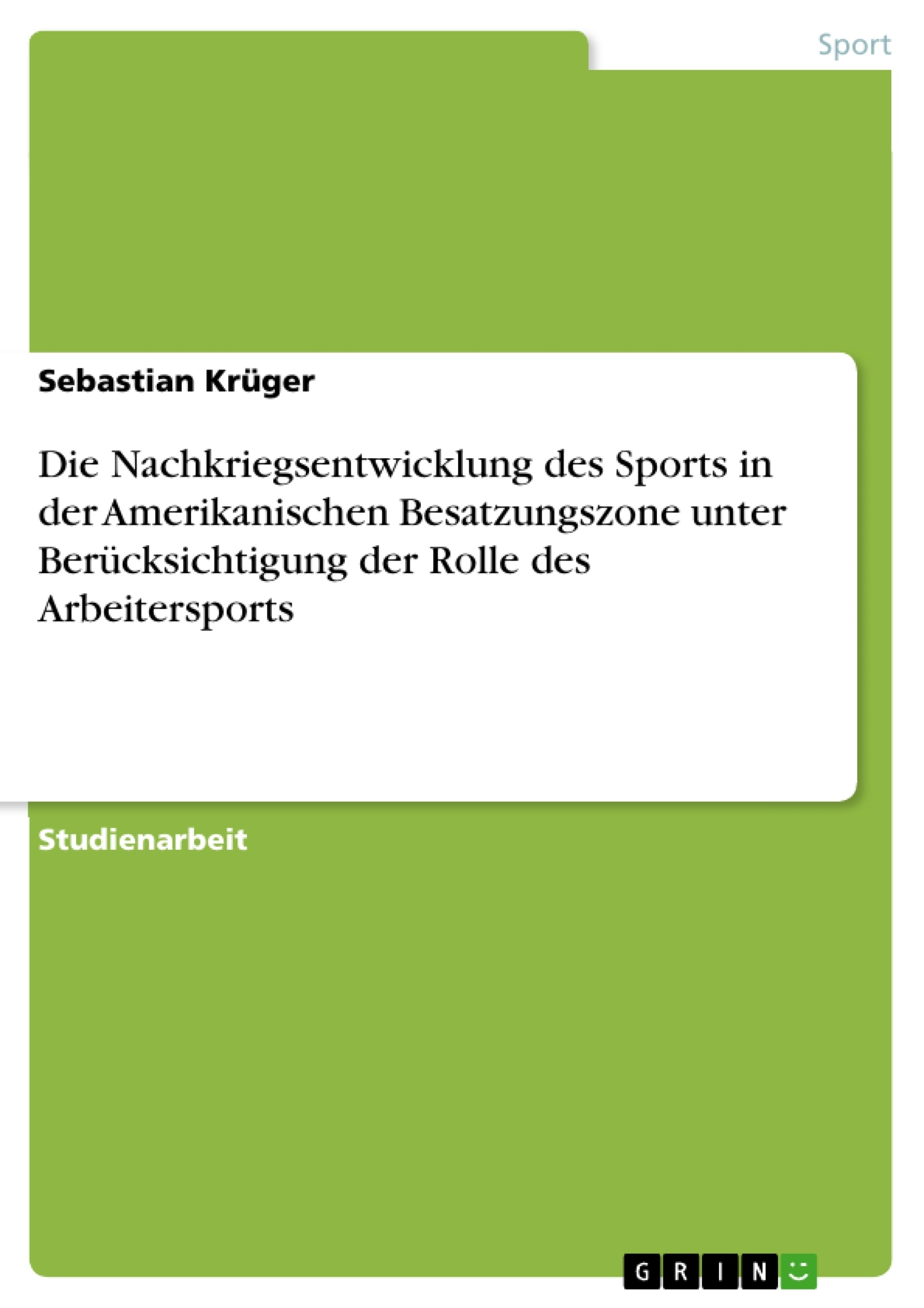Die vorliegende Ausarbeitung befasst sich mit dem Thema der Nachkriegsentwicklung
des deutschen Sports in der Amerikanischen Besatzungszone
(ABZ). Dabei gilt es zum einen, die allgemeine Situation nach
der Diktatur darzustellen und zum anderen, mit welchen Mitteln die USAmerikaner
das besiegte und zerstörte Dritte Reich in die Demokratie zu
führen versuchten.
Vom Allgemeinen dann zum Speziellen, d.h., es soll der sportliche Fragenkatalog
beantwortet werden. Wie packt man den Sport und sein System
an? Neu- oder Wiederaufbau? Zersplitterung oder Einheitssportbewegung?
Vorweg kann schon gesagt werden, dass dabei die Rolle der ehemaligen
Arbeitersportler eine beachtenswerte war und somit auch Berücksichtigung
in dieser Hausarbeit finden muss.
Die Sekundärliteraturlage kann durchaus als schlecht bezeichnet werden.
Eine gesamt süddeutsche Sportbetrachtung sucht man vergebens. So
muss von einzelnen Landessportbünden auf die gesamte ABZ geschlossen
werden.
„Um den Einfluß der Besatzungsmächte in ihrer realen Wirkung einschätzen zu
können, muß man dabei die Sportentwicklung in dieser Zeit bis zumindest auf die
Kreisebene zurückverfolgen. Dies ist meines Wissens bisher nirgendwo geschehen,
so daß auf diesem Gebiet bislang mehr Thesen als gesicherte Erkenntnisse
die Diskussion bestimmen.“ (Nitsch 1985, S. 41)
Nichtsdestotrotz muss das Ziel dieser Arbeit sein, eine möglichst umfassende
Darstellung über Situation und Problematik des Sportaufbaus in
der ABZ zu liefern und kritische Fragezeichen hinter Kohärenzlücken in
der Sekundärliteratur zu setzen. Wo möglich, sollen diese Lücken plausibel
geschlossen werden. Die Hausarbeit basiert auf der Referatsleistung in dem Hauptseminar „Die
Nachkriegsentwicklung des deutschen Sports (1945-1957)“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklungen nach dem 2. Weltkrieg
- Die allgemeine politische Situation
- Kontrollierter Aufschwung durch die Militärregierung in der ABZ?
- Die Konsequenzen für den Sport in der ABZ
- Die Rolle des Arbeitersports
- Zusammenfassende Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung analysiert die Nachkriegsentwicklung des deutschen Sports in der Amerikanischen Besatzungszone (ABZ). Sie beleuchtet die allgemeine Situation nach dem Zweiten Weltkrieg und die Bemühungen der US-Amerikaner, das besiegte und zerstörte Dritte Reich in die Demokratie zu führen. Darüber hinaus untersucht die Arbeit die spezifische Frage, wie der Sport und sein System in der ABZ neu aufgebaut wurden und welche Rolle der Arbeitersport dabei spielte.
- Die politische und wirtschaftliche Situation in der ABZ nach dem Zweiten Weltkrieg
- Die Auswirkungen des Krieges auf die deutsche Sportlandschaft
- Die Rolle der Besatzungsmächte in der Entwicklung des Sports
- Der Einfluss des Arbeitersports auf die Sportentwicklung in der ABZ
- Die Herausforderungen und Chancen des Sportaufbaus in der Nachkriegszeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und skizziert die Forschungsfrage. Sie erläutert außerdem die schwierige Sekundärliteraturlage, die eine umfassende Betrachtung der Sportentwicklung in der gesamten ABZ erschwert.
Das zweite Kapitel analysiert die allgemeine politische Situation in der ABZ nach dem Zweiten Weltkrieg. Es beleuchtet die Folgen des Krieges für die Infrastruktur, das Bildungssystem und die allgemeine Lebenslage der Bevölkerung.
Schlüsselwörter
Nachkriegsentwicklung, Sport, Amerikanische Besatzungszone, Arbeitersport, Politik, Wirtschaft, Rekonstruktion, Wiederaufbau, Besatzungsmächte, Demokratie, Schulwesen, Infrastruktur, Lebenslage, Sportstätten, Vereinswesen
Häufig gestellte Fragen
Wie entwickelte sich der Sport in der Amerikanischen Besatzungszone (ABZ)?
Nach 1945 gab es einen kontrollierten Wiederaufbau, bei dem die US-Militärregierung den Sport zur Demokratisierung der deutschen Gesellschaft nutzte.
Welche Rolle spielten ehemalige Arbeitersportler?
Arbeitersportler waren maßgeblich am personellen und organisatorischen Wiederaufbau der Sportstrukturen in der ABZ beteiligt.
Was war das Ziel der US-Militärregierung im Bereich Sport?
Ziel war es, das durch die NS-Diktatur geprägte Sportsystem zu entnazifizieren und in eine demokratische Sportbewegung zu überführen.
Warum ist die Quellenlage zur Sportgeschichte dieser Zeit schwierig?
Es mangelt an umfassenden süddeutschen Gesamtdarstellungen, weshalb oft von einzelnen Landessportbünden auf die gesamte Zone geschlossen werden muss.
Gab es einen kompletten Neuaufbau oder einen Wiederaufbau alter Strukturen?
Die Arbeit untersucht das Spannungsfeld zwischen der Zersplitterung und dem Streben nach einer neuen, einheitlichen Sportbewegung.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Krüger (Autor:in), 2002, Die Nachkriegsentwicklung des Sports in der Amerikanischen Besatzungszone unter Berücksichtigung der Rolle des Arbeitersports, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14031