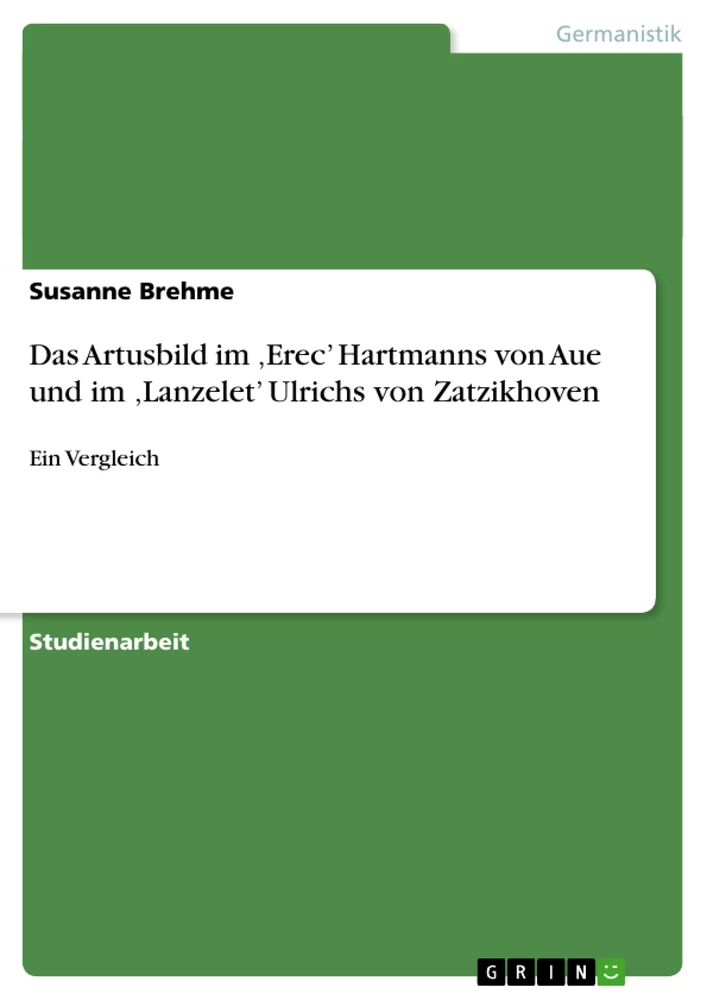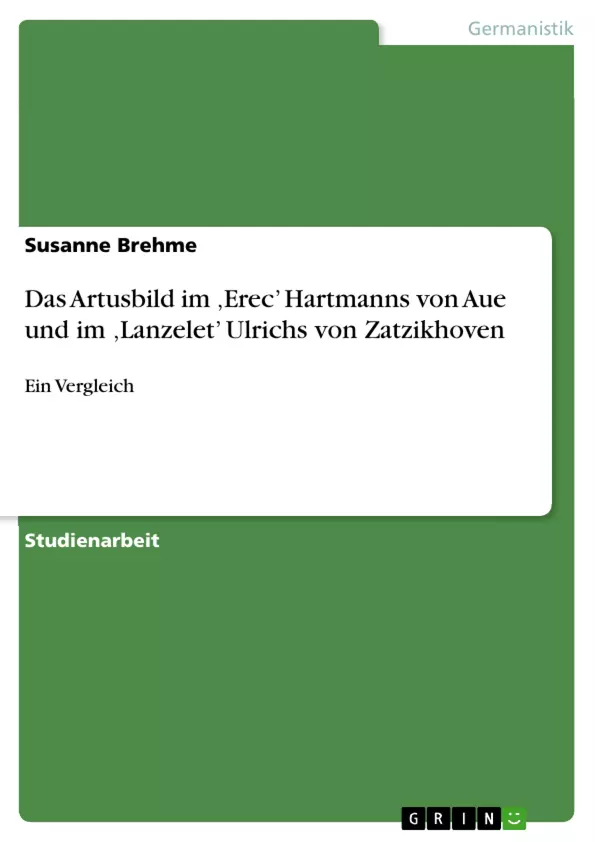In dieser Hauptseminararbeit wird die Darstellung der Figur des König Artus in zwei Artusromanen, dem Lancelet und dem Erec, miteinander verglichen.
Die klassischen deutschen Artusromane wurden im Hochmittelalter, also um 1200, verfasst
und sind im Allgemeinen durch feste Motive, eine bestimmte Struktur und einen festgelegten
Personenkreis charakterisiert. Sie verhandeln ein literarisch geschaffenes Werte- und
Orientierungssystem, das außerhalb der kirchlichen Heilslehre funktionieren kann. Die von
den Autoren gestaltete Handlung soll einerseits unterhalten, hat aber andererseits die Absicht,
beim Publikum einen Reflexionsprozess über das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft
auszulösen.
In den Romanen versammelt König Artus, der ideale höfischer Herrscher alle vortrefflichen
Ritter zusammen mit ihren Damen um seine Tafelrunde. Dieses integrierende und
Gemeinschaft stiftende Werte- und Verhaltensideal wird durch zwei zentrale Bereiche des
ritterlichen Lebens bestimmt: Die "Minne" und die "Aventiure".
Die ritterlichen Helden haben in ihrer Geschichte, die sich zumeist außerhalb der Tafelrunde
vollzieht, die Aufgabe, für sich selbst einen richtigen Begriff von "Aventiure" und "Minne" zu
finden. Das Verhältnis zwischen diesen beiden Bereichen, also die Frage nach Ausgleich
zwischen der Entfaltung der Individualität und den gesellschaftlichen Verpflichtungen und
der Bezug zum Ideal des Artushofes sind dabei wesentliche Bestandteile.
Im Mittelpunkt des Artushofes steht natürlich König Artus. Zwei Beispiele aus dem Bereich
der klassischen Artusromane werden mit Bezug auf diesen Herrscher im Folgenden kurz
vorgestellt und anhand bestimmter Leitfragen verglichen. Diese Romane sind der ‚Erec’ von
Hartmann von Aue und der ‚Lanzelet’ von Ulrich von Zatzikhoven3. Wichtig für die Analyse
der beiden Romane ist die Darstellung von Artus im Rahmen der Tradition und Konvention
und die Frage, ob er einem bestimmten Typus angehört oder davon abweicht. Außerdem soll
die Funktion von Artus als Figur in der Interaktion mit den Figuren und die Bedeutung der
Artusszenen für die Struktur der Romane genauer untersucht werden. Zum Schluss steht die
Fragestellung, ob sich das Artusbild im Vergleich von ‚Erec’ zu ‚Lanzelet’ geändert hat. Dazu
soll im Vorfeld der Analyse eine ungefähre historische Einordnung der Romane stattfinden.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Einordnung
- Erec'
- Lanzelet'
- Artus als traditioneller Herrscher?
- Erec'
- Lanzelet'
- Funktion von Artus in der Interaktion mit den Figuren
- Erec'
- Lanzelet'
- Bedeutung der Artusszenen für die Struktur des Romans
- Erec'
- Lanzelet'
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Darstellung von König Artus in den klassischen deutschen Artusromanen „Erec“ von Hartmann von Aue und „Lanzelet“ von Ulrich von Zatzikhoven. Sie analysiert die Rolle von Artus im Kontext der Ritterkultur, seiner Position als Herrscher und seine Interaktion mit den Figuren des Romans. Darüber hinaus wird die Bedeutung der Artusszenen für die Struktur der jeweiligen Werke beleuchtet.
- Artus als traditioneller Herrscher im Vergleich zu den neuen Tendenzen der Ritterkultur
- Die Rolle von Artus in der Interaktion mit den Figuren
- Die Bedeutung der Artusszenen für die Struktur der Romane
- Vergleich des Artusbildes in „Erec“ und „Lanzelet“
- Die historische Einordnung der beiden Romane
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die klassischen deutschen Artusromane und ihre Bedeutung im Kontext des Hochmittelalters vor. Sie erläutert die zentralen Themen des Werkes, die Funktion von Artus als Herrscher und die Bedeutung der „Minne“ und „Aventiure“ in der ritterlichen Lebenswelt.
Historische Einordnung
Dieses Kapitel bietet eine kurze historische Einordnung der beiden Romane „Erec“ und „Lanzelet“. Es beleuchtet die Entstehungszeit der Werke und die möglichen Quellen, auf denen sie beruhen.
Artus als traditioneller Herrscher?
Dieses Kapitel untersucht, inwiefern Artus in den beiden Romanen als traditioneller Herrscher dargestellt wird. Es setzt sich mit der Artusfigur in der Tradition der „Chronica Regum Britanniae“ von Geoffrey von Monmouth und der „Brut“ von Wace auseinander und analysiert, wie sich diese Darstellung in den späteren Romanen von Chrétien de Troyes und ihren deutschen Adaptionen verändert hat.
Funktion von Artus in der Interaktion mit den Figuren
Dieses Kapitel analysiert die Funktion von Artus als Figur in der Interaktion mit den Figuren. Es untersucht die Beziehung zwischen Artus und seinen Rittern und die Rolle, die er im Handlungsverlauf der Romane spielt.
Bedeutung der Artusszenen für die Struktur des Romans
Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Artusszenen für die Struktur der Romane. Es untersucht, wie die Artusszenen die Handlung vorantreiben und die Figurenentwicklung beeinflussen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen der Arbeit sind: Artusroman, mittelalterliche Literatur, höfische Kultur, Ritterkultur, Tradition, Herrscherideal, „Minne“, „Aventiure“, Interaktion, Struktur, „Erec“, „Lanzelet“, Hartmann von Aue, Ulrich von Zatzikhoven.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird König Artus im Vergleich zwischen ‚Erec‘ und ‚Lanzelet‘ dargestellt?
Die Arbeit untersucht, ob Artus als traditioneller Herrscher agiert oder ob sein Bild im Lanzelet von den Konventionen des Erec abweicht, insbesondere in Bezug auf seine Interaktion mit den Rittern.
Was bedeuten „Minne“ und „Aventiure“ im Artusroman?
Dies sind die zentralen Werteideale: „Minne“ steht für die höfische Liebe und „Aventiure“ für die ritterliche Bewährung im Kampf. Das Gleichgewicht beider ist entscheidend für die Identität des Helden.
Welche Funktion hat der Artushof für die Struktur der Romane?
Der Hof dient als Ausgangs- und Zielpunkt der Handlung sowie als integrierendes Wertezentrum, an dem sich die Ritter messen und in die Gesellschaft eingliedern müssen.
Wer sind die Autoren der untersuchten Werke?
Der ‚Erec‘ wurde von Hartmann von Aue verfasst, während der ‚Lanzelet‘ von Ulrich von Zatzikhoven stammt.
Wann entstanden die klassischen deutschen Artusromane?
Die Blütezeit dieser Literatur lag im Hochmittelalter, etwa um das Jahr 1200.
- Arbeit zitieren
- Susanne Brehme (Autor:in), 2005, Das Artusbild im ‚Erec’ Hartmanns von Aue und im ‚Lanzelet’ Ulrichs von Zatzikhoven, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140470