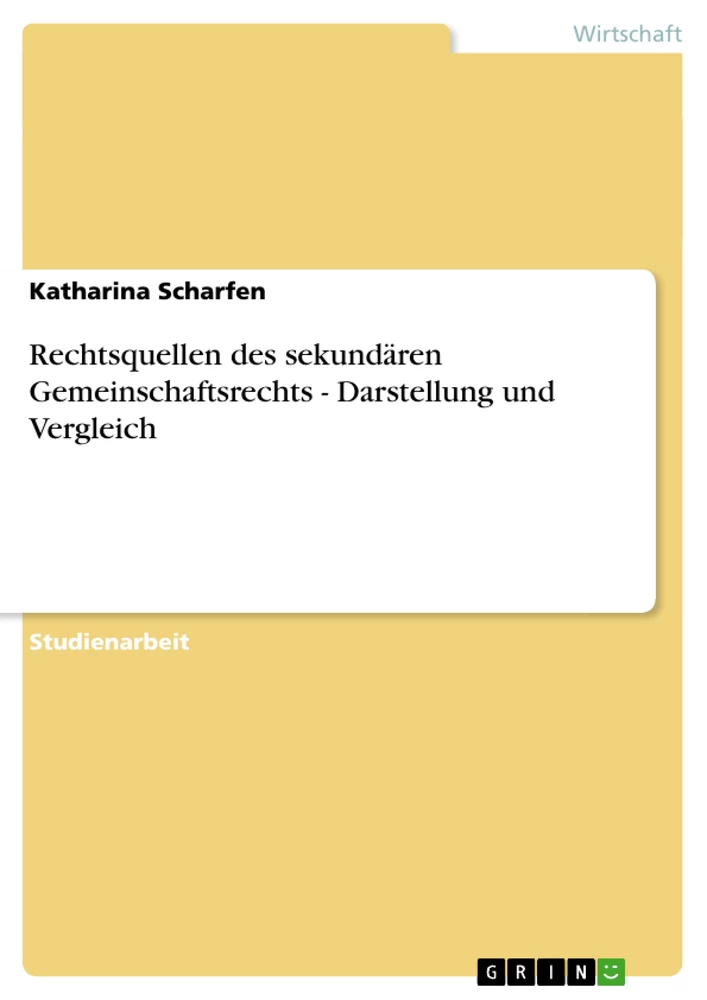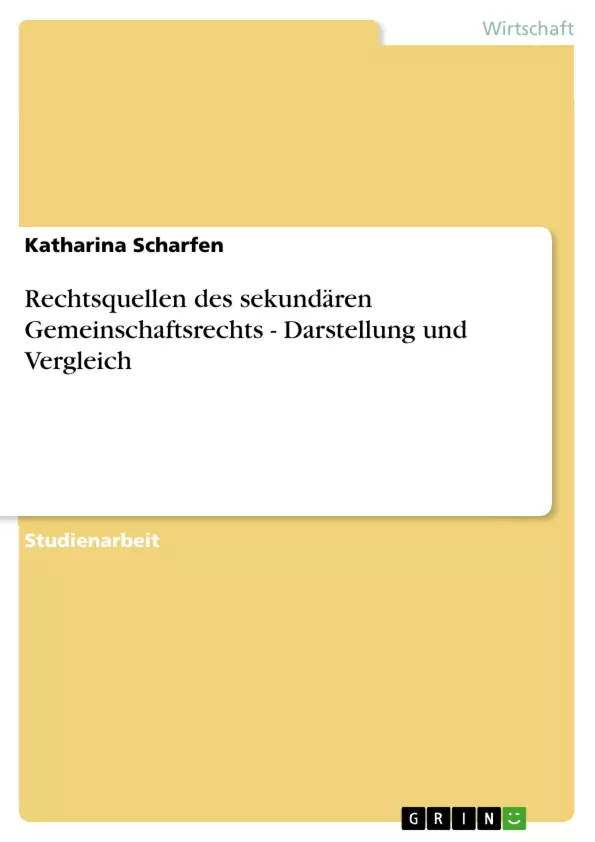Die vorliegende Seminararbeit befasst sich mit den Rechtsquellen des sekundären Gemeinschaftsrechts.
Zunächst wird in einer kurzen Einführung, die Abgrenzung vom
primären und sekundärem Gemeinschaftsrecht erarbeitet. Im Artikel 249 des Vertrages
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) werden die Rechtsakte definiert,
in deren Form sekundäres Gemeinschaftsrecht erlassen werden kann. Diese Rechtsakte
sind: Verordnungen, Richtlinien, Entscheidungen und Empfehlungen/Stellungnahmen.
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden diese Rechtsakte dargestellt und es wird auf
deren Rechtswirkungen eingegangen. Abschließend erfolgt ein kurzer Vergleich dieser
Rechtsakte und im Schlussteil einige Hinweise zu verschiedenen Auslegungsmethoden
des Gemeinschaftsrechts.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Einführung
- 2.1 Quellen des Gemeinschaftsrechts
- 2.2 Abgrenzung: Primäres und Sekundäres Gemeinschaftsrecht
- 2.3 Artikel 249 EGV
- 2.4 Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung bei der Setzung von sekundärem Gemeinschaftsrecht
- 3 Verordnungen
- 4 Richtlinien
- 4.1 Grundlagen
- 4.2 Zweistufige Rechtsetzung
- 4.3 Rechtswirkungen der Richtlinie im Fall ordnungsgemäßer Umsetzung
- 4.4 Rechtswirkungen der Richtlinie im Fall nicht rechtzeitiger oder nicht ordnungsgemäßer Umsetzung
- 4.5 Die unmittelbare Anwendbarkeit von Richtlinien
- 4.6 Sperrwirkung erlassener Richtlinien
- 5 Entscheidungen
- 6 Empfehlungen und Stellungnahmen
- 7 Vergleich
- 8 Staatshaftung für die Verletzung von Gemeinschaftsrecht durch die Mitgliedstaaten
- 9 Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Rechtsquellen des sekundären Gemeinschaftsrechts. Ziel ist es, die verschiedenen Rechtsakte (Verordnungen, Richtlinien, Entscheidungen, Empfehlungen/Stellungnahmen) darzustellen, ihre Rechtswirkungen zu erläutern und einen Vergleich zwischen ihnen durchzuführen. Die Arbeit beleuchtet auch die Abgrenzung zum primären Gemeinschaftsrecht und das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung.
- Abgrenzung primäres und sekundäres Gemeinschaftsrecht
- Darstellung der verschiedenen Rechtsakte des sekundären Gemeinschaftsrechts
- Rechtswirkungen der einzelnen Rechtsakte
- Vergleich der Rechtsakte des sekundären Gemeinschaftsrechts
- Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Gegenstand der Arbeit, nämlich die Rechtsquellen des sekundären Gemeinschaftsrechts. Sie gibt einen Überblick über den Aufbau und die Gliederung der Arbeit, die sich mit der Definition und Erläuterung der verschiedenen Rechtsakte des sekundären Gemeinschaftsrechts befasst und diese im Anschluss vergleicht.
2 Einführung: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für die weitere Betrachtung des sekundären Gemeinschaftsrechts. Es differenziert zwischen primärem und sekundärem Gemeinschaftsrecht und definiert die Quellen des Gemeinschaftsrechts, wobei auch völkerrechtliche Verträge angesprochen werden, die zwar nicht dem Primär- oder Sekundärrecht direkt zuzuordnen sind, aber dennoch relevant sind. Die Abgrenzung zwischen primärem und sekundärem Recht wird anhand von Definitionen und der hierarchischen Struktur erläutert, wobei der Vorrang des Primärrechts hervorgehoben wird. Die Definition und Einordnung des sekundären Rechts als vom Primärrecht abgeleitetes Recht wird umfassend diskutiert.
3 Verordnungen: (Hier fehlt der Text zum Kapitel 3. Eine Zusammenfassung muss hinzugefügt werden, die mindestens 75 Wörter umfasst und die Thematik des Kapitels über Verordnungen umfassend beschreibt.)
4 Richtlinien: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit Richtlinien als Rechtsakt des sekundären Gemeinschaftsrechts. Es werden die Grundlagen der Richtlinien, die zweistufige Rechtsetzung, und die verschiedenen Rechtswirkungen im Fall ordnungsgemäßer und nicht ordnungsgemäßer Umsetzung behandelt. Besondere Aufmerksamkeit wird der unmittelbaren Anwendbarkeit von Richtlinien und ihrer Sperrwirkung gewidmet. Der Text analysiert die komplexen Interaktionen zwischen der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung und Anwendung von Richtlinien. Die Bedeutung des Verhältnisses zwischen gemeinschaftlichem und nationalem Recht wird herausgestellt, und die verschiedenen Möglichkeiten der Durchsetzung gemeinschaftlichen Rechts bei Nichteinhaltung der Richtlinien werden erörtert.
5 Entscheidungen: (Hier fehlt der Text zum Kapitel 5. Eine Zusammenfassung muss hinzugefügt werden, die mindestens 75 Wörter umfasst und die Thematik des Kapitels über Entscheidungen umfassend beschreibt.)
6 Empfehlungen und Stellungnahmen: (Hier fehlt der Text zum Kapitel 6. Eine Zusammenfassung muss hinzugefügt werden, die mindestens 75 Wörter umfasst und die Thematik des Kapitels über Empfehlungen und Stellungnahmen umfassend beschreibt.)
7 Vergleich: (Hier fehlt der Text zum Kapitel 7. Eine Zusammenfassung muss hinzugefügt werden, die mindestens 75 Wörter umfasst und die Thematik des Kapitels über den Vergleich der Rechtsakte umfassend beschreibt.)
8 Staatshaftung für die Verletzung von Gemeinschaftsrecht durch die Mitgliedstaaten: (Hier fehlt der Text zum Kapitel 8. Eine Zusammenfassung muss hinzugefügt werden, die mindestens 75 Wörter umfasst und die Thematik des Kapitels über Staatshaftung umfassend beschreibt.)
Schlüsselwörter
Primärrecht, Sekundärrecht, Gemeinschaftsrecht, Verordnungen, Richtlinien, Entscheidungen, Empfehlungen, Stellungnahmen, Artikel 249 EGV, Rechtswirkungen, unmittelbare Anwendbarkeit, begrenzte Einzelermächtigung, Staatshaftung, Rechtsquellen, Normenhierarchie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument "Rechtsquellen des Sekundären Gemeinschaftsrechts"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Rechtsquellen des sekundären Gemeinschaftsrechts. Sie beschreibt die verschiedenen Rechtsakte (Verordnungen, Richtlinien, Entscheidungen, Empfehlungen/Stellungnahmen), erläutert deren Rechtswirkungen und vergleicht diese miteinander. Zusätzlich wird die Abgrenzung zum primären Gemeinschaftsrecht und das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung beleuchtet.
Welche Rechtsakte des sekundären Gemeinschaftsrechts werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Verordnungen, Richtlinien, Entscheidungen, Empfehlungen und Stellungnahmen als Rechtsakte des sekundären Gemeinschaftsrechts. Für jeden dieser Rechtsakte wird dessen Rechtswirkung im Detail erklärt.
Wie wird das primäre vom sekundären Gemeinschaftsrecht abgegrenzt?
Die Arbeit definiert und erläutert die Abgrenzung zwischen primärem und sekundärem Gemeinschaftsrecht. Der Vorrang des Primärrechts wird hervorgehoben und die hierarchische Struktur beider Rechtsordnungen wird dargestellt. Das sekundäre Recht wird als vom Primärrecht abgeleitetes Recht definiert und eingeordnet.
Welche Rechtswirkungen haben die einzelnen Rechtsakte des sekundären Gemeinschaftsrechts?
Die Rechtswirkungen der Verordnungen, Richtlinien, Entscheidungen, Empfehlungen und Stellungnahmen werden jeweils einzeln und detailliert beschrieben. Besondere Aufmerksamkeit wird der unmittelbaren Anwendbarkeit von Richtlinien und der möglichen Staatshaftung bei Verletzung des Gemeinschaftsrechts gewidmet. Die Auswirkungen einer ordnungsgemäßen bzw. nicht ordnungsgemäßen Umsetzung von Richtlinien werden ebenfalls behandelt.
Wie werden die Rechtsakte des sekundären Gemeinschaftsrechts verglichen?
Die Arbeit enthält ein Kapitel, das einen umfassenden Vergleich der verschiedenen Rechtsakte des sekundären Gemeinschaftsrechts vornimmt. Dieser Vergleich beleuchtet die Unterschiede in ihren Rechtswirkungen und Anwendungsbereichen.
Was ist das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung?
Die Arbeit erklärt das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung im Kontext der Setzung von sekundärem Gemeinschaftsrecht. Es wird erläutert, wie dieses Prinzip die Gesetzgebungskompetenzen der EU-Institutionen einschränkt.
Welche Rolle spielt die Staatshaftung im Kontext des Gemeinschaftsrechts?
Die Arbeit widmet sich der Frage der Staatshaftung für die Verletzung von Gemeinschaftsrecht durch die Mitgliedstaaten. Es wird dargelegt, unter welchen Umständen Mitgliedstaaten haftbar gemacht werden können und welche Konsequenzen dies hat.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Primärrecht, Sekundärrecht, Gemeinschaftsrecht, Verordnungen, Richtlinien, Entscheidungen, Empfehlungen, Stellungnahmen, Artikel 249 EGV, Rechtswirkungen, unmittelbare Anwendbarkeit, begrenzte Einzelermächtigung, Staatshaftung, Rechtsquellen und Normenhierarchie.
Gibt es Kapitelzusammenfassungen?
Ja, die Arbeit enthält Kapitelzusammenfassungen, die einen Überblick über den Inhalt jedes Kapitels geben. Diese Zusammenfassungen sollen das Verständnis der komplexen Materie erleichtern.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Rechtsakten?
Die einzelnen Kapitel der Arbeit widmen sich jeweils einem spezifischen Rechtsakt des sekundären Gemeinschaftsrechts (Verordnungen, Richtlinien, Entscheidungen, Empfehlungen und Stellungnahmen) und beschreiben diesen detailliert.
- Quote paper
- Dipl. Math. Katharina Scharfen (Author), 2009, Rechtsquellen des sekundären Gemeinschaftsrechts - Darstellung und Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140531