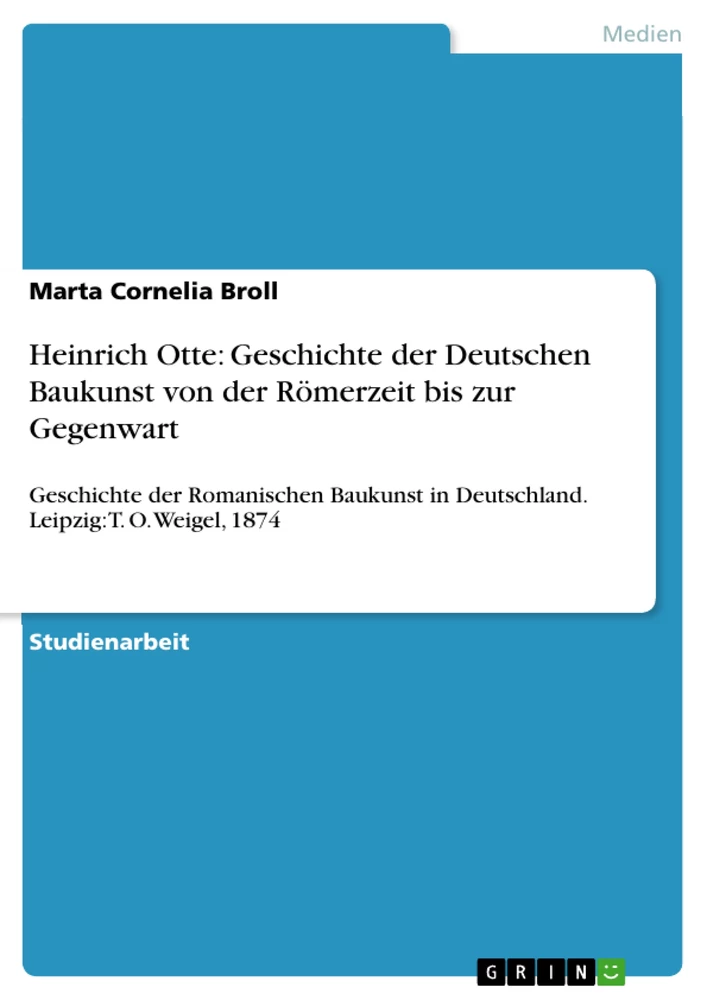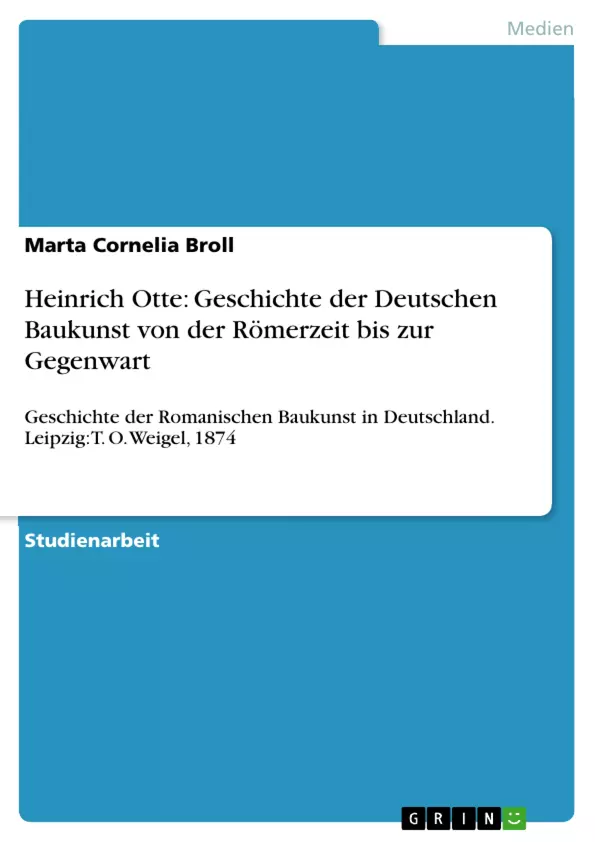Fällt der Begriff oder das Stichwort Kunstgeschichte, geraten viele Laien über ein bestimmtes Land – meist Italien - oder über ein bestimmtes Buch ins Schwärmen oder sie äußern sich eher ironisch über Vorlesungen im einschläfernden verdunkelten Hörsaal vor Lichtbildern oder über irgendeinen skurrilen Museumsführer. Zum Studium der Kunstgeschichte gehört die Geschichte der Kunstgeschichte, da kaum mehr eine wissenschaftliche Abhandlung ohne ein Kapitel über sie auskommt. Ein Abschnitt, der den Text entweder einleitet oder an dessen Ende den ermittelten Sachverhalt in die Geschichte kunsthistorischer Praxis einbringt. Fester Bestandteil des allgemeinen, aber erst recht des wissenschaftlichen Diskurses über die Kunst ist somit die Geschichte kunstgeschichtlichen Sehens und Denkens. Natürlich versteht es sich auch heutzutage von selbst, dass Bücher über Kunst reich zu illustrieren sind, was ebenso für wissenschaftliche wie populärwissenschaftliche Publikationen gilt. Dabei vergisst man allzu oft beim Durchblättern oder beim konzentrierten Lesen solcher Werke, welche Kosten und Mühen die Beschaffung und der Druck der Bilder bereiten. Fraglos ist diese technische Seite der Kunstbuchproduktion durch die Entwicklung umfassender fotografischer Bildarchive bestimmt. Und dass der Fotografie andere, in ihrer Zeit ebenfalls als objektiv geltende Reproduktions- und Druckverfahren vorausgingen, steht außer Frage. Die Ergründung und Prüfung, „wie Lithographien, Holz- und Stahlstiche sowie schließlich Fotos aus dem Besitz der großen Kunstverlage als Massenprodukte des 19. Jahrhunderts den Blick der Wissenschaft und ihres Publikums auf die Geschichte der Kunst bis heute konditionieren“ , hätte sich bereits daher gelohnt. Ein weitreichendes Versäumnis der Kunstgeschichte als wissenschaftliches Fachgebiet besteht auch darin, dass sie sich über Verfahren der Präsentation ihrer Gegenstände wie Forschungsergebnisse keine Rechenschaft gibt. „Kunsthistoriker können derzeit keine Auskunft darüber erteilen, wie Texte und Bilder zueinander in ein gegenseitig dienliches Verhältnis gebracht worden sind oder werden und welche Faktoren, insbesondere von außerhalb des Wissenschaftsbetriebs, diese Alltagspraxis noch immer prägen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Kunstgeschichte als wissenschaftliche Disziplin - Wendung zur Sachforschung?
- Die Gemeinschaft der Kunst- und Kulturpolitiker
- Das Bild im Text oder der Text mit Bild
- Pastor Heinrich Otte (1808 – 1890)
- Analyse zu Heinrich Ottes: Geschichte der Deutschen Baukunst von der Römerzeit bis zur Gegenwart. Geschichte der Romanischen Baukunst in Deutschland. Leipzig: T. O. Weigel, 1874.
- Abschließende Gedanken und Folgerungen
- Anhang
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert Heinrich Ottes Werk "Geschichte der Deutschen Baukunst von der Römerzeit bis zur Gegenwart. Geschichte der Romanischen Baukunst in Deutschland" (1874) und untersucht das Verhältnis von Text und Bild in diesem Werk. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklungen des Text-Bild-Verhältnisses im 19. Jahrhundert und geht der Frage nach, wie Text und Bild aufeinander reagieren. Darüber hinaus wird die Rolle der Kunstgeschichte als wissenschaftliche Disziplin und die Bedeutung der Sachforschung in diesem Kontext betrachtet.
- Die Entwicklung des Text-Bild-Verhältnisses im 19. Jahrhundert
- Die Rolle der Kunstgeschichte als wissenschaftliche Disziplin
- Die Bedeutung der Sachforschung in der Kunstgeschichte
- Die Analyse von Heinrich Ottes Werk "Geschichte der Deutschen Baukunst"
- Die Bedeutung von Bildern in der Kunstgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und beleuchtet die Bedeutung der Geschichte der Kunstgeschichte für das Verständnis von Kunst und Kunstwissenschaft. Sie stellt die Frage nach dem Verhältnis von Text und Bild in der Kunstgeschichte und beleuchtet die Entwicklungen dieses Verhältnisses im 19. Jahrhundert. Die Einleitung stellt außerdem die Arbeit von Heinrich Otte und sein Werk "Geschichte der Deutschen Baukunst" vor.
Das Kapitel "Die Kunstgeschichte als wissenschaftliche Disziplin - Wendung zur Sachforschung?" befasst sich mit der Entwicklung der Kunstgeschichte als wissenschaftliche Disziplin und der Bedeutung der Sachforschung in diesem Kontext. Es beleuchtet die Rolle der Kunst- und Kulturpolitiker in der Entwicklung der Kunstgeschichte und die Bedeutung der wissenschaftlichen Methode für die Erforschung der Kunst.
Das Kapitel "Das Bild im Text oder der Text mit Bild" analysiert das Verhältnis von Text und Bild in der Kunstgeschichte und untersucht die verschiedenen Formen der Bildreproduktion im 19. Jahrhundert. Es beleuchtet die Bedeutung von Bildern für die Vermittlung von Kunst und die Rolle der Bildreproduktion für die Entwicklung der Kunstgeschichte.
Das Kapitel "Pastor Heinrich Otte (1808 – 1890)" stellt die Person Heinrich Otte vor und beleuchtet seine Rolle als Kunsthistoriker. Es analysiert sein Werk "Geschichte der Deutschen Baukunst" und untersucht das Verhältnis von Text und Bild in diesem Werk. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Ottes Werk für die Entwicklung der Kunstgeschichte und die Rolle der Sachforschung in seinem Werk.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Kunstgeschichte, die Sachforschung, das Text-Bild-Verhältnis, die Bildreproduktion, Heinrich Otte, "Geschichte der Deutschen Baukunst", Romanische Baukunst, 19. Jahrhundert, wissenschaftliche Disziplin, Kunst und Kulturpolitik.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Heinrich Otte?
Heinrich Otte (1808–1890) war ein Pastor und Kunsthistoriker, der bedeutende Werke zur Geschichte der deutschen Baukunst, insbesondere der Romanik, verfasste.
Was ist das Hauptthema des analysierten Werkes von Otte?
Die Arbeit analysiert Ottes "Geschichte der Deutschen Baukunst" von 1874 und untersucht dabei insbesondere das Verhältnis zwischen Text und Bild in der kunsthistorischen Vermittlung.
Warum ist die Geschichte der Kunstgeschichte wichtig?
Sie hilft zu verstehen, wie sich das kunsthistorische Sehen und Denken entwickelt hat und wie wissenschaftliche Abhandlungen durch zeitgenössische Praktiken geprägt wurden.
Wie veränderte die Bildreproduktion im 19. Jahrhundert die Kunstwissenschaft?
Verfahren wie Lithographie, Holzstich und später die Fotografie ermöglichten eine massenhafte Verbreitung von Kunstbildern, was den Blick der Wissenschaft und des Publikums nachhaltig konditionierte.
Was kritisiert die Arbeit an der heutigen Kunstgeschichte?
Es wird kritisiert, dass sich das Fach oft keine Rechenschaft darüber gibt, wie Texte und Bilder zueinander in ein dienliches Verhältnis gebracht werden und welche externen Faktoren diese Praxis prägen.
- Citation du texte
- Magistra Artium Marta Cornelia Broll (Auteur), 2005, Heinrich Otte: Geschichte der Deutschen Baukunst von der Römerzeit bis zur Gegenwart, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140682